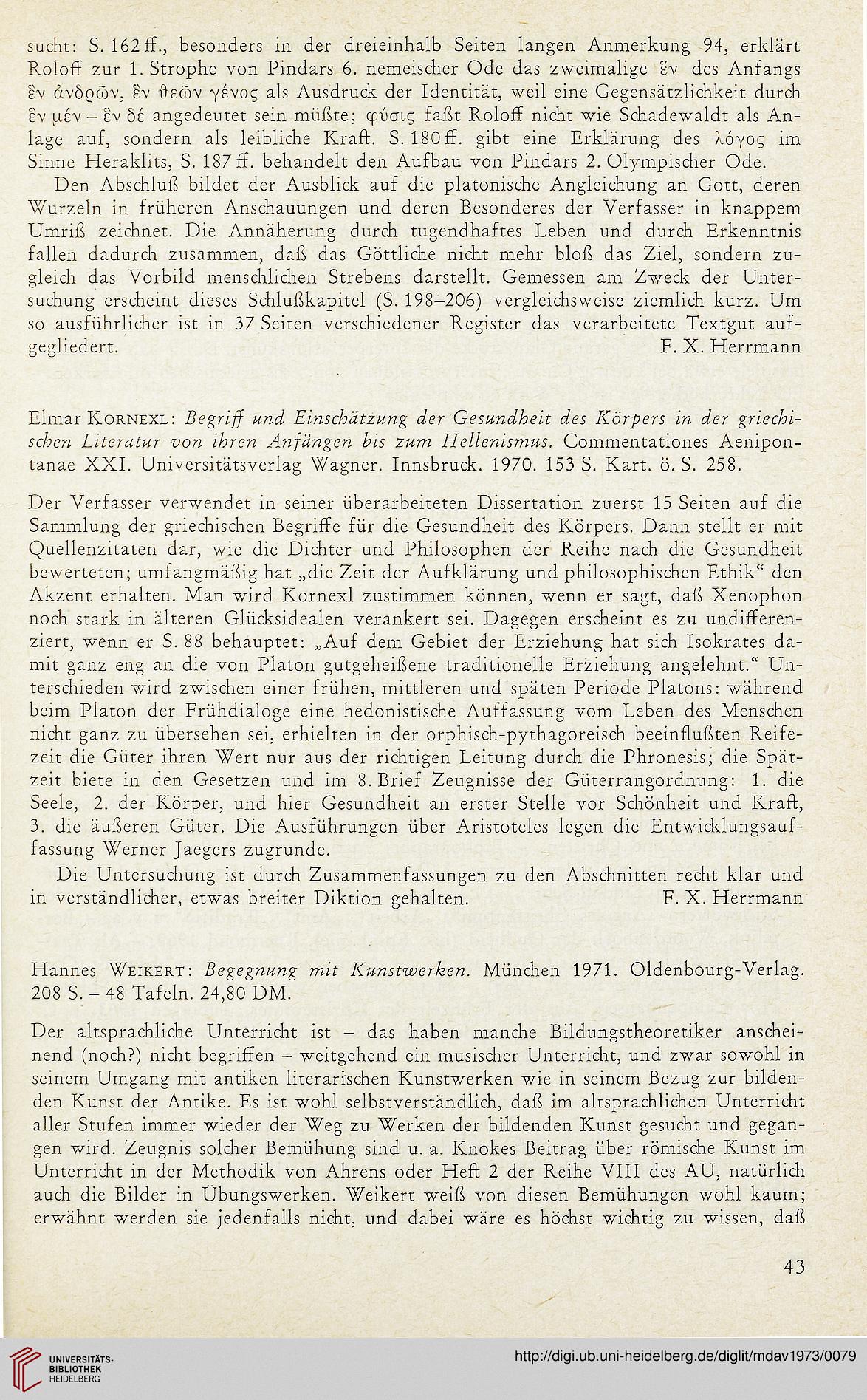sucht: S. 162ff., besonders in der dreieinhalb Seiten langen Anmerkung 94, erklärt
Roloff zur 1. Strophe von Pindars 6. nemeischer Ode das zweimalige ev des Anfangs
ev dvÖQtov, ev ffecov yevoq als Ausdruck der Identität, weil eine Gegensätzlichkeit durch
ev uev - ev öe angedeutet sein müßte; cpuaig faßt Roloff nicht wie Schadewaldt als An-
lage auf, sondern als leibliche Kraft. S. 180 ff. gibt eine Erklärung des Xoyoq im
Sinne Heraklits, S. 187 ff. behandelt den Aufbau von Pindars 2. Olympischer Ode.
Den Abschluß bildet der Ausblick auf die platonische Angleichung an Gott, deren
Wurzeln in früheren Anschauungen und deren Besonderes der Verfasser in knappem
Umriß zeichnet. Die Annäherung durch tugendhaftes Leben und durch Erkenntnis
fallen dadurch zusammen, daß das Göttliche nicht mehr bloß das Ziel, sondern zu-
gleich das Vorbild menschlichen Strebens darstellt. Gemessen am Zweck der Unter-
suchung erscheint dieses Schlußkapitel (S. 198-206) vergleichsweise ziemlich kurz. Um
so ausführlicher ist in 37 Seiten verschiedener Register das verarbeitete Textgut auf-
gegliedert. F. X. Herrmann
Elmar Kornexl: Begriff und Einschätzung der Gesundheit des Körpers in der griechi-
schen Literatur von ihren Anfängen bis zum Hellenismus. Commentationes Aenipon-
tanae XXI. Universitätsverlag Wagner. Innsbruck. 1970. 153 S. Kart. ö. S. 258.
Der Verfasser verwendet in seiner überarbeiteten Dissertation zuerst 15 Seiten auf die
Sammlung der griechischen Begriffe für die Gesundheit des Körpers. Dann stellt er mit
Quellenzitaten dar, wie die Dichter und Philosophen der Reihe nach die Gesundheit
bewerteten; umfangmäßig hat „die Zeit der Aufklärung und philosophischen Ethik“ den
Akzent erhalten. Man wird Kornexl zustimmen können, wenn er sagt, daß Xenophon
noch stark in älteren Glücksidealen verankert sei. Dagegen erscheint es zu undifferen-
ziert, wenn er S. 88 behauptet: „Auf dem Gebiet der Erziehung hat sich Isokrates da-
mit ganz eng an die von Platon gutgeheißene traditionelle Erziehung angelehnt.“ Un-
terschieden wird zwischen einer frühen, mittleren und späten Periode Platons: während
beim Platon der Frühdialoge eine hedonistische Auffassung vom Leben des Menschen
nicht ganz zu übersehen sei, erhielten in der orphisch-pythagoreisch beeinflußten Reife-
zeit die Güter ihren Wert nur aus der richtigen Leitung durch die Phronesis; die Spät-
zeit biete in den Gesetzen und im 8. Brief Zeugnisse der Güterrangordnung: 1. die
Seele, 2. der Körper, und hier Gesundheit an erster Stelle vor Schönheit und Kraft,
3. die äußeren Güter. Die Ausführungen über Aristoteles legen die Entwicklungsauf-
fassung Werner Jaegers zugrunde.
Die Untersuchung ist durch Zusammenfassungen zu den Abschnitten recht klar und
in verständlicher, etwas breiter Diktion gehalten. F. X. Herrmann
Hannes Weikert: Begegnung mit Kunstwerken. München 1971. Oldenbourg-Verlag.
208 S. - 48 Tafeln. 24,80 DM.
Der altsprachliche Unterricht ist - das haben manche Bildungstheoretiker anschei-
nend (noch?) nicht begriffen - weitgehend ein musischer Unterricht, und zwar sowohl in
seinem Umgang mit antiken literarischen Kunstwerken wie in seinem Bezug zur bilden-
den Kunst der Antike. Es ist wohl selbstverständlich, daß im altsprachlichen Unterricht
aller Stufen immer wieder der Weg zu Werken der bildenden Kunst gesucht und gegan-
gen wird. Zeugnis solcher Bemühung sind u. a. Knokes Beitrag über römische Kunst im
Unterricht in der Methodik von Ahrens oder Heft 2 der Reihe VIII des AU, natürlich
auch die Bilder in Übungswerken. Weikert weiß von diesen Bemühungen wohl kaum;
erwähnt werden sie jedenfalls nicht, und dabei wäre es höchst wichtig zu wissen, daß
43
Roloff zur 1. Strophe von Pindars 6. nemeischer Ode das zweimalige ev des Anfangs
ev dvÖQtov, ev ffecov yevoq als Ausdruck der Identität, weil eine Gegensätzlichkeit durch
ev uev - ev öe angedeutet sein müßte; cpuaig faßt Roloff nicht wie Schadewaldt als An-
lage auf, sondern als leibliche Kraft. S. 180 ff. gibt eine Erklärung des Xoyoq im
Sinne Heraklits, S. 187 ff. behandelt den Aufbau von Pindars 2. Olympischer Ode.
Den Abschluß bildet der Ausblick auf die platonische Angleichung an Gott, deren
Wurzeln in früheren Anschauungen und deren Besonderes der Verfasser in knappem
Umriß zeichnet. Die Annäherung durch tugendhaftes Leben und durch Erkenntnis
fallen dadurch zusammen, daß das Göttliche nicht mehr bloß das Ziel, sondern zu-
gleich das Vorbild menschlichen Strebens darstellt. Gemessen am Zweck der Unter-
suchung erscheint dieses Schlußkapitel (S. 198-206) vergleichsweise ziemlich kurz. Um
so ausführlicher ist in 37 Seiten verschiedener Register das verarbeitete Textgut auf-
gegliedert. F. X. Herrmann
Elmar Kornexl: Begriff und Einschätzung der Gesundheit des Körpers in der griechi-
schen Literatur von ihren Anfängen bis zum Hellenismus. Commentationes Aenipon-
tanae XXI. Universitätsverlag Wagner. Innsbruck. 1970. 153 S. Kart. ö. S. 258.
Der Verfasser verwendet in seiner überarbeiteten Dissertation zuerst 15 Seiten auf die
Sammlung der griechischen Begriffe für die Gesundheit des Körpers. Dann stellt er mit
Quellenzitaten dar, wie die Dichter und Philosophen der Reihe nach die Gesundheit
bewerteten; umfangmäßig hat „die Zeit der Aufklärung und philosophischen Ethik“ den
Akzent erhalten. Man wird Kornexl zustimmen können, wenn er sagt, daß Xenophon
noch stark in älteren Glücksidealen verankert sei. Dagegen erscheint es zu undifferen-
ziert, wenn er S. 88 behauptet: „Auf dem Gebiet der Erziehung hat sich Isokrates da-
mit ganz eng an die von Platon gutgeheißene traditionelle Erziehung angelehnt.“ Un-
terschieden wird zwischen einer frühen, mittleren und späten Periode Platons: während
beim Platon der Frühdialoge eine hedonistische Auffassung vom Leben des Menschen
nicht ganz zu übersehen sei, erhielten in der orphisch-pythagoreisch beeinflußten Reife-
zeit die Güter ihren Wert nur aus der richtigen Leitung durch die Phronesis; die Spät-
zeit biete in den Gesetzen und im 8. Brief Zeugnisse der Güterrangordnung: 1. die
Seele, 2. der Körper, und hier Gesundheit an erster Stelle vor Schönheit und Kraft,
3. die äußeren Güter. Die Ausführungen über Aristoteles legen die Entwicklungsauf-
fassung Werner Jaegers zugrunde.
Die Untersuchung ist durch Zusammenfassungen zu den Abschnitten recht klar und
in verständlicher, etwas breiter Diktion gehalten. F. X. Herrmann
Hannes Weikert: Begegnung mit Kunstwerken. München 1971. Oldenbourg-Verlag.
208 S. - 48 Tafeln. 24,80 DM.
Der altsprachliche Unterricht ist - das haben manche Bildungstheoretiker anschei-
nend (noch?) nicht begriffen - weitgehend ein musischer Unterricht, und zwar sowohl in
seinem Umgang mit antiken literarischen Kunstwerken wie in seinem Bezug zur bilden-
den Kunst der Antike. Es ist wohl selbstverständlich, daß im altsprachlichen Unterricht
aller Stufen immer wieder der Weg zu Werken der bildenden Kunst gesucht und gegan-
gen wird. Zeugnis solcher Bemühung sind u. a. Knokes Beitrag über römische Kunst im
Unterricht in der Methodik von Ahrens oder Heft 2 der Reihe VIII des AU, natürlich
auch die Bilder in Übungswerken. Weikert weiß von diesen Bemühungen wohl kaum;
erwähnt werden sie jedenfalls nicht, und dabei wäre es höchst wichtig zu wissen, daß
43