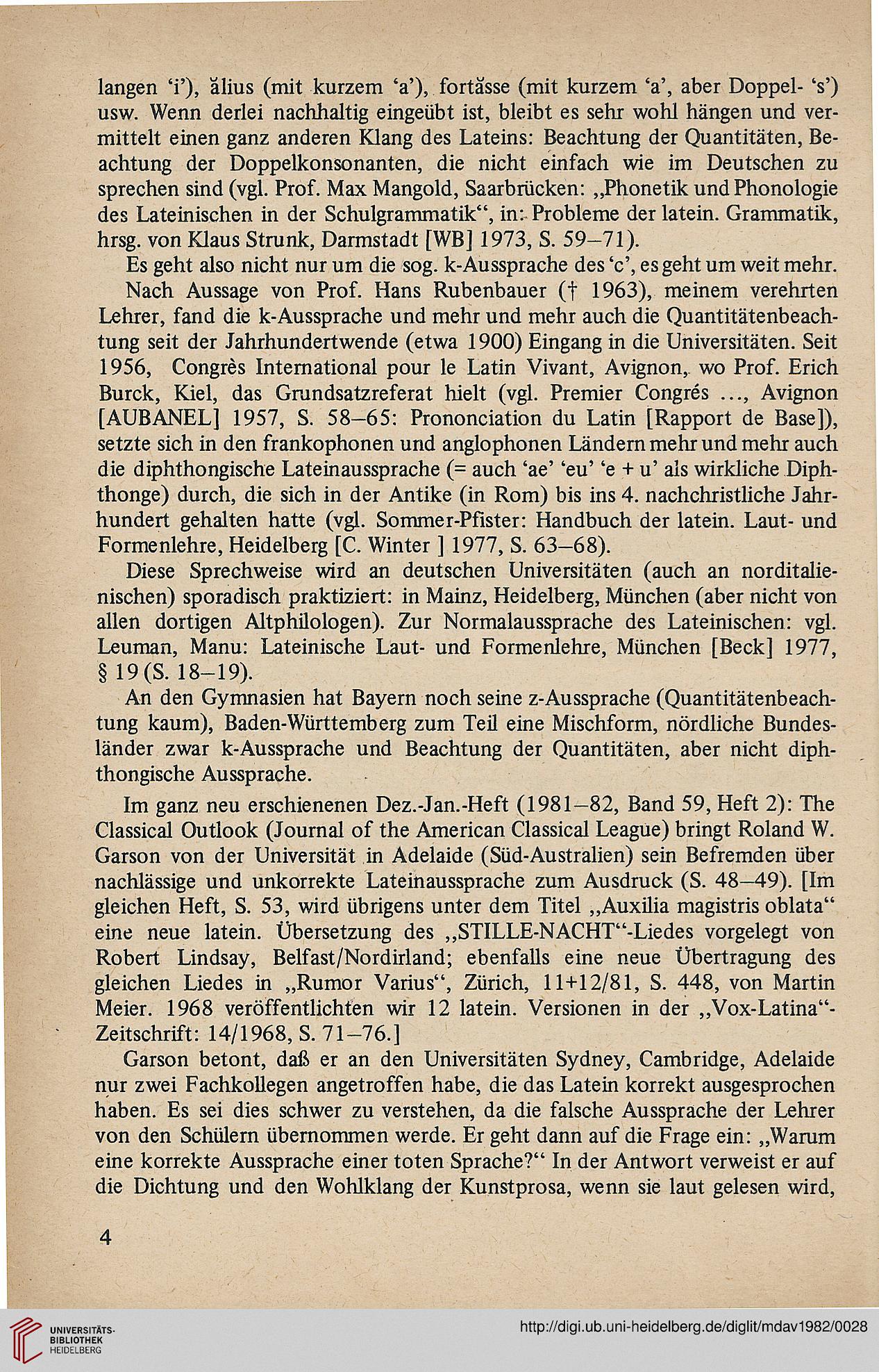langen ‘i’), älius (mit kurzem ‘a’), fortasse (mit kurzem ‘a’, aber Doppel- ‘s’)
usw. Wenn derlei nachhaltig eingeübt ist, bleibt es sehr wohl hängen und ver-
mittelt einen ganz anderen Klang des Lateins: Beachtung der Quantitäten, Be-
achtung der Doppelkonsonanten, die nicht einfach wie im Deutschen zu
sprechen sind (vgl. Prof. Max Mangold, Saarbrücken: „Phonetik und Phonologie
des Lateinischen in der Schulgrammatik“, in: Probleme der latein. Grammatik,
hrsg. von Klaus Strunk, Darmstadt [WB] 1973, S. 59—71).
Es geht also nicht nur um die sog. k-Aussprache des ‘c\ es geht um weit mehr.
Nach Aussage von Prof. Hans Rubenbauer (t 1963), meinem verehrten
Lehrer, fand die k-Aussprache und mehr und mehr auch die Quantitätenbeach-
tung seit der Jahrhundertwende (etwa 1900) Eingang in die Universitäten. Seit
1956, Congres International pour le Latin Vivant, Avignon, wo Prof. Erich
Burck, Kiel, das Grundsatzreferat hielt (vgl. Premier Congres ..., Avignon
[AUBANEL] 1957, S. 58-65: Prononciation du Latin [Rapport de Base]),
setzte sich in den frankophonen und anglophonen Ländern mehr und mehr auch
die diphthongische Lateinaussprache (= auch ‘ae’ ‘eu’ ‘e + u’ als wirkliche Diph-
thonge) durch, die sich in der Antike (in Rom) bis ins 4. nachchristliche Jahr-
hundert gehalten hatte (vgl. Sommer-Pfister: Handbuch der latein. Laut- und
Formenlehre, Heidelberg [C. Winter ] 1977, S. 63-68).
Diese Sprechweise wird an deutschen Universitäten (auch an norditalie-
nischen) sporadisch praktiziert: in Mainz, Heidelberg, München (aber nicht von
allen dortigen Altphilologen). Zur Normalaussprache des Lateinischen: vgl.
Leuman, Manu: Lateinische Laut- und Formenlehre, München [Beck] 1977,
§ 19 (S. 18-19).
An den Gymnasien hat Bayern noch seine z-Aussprache (Quantitätenbeach-
tung kaum), Baden-Württemberg zum Teil eine Mischform, nördliche Bundes-
länder zwar k-Aussprache und Beachtung der Quantitäten, aber nicht diph-
thongische Aussprache.
Im ganz neu erschienenen Dez.-Jan.-Heft (1981—82, Band 59, Heft 2): The
Classical Outlook (Journal of the American Classical League) bringt Roland W.
Garson von der Universität in Adelaide (Süd-Australien) sein Befremden über
nachlässige und unkorrekte Lateinaussprache zum Ausdruck (S. 48—49). [Im
gleichen Heft, S. 53, wird übrigens unter dem Titel „Auxilia magistris oblata“
eine neue latein. Übersetzung des „STILLE-NACHT“-Liedes vorgelegt von
Robert Lindsay, Belfast/Nordirland; ebenfalls eine neue Übertragung des
gleichen Liedes in „Rumor Varius“, Zürich, 11+12/81, S. 448, von Martin
Meier. 1968 veröffentlichten wir 12 latein. Versionen in der „Vox-Latina“-
Zeitschrift: 14/1968, S. 71-76.]
Garson betont, daß er an den Universitäten Sydney, Cambridge, Adelaide
nur zwei Fachkollegen angetroffen habe, die das Latein korrekt ausgesprochen
haben. Es sei dies schwer zu verstehen, da die falsche Aussprache der Lehrer
von den Schülern übernommen werde. Er geht dann auf die Frage ein: „Warum
eine korrekte Aussprache einer toten Sprache?“ In der Antwort verweist er auf
die Dichtung und den Wohlklang der Kunstprosa, wenn sie laut gelesen wird,
4
usw. Wenn derlei nachhaltig eingeübt ist, bleibt es sehr wohl hängen und ver-
mittelt einen ganz anderen Klang des Lateins: Beachtung der Quantitäten, Be-
achtung der Doppelkonsonanten, die nicht einfach wie im Deutschen zu
sprechen sind (vgl. Prof. Max Mangold, Saarbrücken: „Phonetik und Phonologie
des Lateinischen in der Schulgrammatik“, in: Probleme der latein. Grammatik,
hrsg. von Klaus Strunk, Darmstadt [WB] 1973, S. 59—71).
Es geht also nicht nur um die sog. k-Aussprache des ‘c\ es geht um weit mehr.
Nach Aussage von Prof. Hans Rubenbauer (t 1963), meinem verehrten
Lehrer, fand die k-Aussprache und mehr und mehr auch die Quantitätenbeach-
tung seit der Jahrhundertwende (etwa 1900) Eingang in die Universitäten. Seit
1956, Congres International pour le Latin Vivant, Avignon, wo Prof. Erich
Burck, Kiel, das Grundsatzreferat hielt (vgl. Premier Congres ..., Avignon
[AUBANEL] 1957, S. 58-65: Prononciation du Latin [Rapport de Base]),
setzte sich in den frankophonen und anglophonen Ländern mehr und mehr auch
die diphthongische Lateinaussprache (= auch ‘ae’ ‘eu’ ‘e + u’ als wirkliche Diph-
thonge) durch, die sich in der Antike (in Rom) bis ins 4. nachchristliche Jahr-
hundert gehalten hatte (vgl. Sommer-Pfister: Handbuch der latein. Laut- und
Formenlehre, Heidelberg [C. Winter ] 1977, S. 63-68).
Diese Sprechweise wird an deutschen Universitäten (auch an norditalie-
nischen) sporadisch praktiziert: in Mainz, Heidelberg, München (aber nicht von
allen dortigen Altphilologen). Zur Normalaussprache des Lateinischen: vgl.
Leuman, Manu: Lateinische Laut- und Formenlehre, München [Beck] 1977,
§ 19 (S. 18-19).
An den Gymnasien hat Bayern noch seine z-Aussprache (Quantitätenbeach-
tung kaum), Baden-Württemberg zum Teil eine Mischform, nördliche Bundes-
länder zwar k-Aussprache und Beachtung der Quantitäten, aber nicht diph-
thongische Aussprache.
Im ganz neu erschienenen Dez.-Jan.-Heft (1981—82, Band 59, Heft 2): The
Classical Outlook (Journal of the American Classical League) bringt Roland W.
Garson von der Universität in Adelaide (Süd-Australien) sein Befremden über
nachlässige und unkorrekte Lateinaussprache zum Ausdruck (S. 48—49). [Im
gleichen Heft, S. 53, wird übrigens unter dem Titel „Auxilia magistris oblata“
eine neue latein. Übersetzung des „STILLE-NACHT“-Liedes vorgelegt von
Robert Lindsay, Belfast/Nordirland; ebenfalls eine neue Übertragung des
gleichen Liedes in „Rumor Varius“, Zürich, 11+12/81, S. 448, von Martin
Meier. 1968 veröffentlichten wir 12 latein. Versionen in der „Vox-Latina“-
Zeitschrift: 14/1968, S. 71-76.]
Garson betont, daß er an den Universitäten Sydney, Cambridge, Adelaide
nur zwei Fachkollegen angetroffen habe, die das Latein korrekt ausgesprochen
haben. Es sei dies schwer zu verstehen, da die falsche Aussprache der Lehrer
von den Schülern übernommen werde. Er geht dann auf die Frage ein: „Warum
eine korrekte Aussprache einer toten Sprache?“ In der Antwort verweist er auf
die Dichtung und den Wohlklang der Kunstprosa, wenn sie laut gelesen wird,
4