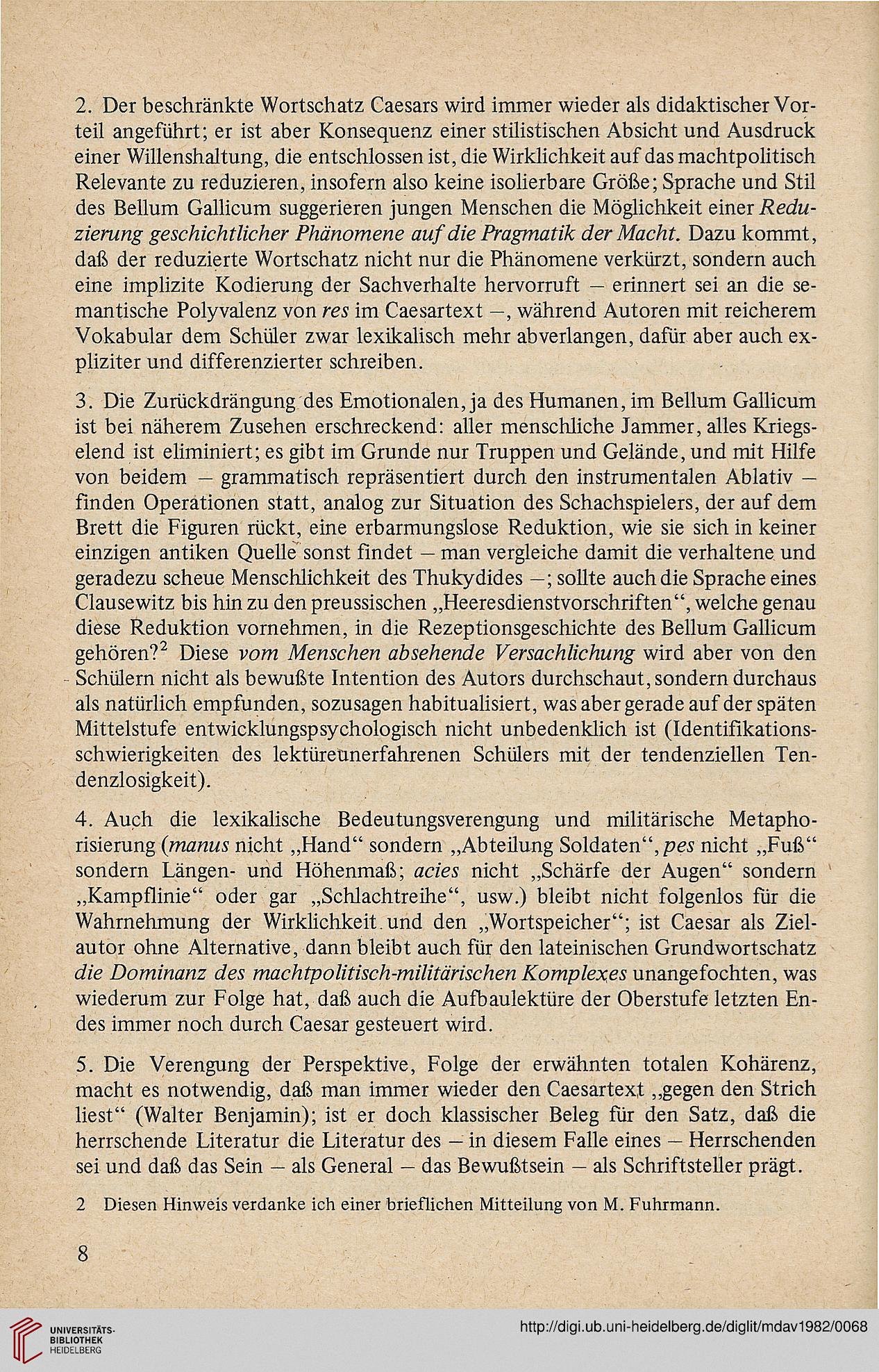2. Der beschränkte Wortschatz Caesars wird immer wieder als didaktischer Vor-
teil angeführt; er ist aber Konsequenz einer stilistischen Absicht und Ausdruck
einer Willenshaltung, die entschlossen ist, die Wirklichkeit auf das machtpolitisch
Relevante zu reduzieren, insofern also keine isolierbare Größe; Sprache und Stil
des Bellum Gallicum suggerieren jungen Menschen die Möglichkeit einer Redu-
zierung geschichtlicher Phänomene auf die Pragmatik der Macht. Dazu kommt,
daß der reduzierte Wortschatz nicht nur die Phänomene verkürzt, sondern auch
eine implizite Kodierung der Sachverhalte hervorruft — erinnert sei an die se-
mantische Polyvalenz von res im Caesartext —, während Autoren mit reicherem
Vokabular dem Schüler zwar lexikalisch mehr abverlangen, dafür aber auch ex-
pliziter und differenzierter schreiben.
3. Die Zurückdrängung des Emotionalen, ja des Humanen, im Bellum Gallicum
ist bei näherem Zusehen erschreckend: aller menschliche Jammer, alles Kriegs-
elend ist eliminiert; es gibt im Grunde nur Truppen und Gelände, und mit Hilfe
von beidem — grammatisch repräsentiert durch den instrumentalen Ablativ —
finden Operationen statt, analog zur Situation des Schachspielers, der auf dem
Brett die Figuren rückt, eine erbarmungslose Reduktion, wie sie sich in keiner
einzigen antiken Quelle sonst findet — man vergleiche damit die verhaltene und
geradezu scheue Menschlichkeit des Thukydides —; sollte auch die Sprache eines
Clausewitz bis hin zu den preussischen „Heeresdienstvorschriften“, welche genau
diese Reduktion vornehmen, in die Rezeptionsgeschichte des Bellum Gallicum
gehören?2 Diese vom Menschen absehende Versachlichung wird aber von den
Schülern nicht als bewußte Intention des Autors durchschaut, sondern durchaus
als natürlich empfunden, sozusagen habitualisiert, was aber gerade auf der späten
Mittelstufe entwicklungspsychologisch nicht unbedenklich ist (Identifikations-
schwierigkeiten des lektüreunerfahrenen Schülers mit der tendenziellen Ten-
denzlosigkeit).
4. Auch die lexikalische Bedeutungsverengung und militärische Metapho-
risierung (manus nicht „Hand“ sondern „Abteilung Soldaten“, pes nicht „Fuß“
sondern Längen- und Höhenmaß; acies nicht „Schärfe der Augen“ sondern
„Kampflinie“ oder gar „Schlachtreihe“, usw.) bleibt nicht folgenlos für die
Wahrnehmung der Wirklichkeit. und den „Wortspeicher“; ist Caesar als Ziel-
autor ohne Alternative, dann bleibt auch für den lateinischen Grundwortschatz
die Dominanz des machtpolitisch-militärischen Komplexes unangefochten, was
wiederum zur Folge hat, daß auch die Aufbaulektüre der Oberstufe letzten En-
des immer noch durch Caesar gesteuert wird.
5. Die Verengung der Perspektive, Folge der erwähnten totalen Kohärenz,
macht es notwendig, daß man immer wieder den Caesartext „gegen den Strich
liest“ (Walter Benjamin); ist er doch klassischer Beleg für den Satz, daß die
herrschende Literatur die Literatur des — in diesem Falle eines — Herrschenden
sei und daß das Sein — als General — das Bewußtsein — als Schriftsteller prägt.
2 Diesen Hinweis verdanke ich einer brieflichen Mitteilung von M. Fuhrmann.
8
teil angeführt; er ist aber Konsequenz einer stilistischen Absicht und Ausdruck
einer Willenshaltung, die entschlossen ist, die Wirklichkeit auf das machtpolitisch
Relevante zu reduzieren, insofern also keine isolierbare Größe; Sprache und Stil
des Bellum Gallicum suggerieren jungen Menschen die Möglichkeit einer Redu-
zierung geschichtlicher Phänomene auf die Pragmatik der Macht. Dazu kommt,
daß der reduzierte Wortschatz nicht nur die Phänomene verkürzt, sondern auch
eine implizite Kodierung der Sachverhalte hervorruft — erinnert sei an die se-
mantische Polyvalenz von res im Caesartext —, während Autoren mit reicherem
Vokabular dem Schüler zwar lexikalisch mehr abverlangen, dafür aber auch ex-
pliziter und differenzierter schreiben.
3. Die Zurückdrängung des Emotionalen, ja des Humanen, im Bellum Gallicum
ist bei näherem Zusehen erschreckend: aller menschliche Jammer, alles Kriegs-
elend ist eliminiert; es gibt im Grunde nur Truppen und Gelände, und mit Hilfe
von beidem — grammatisch repräsentiert durch den instrumentalen Ablativ —
finden Operationen statt, analog zur Situation des Schachspielers, der auf dem
Brett die Figuren rückt, eine erbarmungslose Reduktion, wie sie sich in keiner
einzigen antiken Quelle sonst findet — man vergleiche damit die verhaltene und
geradezu scheue Menschlichkeit des Thukydides —; sollte auch die Sprache eines
Clausewitz bis hin zu den preussischen „Heeresdienstvorschriften“, welche genau
diese Reduktion vornehmen, in die Rezeptionsgeschichte des Bellum Gallicum
gehören?2 Diese vom Menschen absehende Versachlichung wird aber von den
Schülern nicht als bewußte Intention des Autors durchschaut, sondern durchaus
als natürlich empfunden, sozusagen habitualisiert, was aber gerade auf der späten
Mittelstufe entwicklungspsychologisch nicht unbedenklich ist (Identifikations-
schwierigkeiten des lektüreunerfahrenen Schülers mit der tendenziellen Ten-
denzlosigkeit).
4. Auch die lexikalische Bedeutungsverengung und militärische Metapho-
risierung (manus nicht „Hand“ sondern „Abteilung Soldaten“, pes nicht „Fuß“
sondern Längen- und Höhenmaß; acies nicht „Schärfe der Augen“ sondern
„Kampflinie“ oder gar „Schlachtreihe“, usw.) bleibt nicht folgenlos für die
Wahrnehmung der Wirklichkeit. und den „Wortspeicher“; ist Caesar als Ziel-
autor ohne Alternative, dann bleibt auch für den lateinischen Grundwortschatz
die Dominanz des machtpolitisch-militärischen Komplexes unangefochten, was
wiederum zur Folge hat, daß auch die Aufbaulektüre der Oberstufe letzten En-
des immer noch durch Caesar gesteuert wird.
5. Die Verengung der Perspektive, Folge der erwähnten totalen Kohärenz,
macht es notwendig, daß man immer wieder den Caesartext „gegen den Strich
liest“ (Walter Benjamin); ist er doch klassischer Beleg für den Satz, daß die
herrschende Literatur die Literatur des — in diesem Falle eines — Herrschenden
sei und daß das Sein — als General — das Bewußtsein — als Schriftsteller prägt.
2 Diesen Hinweis verdanke ich einer brieflichen Mitteilung von M. Fuhrmann.
8