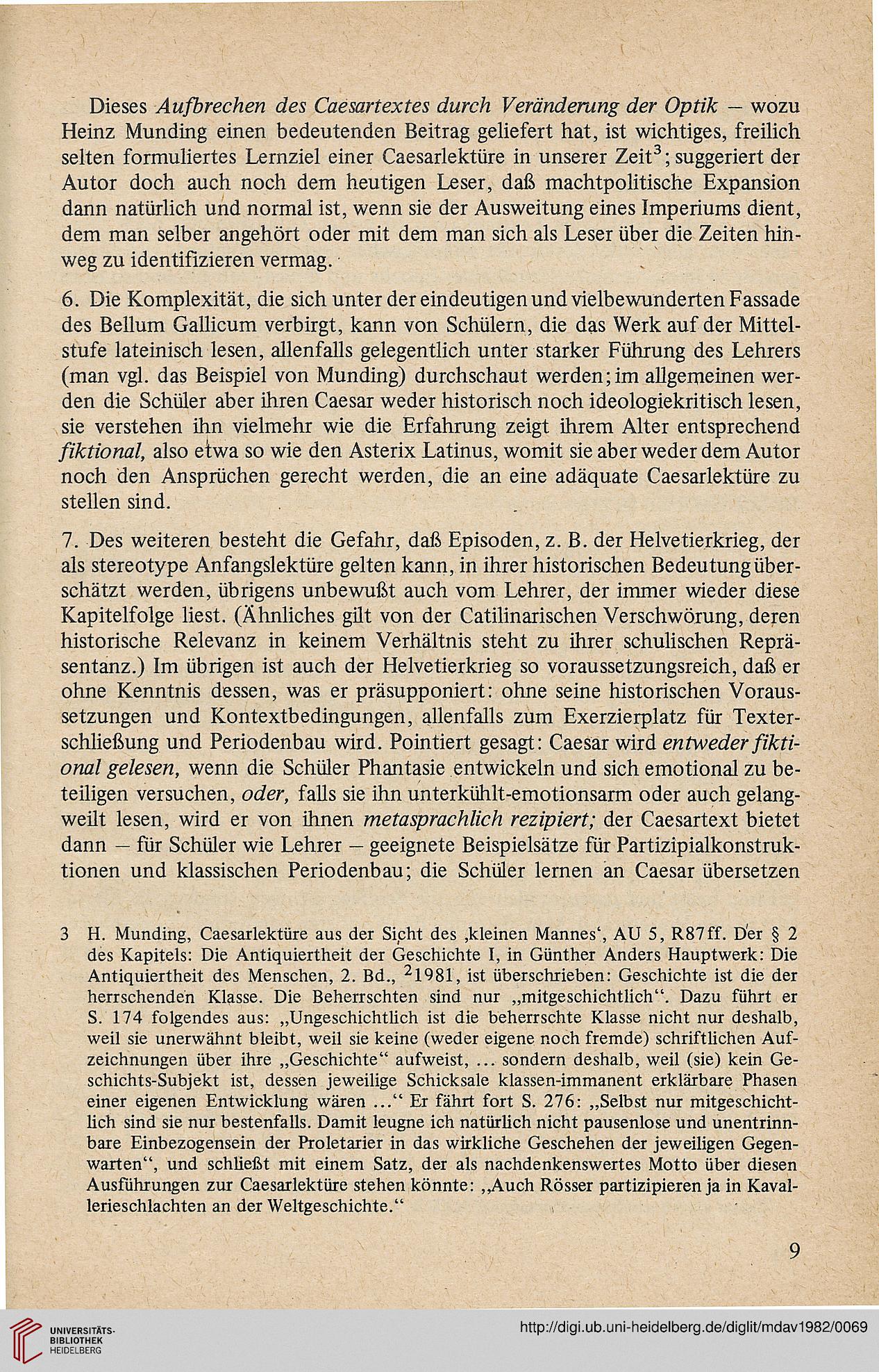Dieses Aufbrechen des Caesartextes durch Veränderung der Optik — wozu
Heinz Munding einen bedeutenden Beitrag geliefert hat, ist wichtiges, freilich
selten formuliertes Lernziel einer Caesarlektüre in unserer Zeit3; suggeriert der
Autor doch auch noch dem heutigen Leser, daß machtpolitische Expansion
dann natürlich und normal ist, wenn sie der Ausweitung eines Imperiums dient,
dem man selber angehört oder mit dem man sich als Leser über die Zeiten hin-
weg zu identifizieren vermag.
6. Die Komplexität, die sich unter der eindeutigen und vielbewunderten Fassade
des Bellum Gallicum verbirgt, kann von Schülern, die das Werk auf der Mittel-
stufe lateinisch lesen, allenfalls gelegentlich unter starker Führung des Lehrers
(man vgl. das Beispiel von Munding) durchschaut werden;im allgemeinen wer-
den die Schüler aber ihren Caesar weder historisch noch ideologiekritisch lesen,
sie verstehen ihn vielmehr wie die Erfahrung zeigt ihrem Alter entsprechend
fiktional, also etwa so wie den Asterix Latinus, womit sie aber weder dem Autor
noch den Ansprüchen gerecht werden, die an eine adäquate Caesarlektüre zu
stellen sind.
7. Des weiteren besteht die Gefahr, daß Episoden, z. B. der Helvetierkrieg, der
als stereotype Anfangslektüre gelten kann, in ihrer historischen Bedeutung über-
schätzt werden, übrigens unbewußt auch vom Lehrer, der immer wieder diese
Kapitelfolge liest. (Ähnliches gilt von der Catilinarischen Verschwörung, deren
historische Relevanz in keinem Verhältnis steht zu ihrer schulischen Reprä-
sentanz.) Im übrigen ist auch der Helvetierkrieg so voraussetzungsreich, daß er
ohne Kenntnis dessen, was er präsupponiert: ohne seine historischen Voraus-
setzungen und Kontextbedingungen, allenfalls zum Exerzierplatz für Texter-
schließung und Periodenbau wird. Pointiert gesagt: Caesar wird entweder fikti-
onal gelesen, wenn die Schüler Phantasie entwickeln und sich emotional zu be-
teiligen versuchen, oder, falls sie ihn unterkühlt-emotionsarm oder auch gelang-
weilt lesen, wird er von ihnen metasprachlich rezipiert; der Caesartext bietet
dann — für Schüler wie Lehrer — geeignete Beispielsätze für Partizipialkonstruk-
tionen und klassischen Periodenbau; die Schüler lernen an Caesar übersetzen
3 H. Munding, Caesarlektüre aus der Sicht des kleinen Mannes1, AU 5, R87ff. Der § 2
des Kapitels: Die Antiquiertheit der Geschichte I, in Günther Anders Hauptwerk: Die
Antiquiertheit des Menschen, 2. Bd., 21981, ist überschrieben: Geschichte ist die der
herrschenden Klasse. Die Beherrschten sind nur „mitgeschichtlich“. Dazu führt er
S. 174 folgendes aus: „Ungeschichtlich ist die beherrschte Klasse nicht nur deshalb,
weil sie unerwähnt bleibt, weil sie keine (weder eigene noch fremde) schriftlichen Auf-
zeichnungen über ihre „Geschichte“ aufweist, ... sondern deshalb, weil (sie) kein Ge-
schichts-Subjekt ist, dessen jeweilige Schicksale klassen-immanent erklärbare Phasen
einer eigenen Entwicklung wären ...“ Er fährt fort S. 276: „Selbst nur mitgeschicht-
lich sind sie nur bestenfalls. Damit leugne ich natürlich nicht pausenlose und unentrinn-
bare Einbezogensein der Proletarier in das wirkliche Geschehen der jeweiligen Gegen-
warten“, und schließt mit einem Satz, der als nachdenkenswertes Motto über diesen
Ausführungen zur Caesarlektüre stehen könnte: „Auch Rösser partizipieren ja in Kaval-
lerieschlachten an der Weltgeschichte.“
9
Heinz Munding einen bedeutenden Beitrag geliefert hat, ist wichtiges, freilich
selten formuliertes Lernziel einer Caesarlektüre in unserer Zeit3; suggeriert der
Autor doch auch noch dem heutigen Leser, daß machtpolitische Expansion
dann natürlich und normal ist, wenn sie der Ausweitung eines Imperiums dient,
dem man selber angehört oder mit dem man sich als Leser über die Zeiten hin-
weg zu identifizieren vermag.
6. Die Komplexität, die sich unter der eindeutigen und vielbewunderten Fassade
des Bellum Gallicum verbirgt, kann von Schülern, die das Werk auf der Mittel-
stufe lateinisch lesen, allenfalls gelegentlich unter starker Führung des Lehrers
(man vgl. das Beispiel von Munding) durchschaut werden;im allgemeinen wer-
den die Schüler aber ihren Caesar weder historisch noch ideologiekritisch lesen,
sie verstehen ihn vielmehr wie die Erfahrung zeigt ihrem Alter entsprechend
fiktional, also etwa so wie den Asterix Latinus, womit sie aber weder dem Autor
noch den Ansprüchen gerecht werden, die an eine adäquate Caesarlektüre zu
stellen sind.
7. Des weiteren besteht die Gefahr, daß Episoden, z. B. der Helvetierkrieg, der
als stereotype Anfangslektüre gelten kann, in ihrer historischen Bedeutung über-
schätzt werden, übrigens unbewußt auch vom Lehrer, der immer wieder diese
Kapitelfolge liest. (Ähnliches gilt von der Catilinarischen Verschwörung, deren
historische Relevanz in keinem Verhältnis steht zu ihrer schulischen Reprä-
sentanz.) Im übrigen ist auch der Helvetierkrieg so voraussetzungsreich, daß er
ohne Kenntnis dessen, was er präsupponiert: ohne seine historischen Voraus-
setzungen und Kontextbedingungen, allenfalls zum Exerzierplatz für Texter-
schließung und Periodenbau wird. Pointiert gesagt: Caesar wird entweder fikti-
onal gelesen, wenn die Schüler Phantasie entwickeln und sich emotional zu be-
teiligen versuchen, oder, falls sie ihn unterkühlt-emotionsarm oder auch gelang-
weilt lesen, wird er von ihnen metasprachlich rezipiert; der Caesartext bietet
dann — für Schüler wie Lehrer — geeignete Beispielsätze für Partizipialkonstruk-
tionen und klassischen Periodenbau; die Schüler lernen an Caesar übersetzen
3 H. Munding, Caesarlektüre aus der Sicht des kleinen Mannes1, AU 5, R87ff. Der § 2
des Kapitels: Die Antiquiertheit der Geschichte I, in Günther Anders Hauptwerk: Die
Antiquiertheit des Menschen, 2. Bd., 21981, ist überschrieben: Geschichte ist die der
herrschenden Klasse. Die Beherrschten sind nur „mitgeschichtlich“. Dazu führt er
S. 174 folgendes aus: „Ungeschichtlich ist die beherrschte Klasse nicht nur deshalb,
weil sie unerwähnt bleibt, weil sie keine (weder eigene noch fremde) schriftlichen Auf-
zeichnungen über ihre „Geschichte“ aufweist, ... sondern deshalb, weil (sie) kein Ge-
schichts-Subjekt ist, dessen jeweilige Schicksale klassen-immanent erklärbare Phasen
einer eigenen Entwicklung wären ...“ Er fährt fort S. 276: „Selbst nur mitgeschicht-
lich sind sie nur bestenfalls. Damit leugne ich natürlich nicht pausenlose und unentrinn-
bare Einbezogensein der Proletarier in das wirkliche Geschehen der jeweiligen Gegen-
warten“, und schließt mit einem Satz, der als nachdenkenswertes Motto über diesen
Ausführungen zur Caesarlektüre stehen könnte: „Auch Rösser partizipieren ja in Kaval-
lerieschlachten an der Weltgeschichte.“
9