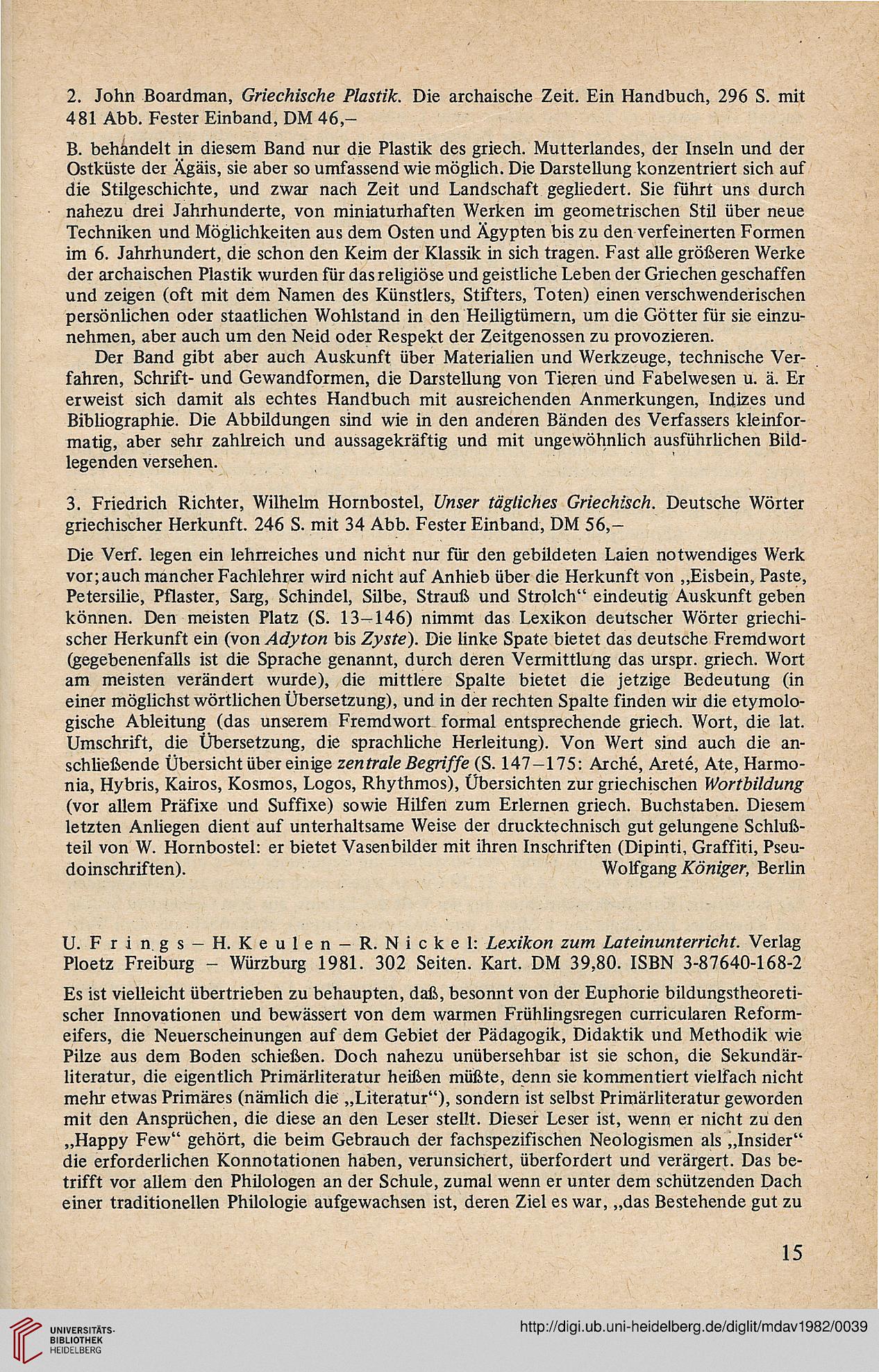2. John Boardman, Griechische Plastik. Die archaische Zeit. Ein Handbuch, 296 S. mit
481 Abb. Fester Einband, DM 46,—
B. behandelt in diesem Band nur die Plastik des griech. Mutterlandes, der Inseln und der
Ostküste der Ägäis, sie aber so umfassend wie möglich. Die Darstellung konzentriert sich auf
die Stilgeschichte, und zwar nach Zeit und Landschaft gegliedert. Sie führt uns durch
nahezu drei Jahrhunderte, von miniaturhaften Werken im geometrischen Stil über neue
Techniken und Möglichkeiten aus dem Osten und Ägypten bis zu den verfeinerten Formen
im 6. Jahrhundert, die schon den Keim der Klassik in sich tragen. Fast alle größeren Werke
der archaischen Plastik wurden für das religiöse und geistliche Leben der Griechen geschaffen
und zeigen (oft mit dem Namen des Künstlers, Stifters, Toten) einen verschwenderischen
persönlichen oder staatlichen Wohlstand in den Heiligtümern, um die Götter für sie einzu-
nehmen, aber auch um den Neid oder Respekt der Zeitgenossen zu provozieren.
Der Band gibt aber auch Auskunft über Materialien und Werkzeuge, technische Ver-
fahren, Schrift- und Gewandformen, die Darstellung von Tieren und Fabelwesen u. ä. Er
erweist sich damit als echtes Handbuch mit ausreichenden Anmerkungen, Indizes und
Bibliographie. Die Abbildungen sind wie in den anderen Bänden des Verfassers kleinfor-
matig, aber sehr zahlreich und aussagekräftig und mit ungewöhnlich ausführlichen Bild-
legenden versehen.
3. Friedrich Richter, Wilhelm Hornbostel, Unser tägliches Griechisch. Deutsche Wörter
griechischer Herkunft. 246 S. mit 34 Abb. Fester Einband, DM 56,-
Die Verf. legen ein lehrreiches und nicht nur für den gebildeten Laien notwendiges Werk
vor jauch mancher Fachlehrer wird nicht auf Anhieb über die Herkunft von „Eisbein, Paste,
Petersilie, Pflaster, Sarg, Schindel, Silbe, Strauß und Strolch“ eindeutig Auskunft geben
können. Den meisten Platz (S. 13-146) nimmt das Lexikon deutscher Wörter griechi-
scher Herkunft ein (von Adyton bis Zyste). Die linke Spate bietet das deutsche Fremdwort
(gegebenenfalls ist die Sprache genannt, durch deren Vermittlung das urspr. griech. Wort
am meisten verändert wurde), die mittlere Spalte bietet die jetzige Bedeutung (in
einer möglichst wörtlichen Übersetzung), und in der rechten Spalte finden wir die etymolo-
gische Ableitung (das unserem Fremdwort formal entsprechende griech. Wort, die lat.
Umschrift, die Übersetzung, die sprachliche Herleitung). Von Wert sind auch die an-
schließende Übersicht über einige zentrale Begriffe (S. 147-175: Arche, Arete, Ate, Harmo-
nia, Hybris, Kairos, Kosmos, Logos, Rhythmos), Übersichten zur griechischen Wortbildung
(vor allem Präfixe und Suffixe) sowie Hilfen zum Erlernen griech. Buchstaben. Diesem
letzten Anliegen dient auf unterhaltsame Weise der drucktechnisch gut gelungene Schluß-
teil von W. Hornbostel: er bietet Vasenbilder mit ihren Inschriften (Dipinti, Graffiti, Pseu-
doinschriften). Wolfgang Königer, Berlin
U. Frings -H. Keulen -R. Nickel: Lexikon zum Lateinunterricht. Verlag
Ploetz Freiburg - Würzburg 1981. 302 Seiten. Kart. DM 39,80. ISBN 3-87640-168-2
Es ist vielleicht übertrieben zu behaupten, daß, besonnt von der Euphorie bildungstheoreti-
scher Innovationen und bewässert von dem warmen Frühlingsregen curricularen Reform-
eifers, die Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Pädagogik, Didaktik und Methodik wie
Pilze aus dem Boden schießen. Doch nahezu unübersehbar ist sie schon, die Sekundär-
literatur, die eigentlich Primärliteratur heißen müßte, denn sie kommentiert vielfach nicht
mehr etwas Primäres (nämlich die „Literatur“), sondern ist selbst Primärliteratur geworden
mit den Ansprüchen, die diese an den Leser stellt. Dieser Leser ist, wenn er nicht zu den
„Happy Few“ gehört, die beim Gebrauch der fachspezifischen Neologismen als „Insider“
die erforderlichen Konnotationen haben, verunsichert, überfordert und verärgert. Das be-
trifft vor allem den Philologen an der Schule, zumal wenn er unter dem schützenden Dach
einer traditionellen Philologie aufgewachsen ist, deren Ziel es war, „das Bestehende gut zu
15
481 Abb. Fester Einband, DM 46,—
B. behandelt in diesem Band nur die Plastik des griech. Mutterlandes, der Inseln und der
Ostküste der Ägäis, sie aber so umfassend wie möglich. Die Darstellung konzentriert sich auf
die Stilgeschichte, und zwar nach Zeit und Landschaft gegliedert. Sie führt uns durch
nahezu drei Jahrhunderte, von miniaturhaften Werken im geometrischen Stil über neue
Techniken und Möglichkeiten aus dem Osten und Ägypten bis zu den verfeinerten Formen
im 6. Jahrhundert, die schon den Keim der Klassik in sich tragen. Fast alle größeren Werke
der archaischen Plastik wurden für das religiöse und geistliche Leben der Griechen geschaffen
und zeigen (oft mit dem Namen des Künstlers, Stifters, Toten) einen verschwenderischen
persönlichen oder staatlichen Wohlstand in den Heiligtümern, um die Götter für sie einzu-
nehmen, aber auch um den Neid oder Respekt der Zeitgenossen zu provozieren.
Der Band gibt aber auch Auskunft über Materialien und Werkzeuge, technische Ver-
fahren, Schrift- und Gewandformen, die Darstellung von Tieren und Fabelwesen u. ä. Er
erweist sich damit als echtes Handbuch mit ausreichenden Anmerkungen, Indizes und
Bibliographie. Die Abbildungen sind wie in den anderen Bänden des Verfassers kleinfor-
matig, aber sehr zahlreich und aussagekräftig und mit ungewöhnlich ausführlichen Bild-
legenden versehen.
3. Friedrich Richter, Wilhelm Hornbostel, Unser tägliches Griechisch. Deutsche Wörter
griechischer Herkunft. 246 S. mit 34 Abb. Fester Einband, DM 56,-
Die Verf. legen ein lehrreiches und nicht nur für den gebildeten Laien notwendiges Werk
vor jauch mancher Fachlehrer wird nicht auf Anhieb über die Herkunft von „Eisbein, Paste,
Petersilie, Pflaster, Sarg, Schindel, Silbe, Strauß und Strolch“ eindeutig Auskunft geben
können. Den meisten Platz (S. 13-146) nimmt das Lexikon deutscher Wörter griechi-
scher Herkunft ein (von Adyton bis Zyste). Die linke Spate bietet das deutsche Fremdwort
(gegebenenfalls ist die Sprache genannt, durch deren Vermittlung das urspr. griech. Wort
am meisten verändert wurde), die mittlere Spalte bietet die jetzige Bedeutung (in
einer möglichst wörtlichen Übersetzung), und in der rechten Spalte finden wir die etymolo-
gische Ableitung (das unserem Fremdwort formal entsprechende griech. Wort, die lat.
Umschrift, die Übersetzung, die sprachliche Herleitung). Von Wert sind auch die an-
schließende Übersicht über einige zentrale Begriffe (S. 147-175: Arche, Arete, Ate, Harmo-
nia, Hybris, Kairos, Kosmos, Logos, Rhythmos), Übersichten zur griechischen Wortbildung
(vor allem Präfixe und Suffixe) sowie Hilfen zum Erlernen griech. Buchstaben. Diesem
letzten Anliegen dient auf unterhaltsame Weise der drucktechnisch gut gelungene Schluß-
teil von W. Hornbostel: er bietet Vasenbilder mit ihren Inschriften (Dipinti, Graffiti, Pseu-
doinschriften). Wolfgang Königer, Berlin
U. Frings -H. Keulen -R. Nickel: Lexikon zum Lateinunterricht. Verlag
Ploetz Freiburg - Würzburg 1981. 302 Seiten. Kart. DM 39,80. ISBN 3-87640-168-2
Es ist vielleicht übertrieben zu behaupten, daß, besonnt von der Euphorie bildungstheoreti-
scher Innovationen und bewässert von dem warmen Frühlingsregen curricularen Reform-
eifers, die Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Pädagogik, Didaktik und Methodik wie
Pilze aus dem Boden schießen. Doch nahezu unübersehbar ist sie schon, die Sekundär-
literatur, die eigentlich Primärliteratur heißen müßte, denn sie kommentiert vielfach nicht
mehr etwas Primäres (nämlich die „Literatur“), sondern ist selbst Primärliteratur geworden
mit den Ansprüchen, die diese an den Leser stellt. Dieser Leser ist, wenn er nicht zu den
„Happy Few“ gehört, die beim Gebrauch der fachspezifischen Neologismen als „Insider“
die erforderlichen Konnotationen haben, verunsichert, überfordert und verärgert. Das be-
trifft vor allem den Philologen an der Schule, zumal wenn er unter dem schützenden Dach
einer traditionellen Philologie aufgewachsen ist, deren Ziel es war, „das Bestehende gut zu
15