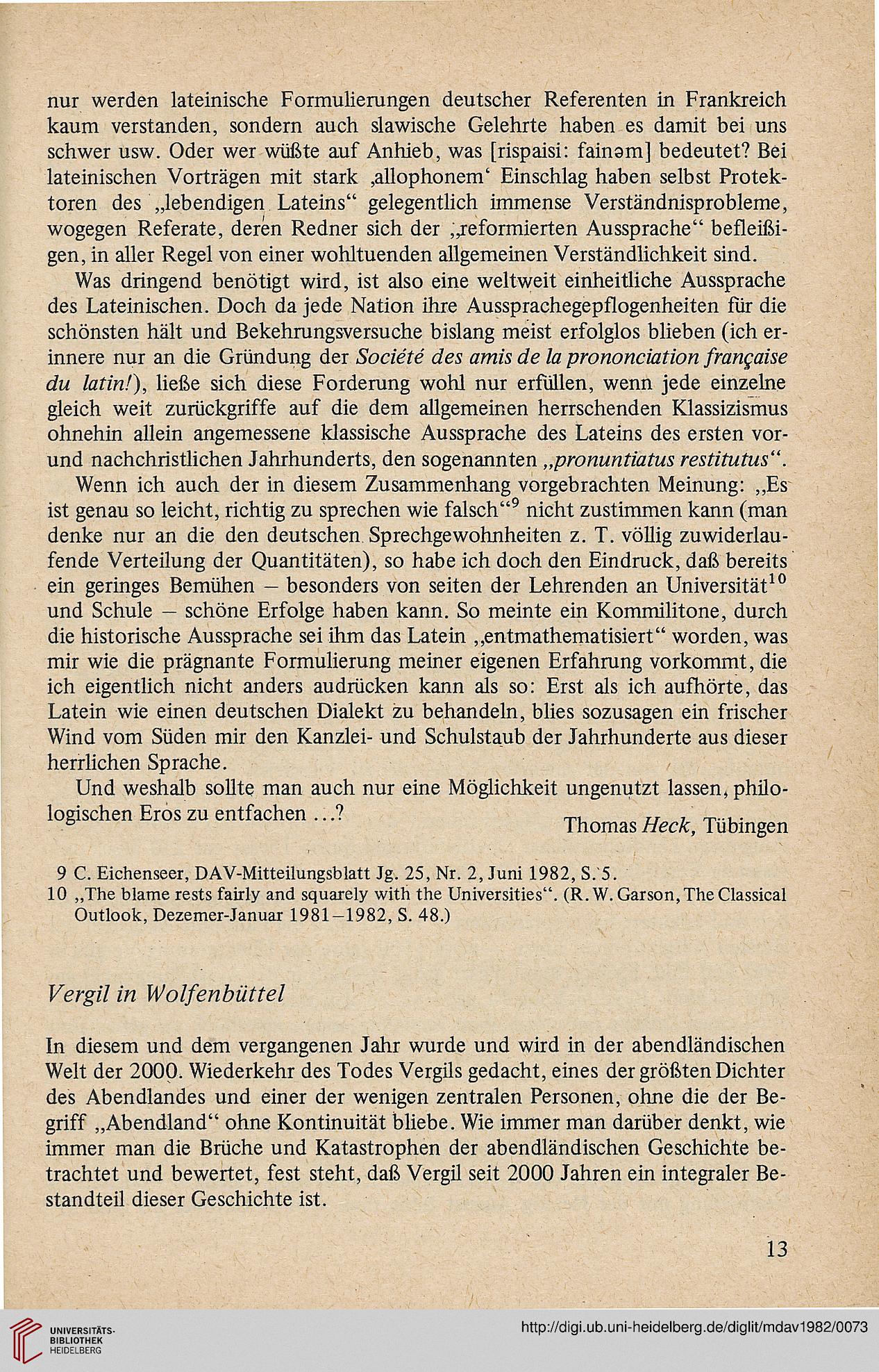nur werden lateinische Formulierungen deutscher Referenten in Frankreich
kaum verstanden, sondern auch slawische Gelehrte haben es damit bei uns
schwer usw. Oder wer wüßte auf Anhieb, was [rispaisi: fainam] bedeutet? Bei
lateinischen Vorträgen mit stark ,allophonem‘ Einschlag haben selbst Protek-
toren des „lebendigen Lateins“ gelegentlich immense Verständnisprobleme,
wogegen Referate, deren Redner sich der „reformierten Aussprache“ befleißi-
gen, in aller Regel von einer wohltuenden allgemeinen Verständlichkeit sind.
Was dringend benötigt wird, ist also eine weltweit einheitliche Aussprache
des Lateinischen. Doch da jede Nation ihre Aussprachegepflogenheiten für die
schönsten hält und Bekehrungsversuche bislang meist erfolglos blieben (ich er-
innere nur an die Gründung der Societe des amis de la pronunciation frangaise
du latin!), ließe sich diese Forderung wohl nur erfüllen, wenn jede einzelne
gleich weit zurückgriffe auf die dem allgemeinen herrschenden Klassizismus
ohnehin allein angemessene klassische Aussprache des Lateins des ersten vor-
und nachchristlichen Jahrhunderts, den sogenannten „pronuntiatus restitutus“.
Wenn ich auch der in diesem Zusammenhang vorgebrachten Meinung: „Es
ist genau so leicht, richtig zu sprechen wie falsch“9 nicht zustimmen kann (man
denke nur an die den deutschen Sprechgewohnheiten z. T. völlig zuwiderlau-
fende Verteilung der Quantitäten), so habe ich doch den Eindruck, daß bereits
ein geringes Bemühen — besonders von seiten der Lehrenden an Universität10
und Schule — schöne Erfolge haben kann. So meinte ein Kommilitone, durch
die historische Aussprache sei ihm das Latein „entmathematisiert“ worden, was
mir wie die prägnante Formulierung meiner eigenen Erfahrung vorkommt, die
ich eigentlich nicht anders audrücken kann als so: Erst als ich aufhörte, das
Latein wie einen deutschen Dialekt zu behandeln, blies sozusagen ein frischer
Wind vom Süden mir den Kanzlei- und Schulstaub der Jahrhunderte aus dieser
herrlichen Sprache.
Und weshalb sollte man auch nur eine Möglichkeit ungenutzt lassen, philo-
logischen Eros zu entfachen ...? ™
ö Thomas Heck, Tübingen
9 C. Eichenseer, DAV-Mitteilungsblatt Jg. 25, Nr. 2, Juni 1982, S. 5.
10 „The blame rests fairly and squarely with the Universities“. (R.W.Garson, The Classical
Outlook, Dezemer-Januar 1981—1982, S. 48.)
Vergil in Wolfenbüttel
In diesem und dem vergangenen Jahr wurde und wird in der abendländischen
Welt der 2000. Wiederkehr des Todes Vergils gedacht, eines der größten Dichter
des Abendlandes und einer der wenigen zentralen Personen, ohne die der Be-
griff „Abendland“ ohne Kontinuität bliebe. Wie immer man darüber denkt, wie
immer man die Brüche und Katastrophen der abendländischen Geschichte be-
trachtet und bewertet, fest steht, daß Vergil seit 2000 Jahren ein integraler Be-
standteil dieser Geschichte ist.
13
kaum verstanden, sondern auch slawische Gelehrte haben es damit bei uns
schwer usw. Oder wer wüßte auf Anhieb, was [rispaisi: fainam] bedeutet? Bei
lateinischen Vorträgen mit stark ,allophonem‘ Einschlag haben selbst Protek-
toren des „lebendigen Lateins“ gelegentlich immense Verständnisprobleme,
wogegen Referate, deren Redner sich der „reformierten Aussprache“ befleißi-
gen, in aller Regel von einer wohltuenden allgemeinen Verständlichkeit sind.
Was dringend benötigt wird, ist also eine weltweit einheitliche Aussprache
des Lateinischen. Doch da jede Nation ihre Aussprachegepflogenheiten für die
schönsten hält und Bekehrungsversuche bislang meist erfolglos blieben (ich er-
innere nur an die Gründung der Societe des amis de la pronunciation frangaise
du latin!), ließe sich diese Forderung wohl nur erfüllen, wenn jede einzelne
gleich weit zurückgriffe auf die dem allgemeinen herrschenden Klassizismus
ohnehin allein angemessene klassische Aussprache des Lateins des ersten vor-
und nachchristlichen Jahrhunderts, den sogenannten „pronuntiatus restitutus“.
Wenn ich auch der in diesem Zusammenhang vorgebrachten Meinung: „Es
ist genau so leicht, richtig zu sprechen wie falsch“9 nicht zustimmen kann (man
denke nur an die den deutschen Sprechgewohnheiten z. T. völlig zuwiderlau-
fende Verteilung der Quantitäten), so habe ich doch den Eindruck, daß bereits
ein geringes Bemühen — besonders von seiten der Lehrenden an Universität10
und Schule — schöne Erfolge haben kann. So meinte ein Kommilitone, durch
die historische Aussprache sei ihm das Latein „entmathematisiert“ worden, was
mir wie die prägnante Formulierung meiner eigenen Erfahrung vorkommt, die
ich eigentlich nicht anders audrücken kann als so: Erst als ich aufhörte, das
Latein wie einen deutschen Dialekt zu behandeln, blies sozusagen ein frischer
Wind vom Süden mir den Kanzlei- und Schulstaub der Jahrhunderte aus dieser
herrlichen Sprache.
Und weshalb sollte man auch nur eine Möglichkeit ungenutzt lassen, philo-
logischen Eros zu entfachen ...? ™
ö Thomas Heck, Tübingen
9 C. Eichenseer, DAV-Mitteilungsblatt Jg. 25, Nr. 2, Juni 1982, S. 5.
10 „The blame rests fairly and squarely with the Universities“. (R.W.Garson, The Classical
Outlook, Dezemer-Januar 1981—1982, S. 48.)
Vergil in Wolfenbüttel
In diesem und dem vergangenen Jahr wurde und wird in der abendländischen
Welt der 2000. Wiederkehr des Todes Vergils gedacht, eines der größten Dichter
des Abendlandes und einer der wenigen zentralen Personen, ohne die der Be-
griff „Abendland“ ohne Kontinuität bliebe. Wie immer man darüber denkt, wie
immer man die Brüche und Katastrophen der abendländischen Geschichte be-
trachtet und bewertet, fest steht, daß Vergil seit 2000 Jahren ein integraler Be-
standteil dieser Geschichte ist.
13