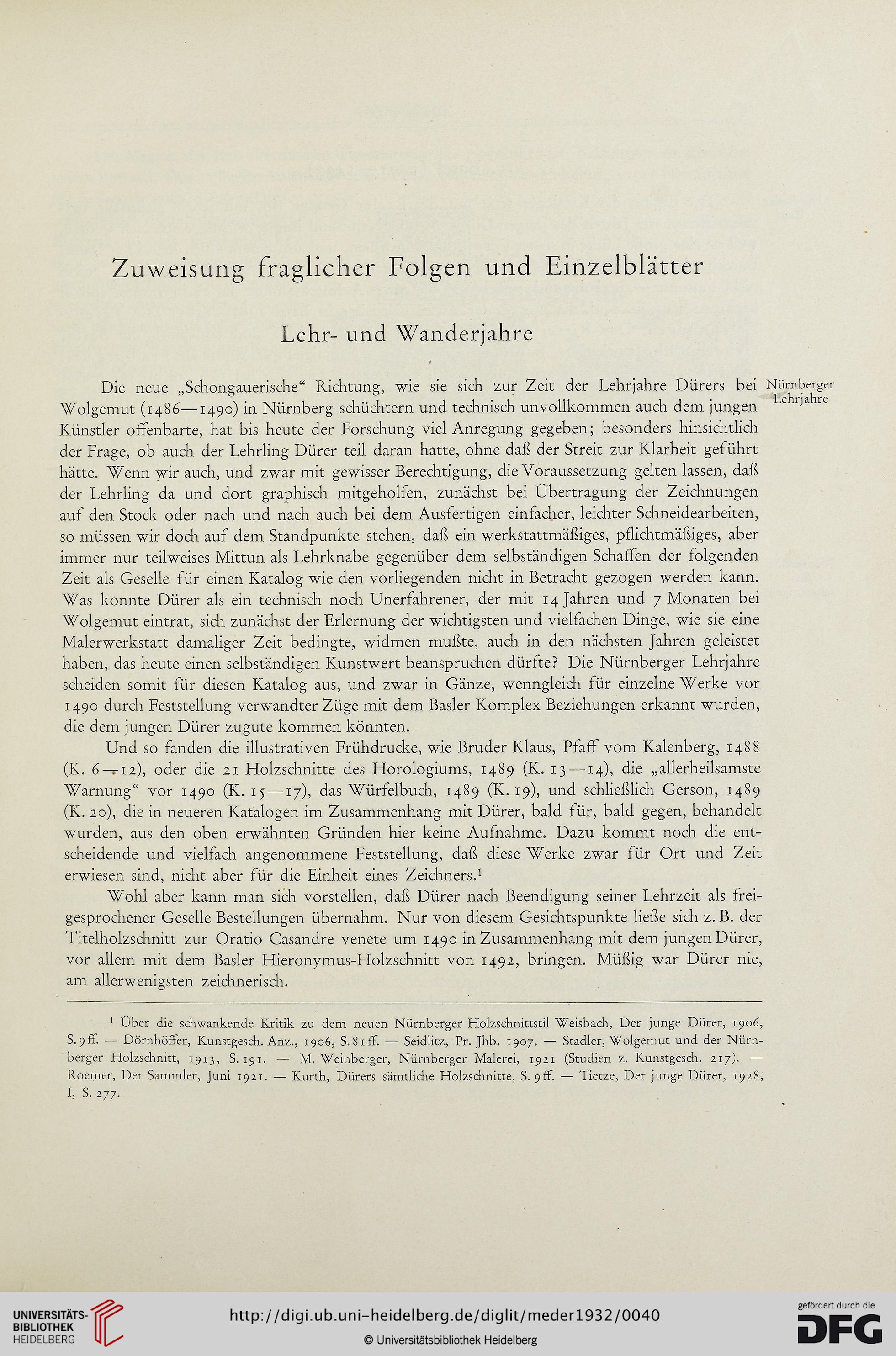Zuweisung fraglicher Folgen und Einzelblätter
Lehr- und Wanderjahre
Die neue „Schongauerische“ Richtung, wie sie sich zur Zeit der Lehrjahre Dürers bei
Wolgemut (i486—1490) in Nürnberg schüchtern und technisch unvollkommen auch dem jungen
Künstler offenbarte, hat bis heute der Forschung viel Anregung gegeben; besonders hinsichtlich
der Frage, ob auch der Lehrling Dürer teil daran hatte, ohne daß der Streit zur Klarheit geführt
hätte. Wenn wir auch, und zwar mit gewisser Berechtigung, die Voraussetzung gelten lassen, daß
der Lehrling da und dort graphisch mitgeholfen, zunächst bei Übertragung der Zeichnungen
auf den Stock oder nach und nach auch bei dem Ausfertigen einfacher, leichter Schneidearbeiten,
so müssen wir doch auf dem Standpunkte stehen, daß ein werkstattmäßiges, pflichtmäßiges, aber
immer nur teilweises Mittun als Lehrknabe gegenüber dem selbständigen Schaffen der folgenden
Zeit als Geselle für einen Katalog wie den vorliegenden nicht in Betracht gezogen werden kann.
Was konnte Dürer als ein technisch noch Unerfahrener, der mit 14 Jahren und 7 Monaten bei
Wolgemut eintrat, sich zunächst der Erlernung der wichtigsten und vielfachen Dinge, wie sie eine
Malerwerkstatt damaliger Zeit bedingte, widmen mußte, auch in den nächsten Jahren geleistet
haben, das heute einen selbständigen Kunstwert beanspruchen dürfte? Die Nürnberger Lehrjahre
scheiden somit für diesen Katalog aus, und zwar in Gänze, wenngleich für einzelne Werke vor
1490 durch Feststellung verwandter Züge mit dem Basler Komplex Beziehungen erkannt wurden,
die dem jungen Dürer zugute kommen könnten.
Und so fanden die illustrativen Frühdrucke, wie Bruder Klaus, Pfaff vom Kalenberg, 1488
(K. 6 — 12), oder die 21 Holzschnitte des Horologiums, 1489 (K. 13 —14), die „allerheilsamste
Warnung“ vor 1490 (K. 15 —17), das Würfelbuch, 1489 (K. 19), und schließlich Gerson, 1489
(K. 20), die in neueren Katalogen im Zusammenhang mit Dürer, bald für, bald gegen, behandelt
wurden, aus den oben erwähnten Gründen hier keine Aufnahme. Dazu kommt noch die ent-
scheidende und vielfach angenommene Feststellung, daß diese Werke zwar für Ort und Zeit
erwiesen sind, nicht aber für die Einheit eines Zeichners.1
Wohl aber kann man sich vorstellen, daß Dürer nach Beendigung seiner Lehrzeit als frei-
gesprochener Geselle Bestellungen übernahm. Nur von diesem Gesichtspunkte ließe sich z. B. der
Titelholzschnitt zur Oratio Casandre venete um 1490 in Zusammenhang mit dem jungen Dürer,
vor allem mit dem Basler Hieronymus-Holzschnitt von 1492, bringen. Müßig war Dürer nie,
am allerwenigsten zeichnerisch. * S.
1 Über die schwankende Kritik zu dem neuen Nürnberger Holzschnittstil Weisbach, Der junge Dürer, 1906,
S. 9ff. — DörnhöfFer, Kunstgesch. Anz., 1906, S. 81 ft. — Seidlitz, Pr. Jhb. 1907. — Stadler, Wolgemut und der Nürn-
berger Holzschnitt, 1913, S. 191. — M. Weinberger, Nürnberger Malerei, 1921 (Studien z. Kunstgesch. 217). -
Roemer, Der Sammler, Juni 1921. ■— Kurth, Dürers sämtliche Holzschnitte, S. 96?. — Tietze, Der junge Dürer, 1928,
h S- 277.
Nürnberger
Lehrjahre
Lehr- und Wanderjahre
Die neue „Schongauerische“ Richtung, wie sie sich zur Zeit der Lehrjahre Dürers bei
Wolgemut (i486—1490) in Nürnberg schüchtern und technisch unvollkommen auch dem jungen
Künstler offenbarte, hat bis heute der Forschung viel Anregung gegeben; besonders hinsichtlich
der Frage, ob auch der Lehrling Dürer teil daran hatte, ohne daß der Streit zur Klarheit geführt
hätte. Wenn wir auch, und zwar mit gewisser Berechtigung, die Voraussetzung gelten lassen, daß
der Lehrling da und dort graphisch mitgeholfen, zunächst bei Übertragung der Zeichnungen
auf den Stock oder nach und nach auch bei dem Ausfertigen einfacher, leichter Schneidearbeiten,
so müssen wir doch auf dem Standpunkte stehen, daß ein werkstattmäßiges, pflichtmäßiges, aber
immer nur teilweises Mittun als Lehrknabe gegenüber dem selbständigen Schaffen der folgenden
Zeit als Geselle für einen Katalog wie den vorliegenden nicht in Betracht gezogen werden kann.
Was konnte Dürer als ein technisch noch Unerfahrener, der mit 14 Jahren und 7 Monaten bei
Wolgemut eintrat, sich zunächst der Erlernung der wichtigsten und vielfachen Dinge, wie sie eine
Malerwerkstatt damaliger Zeit bedingte, widmen mußte, auch in den nächsten Jahren geleistet
haben, das heute einen selbständigen Kunstwert beanspruchen dürfte? Die Nürnberger Lehrjahre
scheiden somit für diesen Katalog aus, und zwar in Gänze, wenngleich für einzelne Werke vor
1490 durch Feststellung verwandter Züge mit dem Basler Komplex Beziehungen erkannt wurden,
die dem jungen Dürer zugute kommen könnten.
Und so fanden die illustrativen Frühdrucke, wie Bruder Klaus, Pfaff vom Kalenberg, 1488
(K. 6 — 12), oder die 21 Holzschnitte des Horologiums, 1489 (K. 13 —14), die „allerheilsamste
Warnung“ vor 1490 (K. 15 —17), das Würfelbuch, 1489 (K. 19), und schließlich Gerson, 1489
(K. 20), die in neueren Katalogen im Zusammenhang mit Dürer, bald für, bald gegen, behandelt
wurden, aus den oben erwähnten Gründen hier keine Aufnahme. Dazu kommt noch die ent-
scheidende und vielfach angenommene Feststellung, daß diese Werke zwar für Ort und Zeit
erwiesen sind, nicht aber für die Einheit eines Zeichners.1
Wohl aber kann man sich vorstellen, daß Dürer nach Beendigung seiner Lehrzeit als frei-
gesprochener Geselle Bestellungen übernahm. Nur von diesem Gesichtspunkte ließe sich z. B. der
Titelholzschnitt zur Oratio Casandre venete um 1490 in Zusammenhang mit dem jungen Dürer,
vor allem mit dem Basler Hieronymus-Holzschnitt von 1492, bringen. Müßig war Dürer nie,
am allerwenigsten zeichnerisch. * S.
1 Über die schwankende Kritik zu dem neuen Nürnberger Holzschnittstil Weisbach, Der junge Dürer, 1906,
S. 9ff. — DörnhöfFer, Kunstgesch. Anz., 1906, S. 81 ft. — Seidlitz, Pr. Jhb. 1907. — Stadler, Wolgemut und der Nürn-
berger Holzschnitt, 1913, S. 191. — M. Weinberger, Nürnberger Malerei, 1921 (Studien z. Kunstgesch. 217). -
Roemer, Der Sammler, Juni 1921. ■— Kurth, Dürers sämtliche Holzschnitte, S. 96?. — Tietze, Der junge Dürer, 1928,
h S- 277.
Nürnberger
Lehrjahre