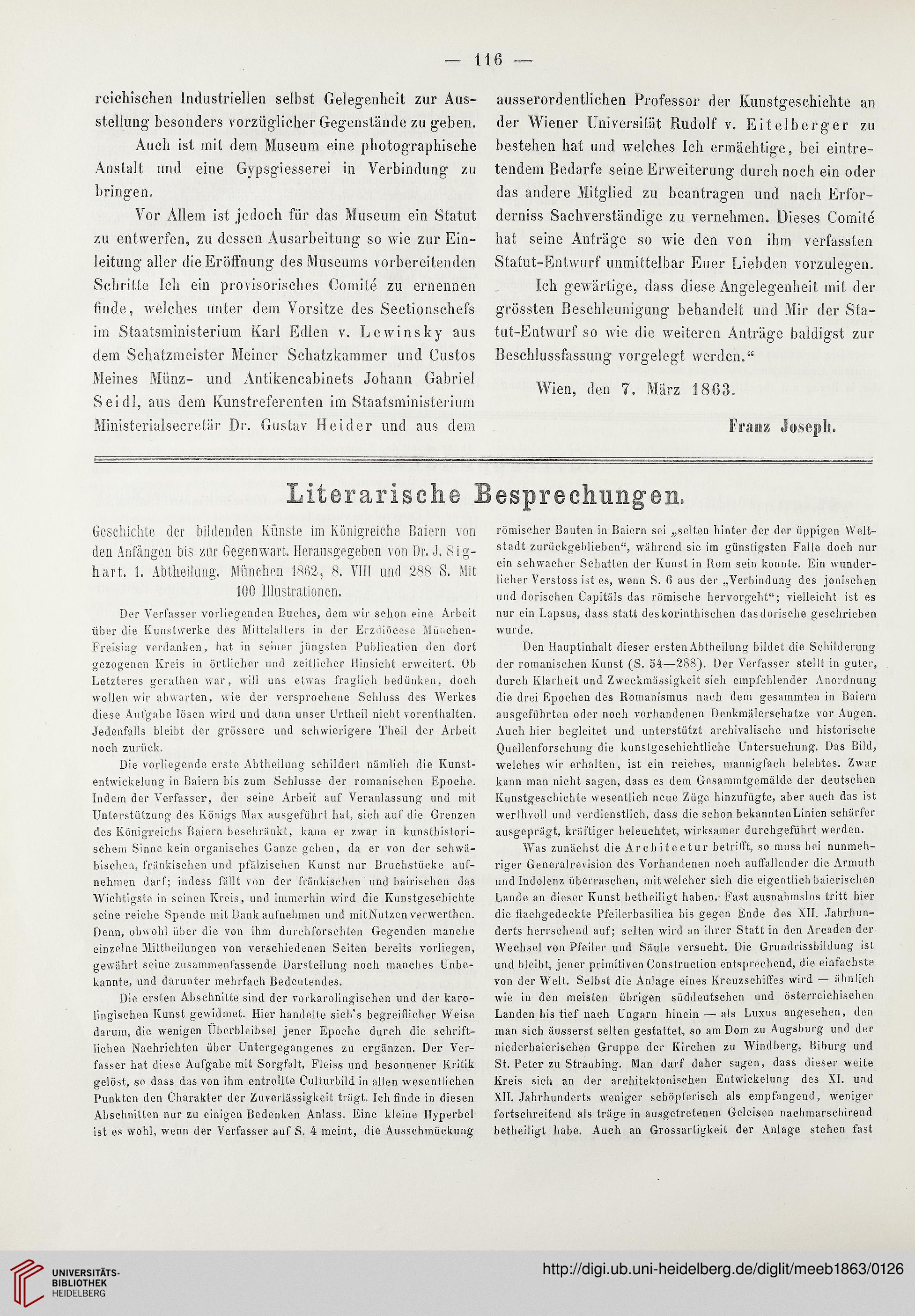116 --
reichischen Industriellen seihst Gelegenheit zur Aus-
stellung besonders vorzüglicher Gegenstände zu geben.
Auch ist mit dem Museum eine photographische
Anstalt und eine Gypsgiesserei in Verbindung zu
bringen.
Vor Allem ist jedoch für das Museum ein Statut
zu entwerfen, zu dessen Ausarbeitung so wie zur Ein-
leitung aller die Eröffnung des Museums vorbereitenden
Schritte Ich ein provisorisches Comite zu ernennen
linde, welches unter dem Vorsitze des Sectionschefs
im Staatsministerium Karl Edlen v. Lewinsky aus
dem Schatzmeister Meiner Schatzkammer und Custos
Meines Münz- und Antikencabinets Johann Gabriel
Seidl, aus dem Kunstreferenten im Staatsministerium
Ministerialsecretär Dr. Gustav Heider und aus dem
ausserordentlichen Professor der Kunstgeschichte an
der Wiener Universität Rudolf v. Eitelberger zu
bestehen hat und welches Ich ermächtige, bei eintre-
tendem Bedarfe seine Erweiterung durch noch ein oder
das andere Mitglied zu beantragen und nach Erfor-
derniss Sachverständige zu vernehmen. Dieses Comite
hat seine Anträge so wie den von ihm verfassten
Statut-Entwurf unmittelbar Euer Liebden vorzulegen.
Ich gewärtige, dass diese Angelegenheit mit der
grössten Beschleunigung behandelt und Mir der Sta-
tut-Entwurf so wie die weiteren Anträge baldigst zur
Beschlussfassung vorgelegt werden."
Wien, den 7. März 1863.
Franz Joseph.
Literarische Besprechungen.
Geschichte der bildenden Künste im Königreiche Baicrn von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Dr. .1. Sig-
hart. 1. Abtheilung. München 1862, 8. VIII und 288 S. Mit
IGO Illustrationen.
Der Verfasser vorliegenden Buches, dem wir schon eine Arbeit
über die Kunstwerke des Mitteialters in der Erzdiocese München-
Freising verdanken, hat in seiner jüngsten Publication den dort
gezogenen Kreis in örtlicher und zeitlicher Hinsicht erweitert. Ob
Letzteres gerathen war, will uns etwas fraglich bedünken, doch
wollen wir abwarten, wie der versprochene Schluss des Werkes
diese Aufgabe lösen wird und dann unser Urtheil nicht vorenthalten.
Jedenfalls bleibt der grössere und schwierigere Theil der Arbeit
noch zurück.
Die vorliegende erste Abtheilung schildert nämlich die Kunst-
entwickelung in Baiern bis zum Schlüsse der romanischen Epoche.
Indem der Verfasser, der seine Arbeit auf Veranlassung und mit
Unterstützung des Königs Max ausgeführt hat, sich auf die Grenzen
des Königreichs Baiern beschränkt, kann er zwar in kunsthistori-
schem Sinne kein organisches Ganze geben, da er von der schwä-
bischen, fränkischen und pfälzischen Kunst nur Bruchstücke auf-
nehmen darf; indess fällt von der fränkischen und hairischen das
Wichtigste in seinen Kreis, und immerhin wird die Kunstgeschichte
seine reiche Spende mitDankaufnehmen und mitNutzenverwerthen.
Denn, obwohl über die von ihm durchforschten Gegenden manche
einzelne Mittheilungen von verschiedenen Seiten bereits vorliegen,
gewährt seine zusammenfassende Darstellung noch manches Unbe-
kannte, und darunter mehrfach Bedeutendes.
Die ersten Abschnitte sind der vorkarolingischen und der karo-
lingischen Kunst gewidmet. Hier handelte sich's begreiflicher Weise
darum, die wenigen Überbleibsel jener Epoche durch die schrift-
lichen Nachrichten über Untergegangenes zu ergänzen. Der Ver-
fasser hat diese Aufgabe mit Sorgfalt, Fleiss und besonnener Kritik
gelöst, so dass das von ihm entrollte Culturbild in allen wesentlichen
Punkten den Charakter der Zuverlässigkeit trägt. Ich linde in diesen
Abschnitten nur zu einigen Bedenken Anlass. Eine kleine Hyperbel
ist es wohl, wenn der Verfasser auf S. 4 meint, die Ausschmückung
römischer Bauten in Baiern sei „selten hinter der der üppigen Welt-
stadt zurückgeblieben", während sie im günstigsten Falle doch nur
ein schwacher Schatten der Kunst in Rom sein konnte. Ein wunder-
licher Verstoss ist es, wenn S. 6 aus der „Verbindung des jonischen
und dorischen Capitäls das römische hervorgeht"; vielleicht ist es
nur ein Lapsus, dass statt deskorinthischen das dorische geschrieben
wurde.
Den Hauptinhalt dieser erstenAbtheilung bildet die Schilderung
der romanischen Kunst (S. 54—288). Der Verfasser steiit in guter,
durch Klarheit und Zweckmässigkeit sich empfehlender Anordnung
die drei Epochen des Romanismus nach dem gesammten in Baiern
ausgeführten oder noch vorhandenen Denkmälerschatze vor Augen.
Auch hier begleitet und unterstützt archivalische und historische
Quellenforschung die kunstgeschichtliche Untersuchung. Das Bild,
welches wir erhalten, ist ein reiches, mannigfach belebtes. Zwar
kann man nicht sagen, dass es dem Gesammtgemälde der deutschen
Kunstgeschichte wesentlich neue Züge hinzufügte, aber auch das ist
werlhvoll und verdienstlich, dass die schon bekanntenLinien schärfer
ausgeprägt, kräftiger beleuchtet, wirksamer durchgeführt werden.
Was zunächst die Architectur betrifft, so muss bei nunmeh-
riger Generalrevision des Vorhandenen noch auffallender die Armuth
und Indolenz überraschen, mit welcher sich die eigentlich haierischen
Lande an dieser Kunst betheiligt haben. Fast ausnahmslos tritt hier
die tlachgedeckte Pfeilerbasilica bis gegen Ende des XII. Jahrhun-
derts herrschend auf; selten wird an ihrer Statt in den Arcaden der
Wechsel von Pfeiler und Säule versucht. Die Grundrissbiidung ist
und bleibt, jener primitiven Construction entsprechend, die einfachste
von der Welt. Selbst die Anlage eines Kreuzsehiffes wird — ähnlich
wie in den meisten übrigen süddeutschen und österreichischen
Landen bis tief nach Ungarn hinein—als Luxus angesehen, den
man sich äusserst selten gestattet, so am Dom zu Augsburg und der
niederbaierischen Gruppe der Kirchen zu Windberg, Biburg und
St. Peter zu Straubing. Man darf daher sagen, dass dieser weite
Kreis sielt an der architektonischen Entwickelung des XL und
XII. Jahrhunderts weniger schöpferisch als empfangend, weniger
fortschreitend als träge in ausgetretenen Geleisen nachmarschirend
betheiligt habe. Auch an Grossartigkeit der Anlage stehen fast
reichischen Industriellen seihst Gelegenheit zur Aus-
stellung besonders vorzüglicher Gegenstände zu geben.
Auch ist mit dem Museum eine photographische
Anstalt und eine Gypsgiesserei in Verbindung zu
bringen.
Vor Allem ist jedoch für das Museum ein Statut
zu entwerfen, zu dessen Ausarbeitung so wie zur Ein-
leitung aller die Eröffnung des Museums vorbereitenden
Schritte Ich ein provisorisches Comite zu ernennen
linde, welches unter dem Vorsitze des Sectionschefs
im Staatsministerium Karl Edlen v. Lewinsky aus
dem Schatzmeister Meiner Schatzkammer und Custos
Meines Münz- und Antikencabinets Johann Gabriel
Seidl, aus dem Kunstreferenten im Staatsministerium
Ministerialsecretär Dr. Gustav Heider und aus dem
ausserordentlichen Professor der Kunstgeschichte an
der Wiener Universität Rudolf v. Eitelberger zu
bestehen hat und welches Ich ermächtige, bei eintre-
tendem Bedarfe seine Erweiterung durch noch ein oder
das andere Mitglied zu beantragen und nach Erfor-
derniss Sachverständige zu vernehmen. Dieses Comite
hat seine Anträge so wie den von ihm verfassten
Statut-Entwurf unmittelbar Euer Liebden vorzulegen.
Ich gewärtige, dass diese Angelegenheit mit der
grössten Beschleunigung behandelt und Mir der Sta-
tut-Entwurf so wie die weiteren Anträge baldigst zur
Beschlussfassung vorgelegt werden."
Wien, den 7. März 1863.
Franz Joseph.
Literarische Besprechungen.
Geschichte der bildenden Künste im Königreiche Baicrn von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Dr. .1. Sig-
hart. 1. Abtheilung. München 1862, 8. VIII und 288 S. Mit
IGO Illustrationen.
Der Verfasser vorliegenden Buches, dem wir schon eine Arbeit
über die Kunstwerke des Mitteialters in der Erzdiocese München-
Freising verdanken, hat in seiner jüngsten Publication den dort
gezogenen Kreis in örtlicher und zeitlicher Hinsicht erweitert. Ob
Letzteres gerathen war, will uns etwas fraglich bedünken, doch
wollen wir abwarten, wie der versprochene Schluss des Werkes
diese Aufgabe lösen wird und dann unser Urtheil nicht vorenthalten.
Jedenfalls bleibt der grössere und schwierigere Theil der Arbeit
noch zurück.
Die vorliegende erste Abtheilung schildert nämlich die Kunst-
entwickelung in Baiern bis zum Schlüsse der romanischen Epoche.
Indem der Verfasser, der seine Arbeit auf Veranlassung und mit
Unterstützung des Königs Max ausgeführt hat, sich auf die Grenzen
des Königreichs Baiern beschränkt, kann er zwar in kunsthistori-
schem Sinne kein organisches Ganze geben, da er von der schwä-
bischen, fränkischen und pfälzischen Kunst nur Bruchstücke auf-
nehmen darf; indess fällt von der fränkischen und hairischen das
Wichtigste in seinen Kreis, und immerhin wird die Kunstgeschichte
seine reiche Spende mitDankaufnehmen und mitNutzenverwerthen.
Denn, obwohl über die von ihm durchforschten Gegenden manche
einzelne Mittheilungen von verschiedenen Seiten bereits vorliegen,
gewährt seine zusammenfassende Darstellung noch manches Unbe-
kannte, und darunter mehrfach Bedeutendes.
Die ersten Abschnitte sind der vorkarolingischen und der karo-
lingischen Kunst gewidmet. Hier handelte sich's begreiflicher Weise
darum, die wenigen Überbleibsel jener Epoche durch die schrift-
lichen Nachrichten über Untergegangenes zu ergänzen. Der Ver-
fasser hat diese Aufgabe mit Sorgfalt, Fleiss und besonnener Kritik
gelöst, so dass das von ihm entrollte Culturbild in allen wesentlichen
Punkten den Charakter der Zuverlässigkeit trägt. Ich linde in diesen
Abschnitten nur zu einigen Bedenken Anlass. Eine kleine Hyperbel
ist es wohl, wenn der Verfasser auf S. 4 meint, die Ausschmückung
römischer Bauten in Baiern sei „selten hinter der der üppigen Welt-
stadt zurückgeblieben", während sie im günstigsten Falle doch nur
ein schwacher Schatten der Kunst in Rom sein konnte. Ein wunder-
licher Verstoss ist es, wenn S. 6 aus der „Verbindung des jonischen
und dorischen Capitäls das römische hervorgeht"; vielleicht ist es
nur ein Lapsus, dass statt deskorinthischen das dorische geschrieben
wurde.
Den Hauptinhalt dieser erstenAbtheilung bildet die Schilderung
der romanischen Kunst (S. 54—288). Der Verfasser steiit in guter,
durch Klarheit und Zweckmässigkeit sich empfehlender Anordnung
die drei Epochen des Romanismus nach dem gesammten in Baiern
ausgeführten oder noch vorhandenen Denkmälerschatze vor Augen.
Auch hier begleitet und unterstützt archivalische und historische
Quellenforschung die kunstgeschichtliche Untersuchung. Das Bild,
welches wir erhalten, ist ein reiches, mannigfach belebtes. Zwar
kann man nicht sagen, dass es dem Gesammtgemälde der deutschen
Kunstgeschichte wesentlich neue Züge hinzufügte, aber auch das ist
werlhvoll und verdienstlich, dass die schon bekanntenLinien schärfer
ausgeprägt, kräftiger beleuchtet, wirksamer durchgeführt werden.
Was zunächst die Architectur betrifft, so muss bei nunmeh-
riger Generalrevision des Vorhandenen noch auffallender die Armuth
und Indolenz überraschen, mit welcher sich die eigentlich haierischen
Lande an dieser Kunst betheiligt haben. Fast ausnahmslos tritt hier
die tlachgedeckte Pfeilerbasilica bis gegen Ende des XII. Jahrhun-
derts herrschend auf; selten wird an ihrer Statt in den Arcaden der
Wechsel von Pfeiler und Säule versucht. Die Grundrissbiidung ist
und bleibt, jener primitiven Construction entsprechend, die einfachste
von der Welt. Selbst die Anlage eines Kreuzsehiffes wird — ähnlich
wie in den meisten übrigen süddeutschen und österreichischen
Landen bis tief nach Ungarn hinein—als Luxus angesehen, den
man sich äusserst selten gestattet, so am Dom zu Augsburg und der
niederbaierischen Gruppe der Kirchen zu Windberg, Biburg und
St. Peter zu Straubing. Man darf daher sagen, dass dieser weite
Kreis sielt an der architektonischen Entwickelung des XL und
XII. Jahrhunderts weniger schöpferisch als empfangend, weniger
fortschreitend als träge in ausgetretenen Geleisen nachmarschirend
betheiligt habe. Auch an Grossartigkeit der Anlage stehen fast