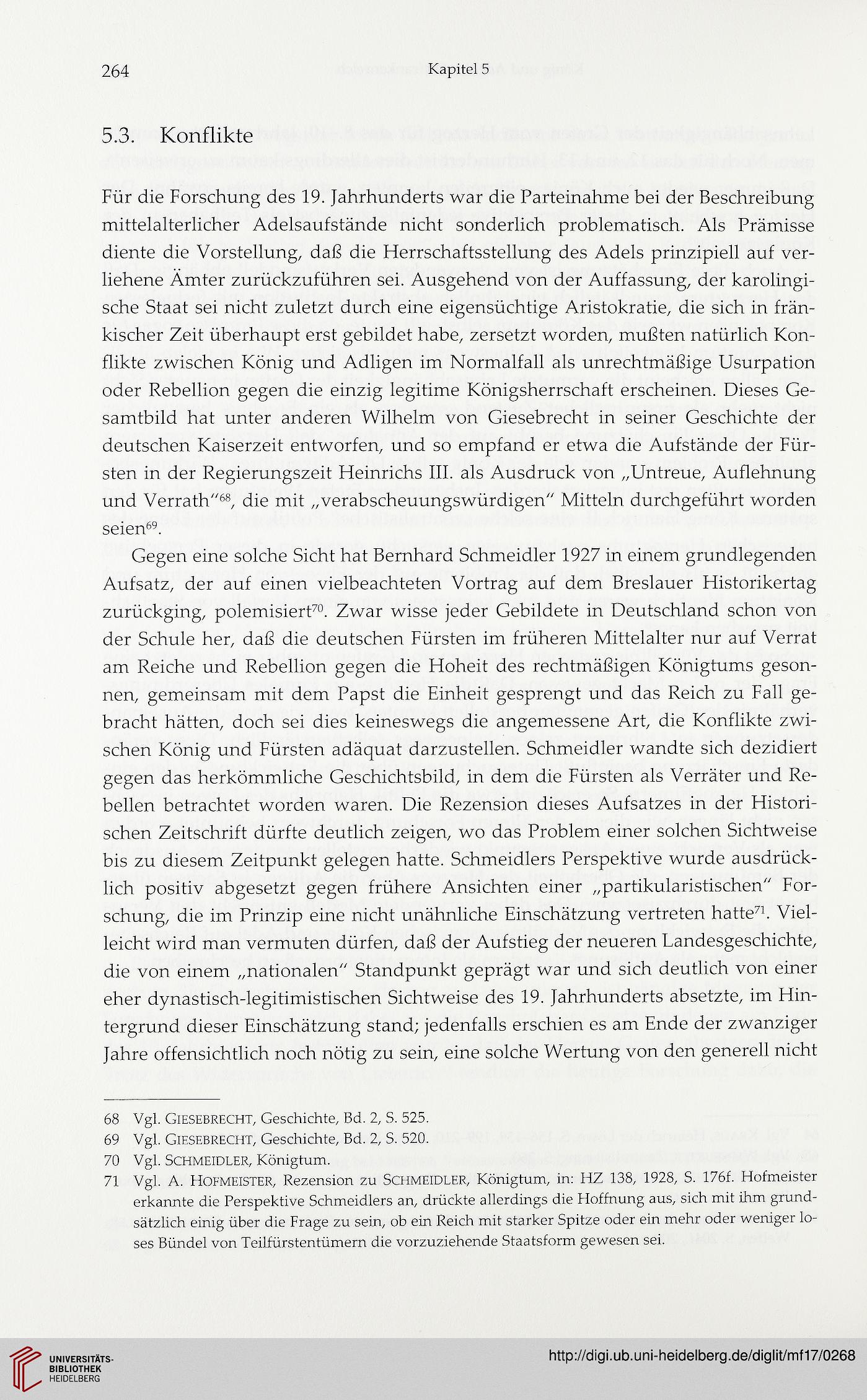264
Kapitel 5
5.3. Konflikte
Für die Forschung des 19. Jahrhunderts war die Parteinahme bei der Beschreibung
mittelalterlicher Adelsaufstände nicht sonderlich problematisch. Als Prämisse
diente die Vorstellung, daß die Herrschaftsstellung des Adels prinzipiell auf ver-
liehene Ämter zurückzuführen sei. Ausgehend von der Auffassung, der karolingi-
sche Staat sei nicht zuletzt durch eine eigensüchtige Aristokratie, die sich in frän-
kischer Zeit überhaupt erst gebildet habe, zersetzt worden, mußten natürlich Kon-
flikte zwischen König und Adligen im Normalfall als unrechtmäßige Usurpation
oder Rebellion gegen die einzig legitime Königsherrschaft erscheinen. Dieses Ge-
samtbild hat unter anderen Wilhelm von Giesebrecht in seiner Geschichte der
deutschen Kaiserzeit entworfen, und so empfand er etwa die Aufstände der Für-
sten in der Regierungszeit Heinrichs III. als Ausdruck von „Untreue, Auflehnung
und Verrath"6s, die mit „verabscheuungswürdigen" Mitteln durchgeführt worden
seien^.
Gegen eine solche Sicht hat Bernhard Schmeidler 1927 in einem grundlegenden
Aufsatz, der auf einen vielbeachteten Vortrag auf dem Breslauer Historikertag
zurückging, polemisiert^. Zwar wisse jeder Gebildete in Deutschland schon von
der Schule her, daß die deutschen Fürsten im früheren Mittelalter nur auf Verrat
am Reiche und Rebellion gegen die Hoheit des rechtmäßigen Königtums geson-
nen, gemeinsam mit dem Papst die Einheit gesprengt und das Reich zu Fall ge-
bracht hätten, doch sei dies keineswegs die angemessene Art, die Konflikte zwi-
schen König und Fürsten adäquat darzustellen. Schmeidler wandte sich dezidiert
gegen das herkömmliche Geschichtsbild, in dem die Fürsten als Verräter und Re-
bellen betrachtet worden waren. Die Rezension dieses Aufsatzes in der Histori-
schen Zeitschrift dürfte deutlich zeigen, wo das Problem einer solchen Sichtweise
bis zu diesem Zeitpunkt gelegen hatte. Schmeidlers Perspektive wurde ausdrück-
lich positiv abgesetzt gegen frühere Ansichten einer „partikularistischen" For-
schung, die im Prinzip eine nicht unähnliche Einschätzung vertreten hatteV Viel-
leicht wird man vermuten dürfen, daß der Aufstieg der neueren Landesgeschichte,
die von einem „nationalen" Standpunkt geprägt war und sich deutlich von einer
eher dynastisch-legitimistischen Sichtweise des 19. Jahrhunderts absetzte, im Hin-
tergrund dieser Einschätzung stand; jedenfalls erschien es am Ende der zwanziger
Jahre offensichtlich noch nötig zu sein, eine solche Wertung von den generell nicht
68 Vgl. GIESEBRECHT, Geschichte, Bd. 2, S. 525.
69 Vgl. GIESEBRECHT, Geschichte, Bd. 2, S. 520.
70 Vgl. SCHMEIDLER, Königtum.
71 Vgl. A. HOFMEISTER, Rezension zu SCHMEIDLER, Königtum, in: HZ 138, 1928, S. 176t. Hofmeister
erkannte die Perspektive Schmeidlers an, drückte allerdings die Hoffnung aus, sich mit ihm grund-
sätzlich einig über die Frage zu sein, ob ein Reich mit starker Spitze oder ein mehr oder weniger lo-
ses Bündel von Teilfürstentümern die vorzuziehende Staatsform gewesen sei.
Kapitel 5
5.3. Konflikte
Für die Forschung des 19. Jahrhunderts war die Parteinahme bei der Beschreibung
mittelalterlicher Adelsaufstände nicht sonderlich problematisch. Als Prämisse
diente die Vorstellung, daß die Herrschaftsstellung des Adels prinzipiell auf ver-
liehene Ämter zurückzuführen sei. Ausgehend von der Auffassung, der karolingi-
sche Staat sei nicht zuletzt durch eine eigensüchtige Aristokratie, die sich in frän-
kischer Zeit überhaupt erst gebildet habe, zersetzt worden, mußten natürlich Kon-
flikte zwischen König und Adligen im Normalfall als unrechtmäßige Usurpation
oder Rebellion gegen die einzig legitime Königsherrschaft erscheinen. Dieses Ge-
samtbild hat unter anderen Wilhelm von Giesebrecht in seiner Geschichte der
deutschen Kaiserzeit entworfen, und so empfand er etwa die Aufstände der Für-
sten in der Regierungszeit Heinrichs III. als Ausdruck von „Untreue, Auflehnung
und Verrath"6s, die mit „verabscheuungswürdigen" Mitteln durchgeführt worden
seien^.
Gegen eine solche Sicht hat Bernhard Schmeidler 1927 in einem grundlegenden
Aufsatz, der auf einen vielbeachteten Vortrag auf dem Breslauer Historikertag
zurückging, polemisiert^. Zwar wisse jeder Gebildete in Deutschland schon von
der Schule her, daß die deutschen Fürsten im früheren Mittelalter nur auf Verrat
am Reiche und Rebellion gegen die Hoheit des rechtmäßigen Königtums geson-
nen, gemeinsam mit dem Papst die Einheit gesprengt und das Reich zu Fall ge-
bracht hätten, doch sei dies keineswegs die angemessene Art, die Konflikte zwi-
schen König und Fürsten adäquat darzustellen. Schmeidler wandte sich dezidiert
gegen das herkömmliche Geschichtsbild, in dem die Fürsten als Verräter und Re-
bellen betrachtet worden waren. Die Rezension dieses Aufsatzes in der Histori-
schen Zeitschrift dürfte deutlich zeigen, wo das Problem einer solchen Sichtweise
bis zu diesem Zeitpunkt gelegen hatte. Schmeidlers Perspektive wurde ausdrück-
lich positiv abgesetzt gegen frühere Ansichten einer „partikularistischen" For-
schung, die im Prinzip eine nicht unähnliche Einschätzung vertreten hatteV Viel-
leicht wird man vermuten dürfen, daß der Aufstieg der neueren Landesgeschichte,
die von einem „nationalen" Standpunkt geprägt war und sich deutlich von einer
eher dynastisch-legitimistischen Sichtweise des 19. Jahrhunderts absetzte, im Hin-
tergrund dieser Einschätzung stand; jedenfalls erschien es am Ende der zwanziger
Jahre offensichtlich noch nötig zu sein, eine solche Wertung von den generell nicht
68 Vgl. GIESEBRECHT, Geschichte, Bd. 2, S. 525.
69 Vgl. GIESEBRECHT, Geschichte, Bd. 2, S. 520.
70 Vgl. SCHMEIDLER, Königtum.
71 Vgl. A. HOFMEISTER, Rezension zu SCHMEIDLER, Königtum, in: HZ 138, 1928, S. 176t. Hofmeister
erkannte die Perspektive Schmeidlers an, drückte allerdings die Hoffnung aus, sich mit ihm grund-
sätzlich einig über die Frage zu sein, ob ein Reich mit starker Spitze oder ein mehr oder weniger lo-
ses Bündel von Teilfürstentümern die vorzuziehende Staatsform gewesen sei.