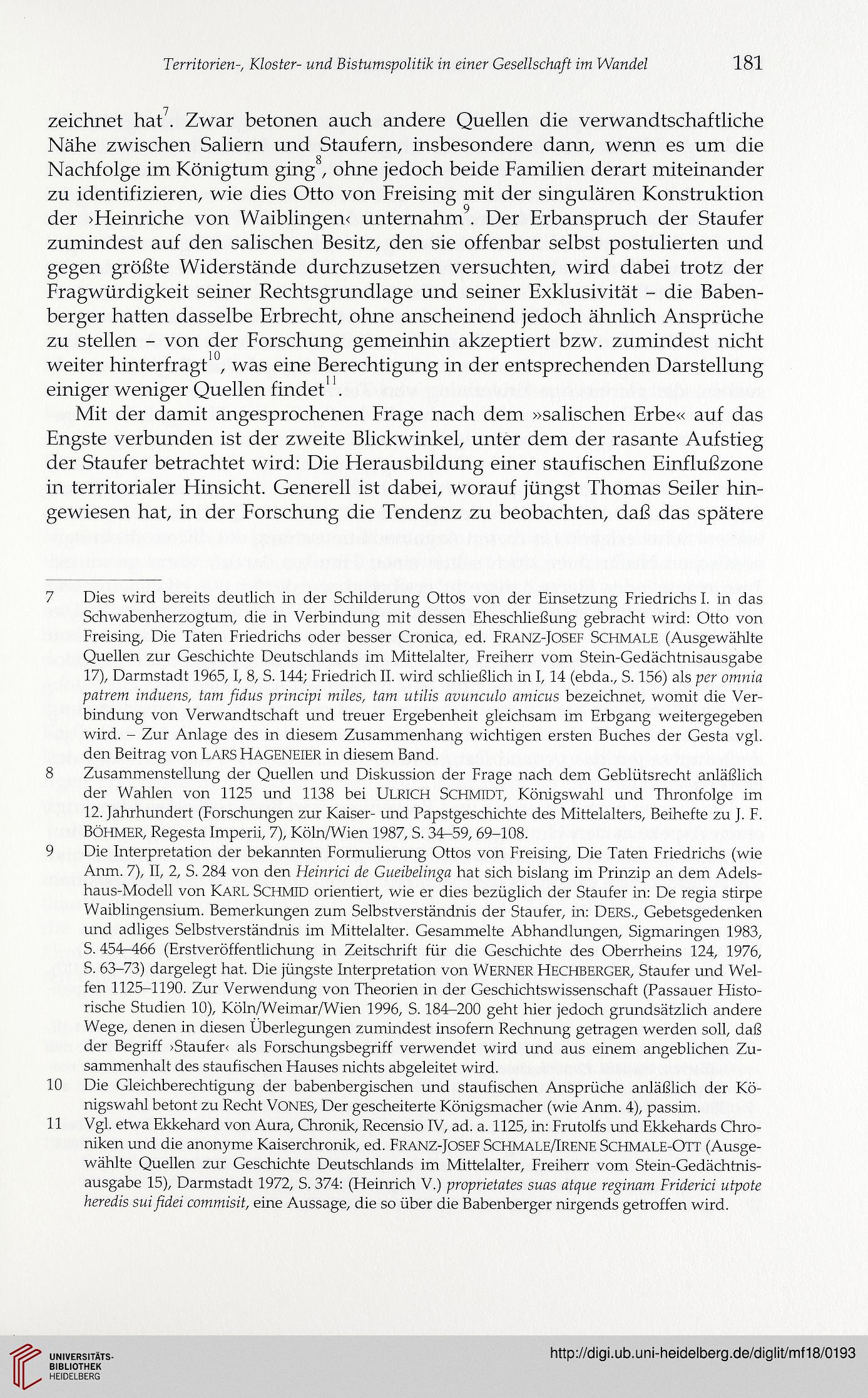Territorien-, Kloster- und Bistumspolitik in einer Gesellschaft im Wandel
181
zeichnet hat7. Zwar betonen auch andere Quellen die verwandtschaftliche
Nähe zwischen Saliern und Staufern, insbesondere dann, wenn es um die
Nachfolge im Königtum ging , ohne jedoch beide Familien derart miteinander
zu identifizieren, wie dies Otto von Freising mit der singulären Konstruktion
der >Fleinriche von Waiblingern unternahm9. Der Erbanspruch der Staufer
zumindest auf den salischen Besitz, den sie offenbar selbst postulierten und
gegen größte Widerstände durchzusetzen versuchten, wird dabei trotz der
Fragwürdigkeit seiner Rechtsgrundlage und seiner Exklusivität - die Baben-
berger hatten dasselbe Erbrecht, ohne anscheinend jedoch ähnlich Ansprüche
zu stellen - von der Forschung gemeinhin akzeptiert bzw. zumindest nicht
weiter hinterfragt10, was eine Berechtigung in der entsprechenden Darstellung
einiger weniger Quellen findet .
Mit der damit angesprochenen Frage nach dem »salischen Erbe« auf das
Engste verbunden ist der zweite Blickwinkel, unter dem der rasante Aufstieg
der Staufer betrachtet wird: Die Herausbildung einer staufischen Einflußzone
in territorialer Hinsicht. Generell ist dabei, worauf jüngst Thomas Seiler hin-
gewiesen hat, in der Forschung die Tendenz zu beobachten, daß das spätere
7 Dies wird bereits deutlich in der Schilderung Ottos von der Einsetzung Friedrichs I. in das
Schwabenherzogtum, die in Verbindung mit dessen Eheschließung gebracht wird: Otto von
Freising, Die Taten Friedrichs oder besser Cronica, ed. FRANZ-JOSEF SCHMALE (Ausgewählte
Quellen zur Geschichte Deutschlands im Mittelalter, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe
17), Darmstadt 1965,1, 8, S. 144; Friedrich II. wird schließlich in I, 14 (ebda., S. 156) als per omnia
patrem induens, tarn fidus principi miles, tarn utilis avunculo amicus bezeichnet, womit die Ver-
bindung von Verwandtschaft und treuer Ergebenheit gleichsam im Erbgang weitergegeben
wird. - Zur Anlage des in diesem Zusammenhang wichtigen ersten Buches der Gesta vgl.
den Beitrag von Lars HAGENEIER in diesem Band.
8 Zusammenstellung der Quellen und Diskussion der Frage nach dem Geblütsrecht anläßlich
der Wahlen von 1125 und 1138 bei ULRICH SCHMIDT, Königswahl und Thronfolge im
12. Jahrhundert (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F.
BÖHMER, Regesta Imperii, 7), Köln/Wien 1987, S. 34—59, 69-108.
9 Die Interpretation der bekannten Formulierung Ottos von Freising, Die Taten Friedrichs (wie
Anm. 7), II, 2, S. 284 von den Heinrici de Gueibelinga hat sich bislang im Prinzip an dem Adels-
haus-Modell von KARL Schmid orientiert, wie er dies bezüglich der Staufer in: De regia stirpe
Waiblingensium. Bemerkungen zum Selbstverständnis der Staufer, in: DERS., Gebetsgedenken
und adliges Selbstverständnis im Mittelalter. Gesammelte Abhandlungen, Sigmaringen 1983,
S. 454-466 (Erstveröffentlichung in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 124, 1976,
S. 63-73) dargelegt hat. Die jüngste Interpretation von WERNER HECHBERGER, Staufer und Wel-
fen 1125-1190. Zur Verwendung von Theorien in der Geschichtswissenschaft (Passauer Histo-
rische Studien 10), Köln/Weimar/Wien 1996, S. 184-200 geht hier jedoch grundsätzlich andere
Wege, denen in diesen Überlegungen zumindest insofern Rechnung getragen werden soll, daß
der Begriff >Staufer< als Forschungsbegriff verwendet wird und aus einem angeblichen Zu-
sammenhalt des staufischen Hauses nichts abgeleitet wird.
10 Die Gleichberechtigung der babenbergischen und staufischen Ansprüche anläßlich der Kö-
nigswahl betont zu Recht VONES, Der gescheiterte Königsmacher (wie Anm. 4), passim.
11 Vgl. etwa Ekkehard von Aura, Chronik, Recensio IV, ad. a. 1125, in: Frutolfs und Ekkehards Chro-
niken und die anonyme Kaiserchronik, ed. FRANZ-JOSEF SCHMALE/lRENE Schmale-Ott (Ausge-
wählte Quellen zur Geschichte Deutschlands im Mittelalter, Freiherr vom Stein-Gedächtnis-
ausgabe 15), Darmstadt 1972, S. 374: (Heinrich V.) proprietates suas atque reginam Friderici utpote
heredis suifidei commisit, eine Aussage, die so über die Babenberger nirgends getroffen wird.
181
zeichnet hat7. Zwar betonen auch andere Quellen die verwandtschaftliche
Nähe zwischen Saliern und Staufern, insbesondere dann, wenn es um die
Nachfolge im Königtum ging , ohne jedoch beide Familien derart miteinander
zu identifizieren, wie dies Otto von Freising mit der singulären Konstruktion
der >Fleinriche von Waiblingern unternahm9. Der Erbanspruch der Staufer
zumindest auf den salischen Besitz, den sie offenbar selbst postulierten und
gegen größte Widerstände durchzusetzen versuchten, wird dabei trotz der
Fragwürdigkeit seiner Rechtsgrundlage und seiner Exklusivität - die Baben-
berger hatten dasselbe Erbrecht, ohne anscheinend jedoch ähnlich Ansprüche
zu stellen - von der Forschung gemeinhin akzeptiert bzw. zumindest nicht
weiter hinterfragt10, was eine Berechtigung in der entsprechenden Darstellung
einiger weniger Quellen findet .
Mit der damit angesprochenen Frage nach dem »salischen Erbe« auf das
Engste verbunden ist der zweite Blickwinkel, unter dem der rasante Aufstieg
der Staufer betrachtet wird: Die Herausbildung einer staufischen Einflußzone
in territorialer Hinsicht. Generell ist dabei, worauf jüngst Thomas Seiler hin-
gewiesen hat, in der Forschung die Tendenz zu beobachten, daß das spätere
7 Dies wird bereits deutlich in der Schilderung Ottos von der Einsetzung Friedrichs I. in das
Schwabenherzogtum, die in Verbindung mit dessen Eheschließung gebracht wird: Otto von
Freising, Die Taten Friedrichs oder besser Cronica, ed. FRANZ-JOSEF SCHMALE (Ausgewählte
Quellen zur Geschichte Deutschlands im Mittelalter, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe
17), Darmstadt 1965,1, 8, S. 144; Friedrich II. wird schließlich in I, 14 (ebda., S. 156) als per omnia
patrem induens, tarn fidus principi miles, tarn utilis avunculo amicus bezeichnet, womit die Ver-
bindung von Verwandtschaft und treuer Ergebenheit gleichsam im Erbgang weitergegeben
wird. - Zur Anlage des in diesem Zusammenhang wichtigen ersten Buches der Gesta vgl.
den Beitrag von Lars HAGENEIER in diesem Band.
8 Zusammenstellung der Quellen und Diskussion der Frage nach dem Geblütsrecht anläßlich
der Wahlen von 1125 und 1138 bei ULRICH SCHMIDT, Königswahl und Thronfolge im
12. Jahrhundert (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F.
BÖHMER, Regesta Imperii, 7), Köln/Wien 1987, S. 34—59, 69-108.
9 Die Interpretation der bekannten Formulierung Ottos von Freising, Die Taten Friedrichs (wie
Anm. 7), II, 2, S. 284 von den Heinrici de Gueibelinga hat sich bislang im Prinzip an dem Adels-
haus-Modell von KARL Schmid orientiert, wie er dies bezüglich der Staufer in: De regia stirpe
Waiblingensium. Bemerkungen zum Selbstverständnis der Staufer, in: DERS., Gebetsgedenken
und adliges Selbstverständnis im Mittelalter. Gesammelte Abhandlungen, Sigmaringen 1983,
S. 454-466 (Erstveröffentlichung in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 124, 1976,
S. 63-73) dargelegt hat. Die jüngste Interpretation von WERNER HECHBERGER, Staufer und Wel-
fen 1125-1190. Zur Verwendung von Theorien in der Geschichtswissenschaft (Passauer Histo-
rische Studien 10), Köln/Weimar/Wien 1996, S. 184-200 geht hier jedoch grundsätzlich andere
Wege, denen in diesen Überlegungen zumindest insofern Rechnung getragen werden soll, daß
der Begriff >Staufer< als Forschungsbegriff verwendet wird und aus einem angeblichen Zu-
sammenhalt des staufischen Hauses nichts abgeleitet wird.
10 Die Gleichberechtigung der babenbergischen und staufischen Ansprüche anläßlich der Kö-
nigswahl betont zu Recht VONES, Der gescheiterte Königsmacher (wie Anm. 4), passim.
11 Vgl. etwa Ekkehard von Aura, Chronik, Recensio IV, ad. a. 1125, in: Frutolfs und Ekkehards Chro-
niken und die anonyme Kaiserchronik, ed. FRANZ-JOSEF SCHMALE/lRENE Schmale-Ott (Ausge-
wählte Quellen zur Geschichte Deutschlands im Mittelalter, Freiherr vom Stein-Gedächtnis-
ausgabe 15), Darmstadt 1972, S. 374: (Heinrich V.) proprietates suas atque reginam Friderici utpote
heredis suifidei commisit, eine Aussage, die so über die Babenberger nirgends getroffen wird.