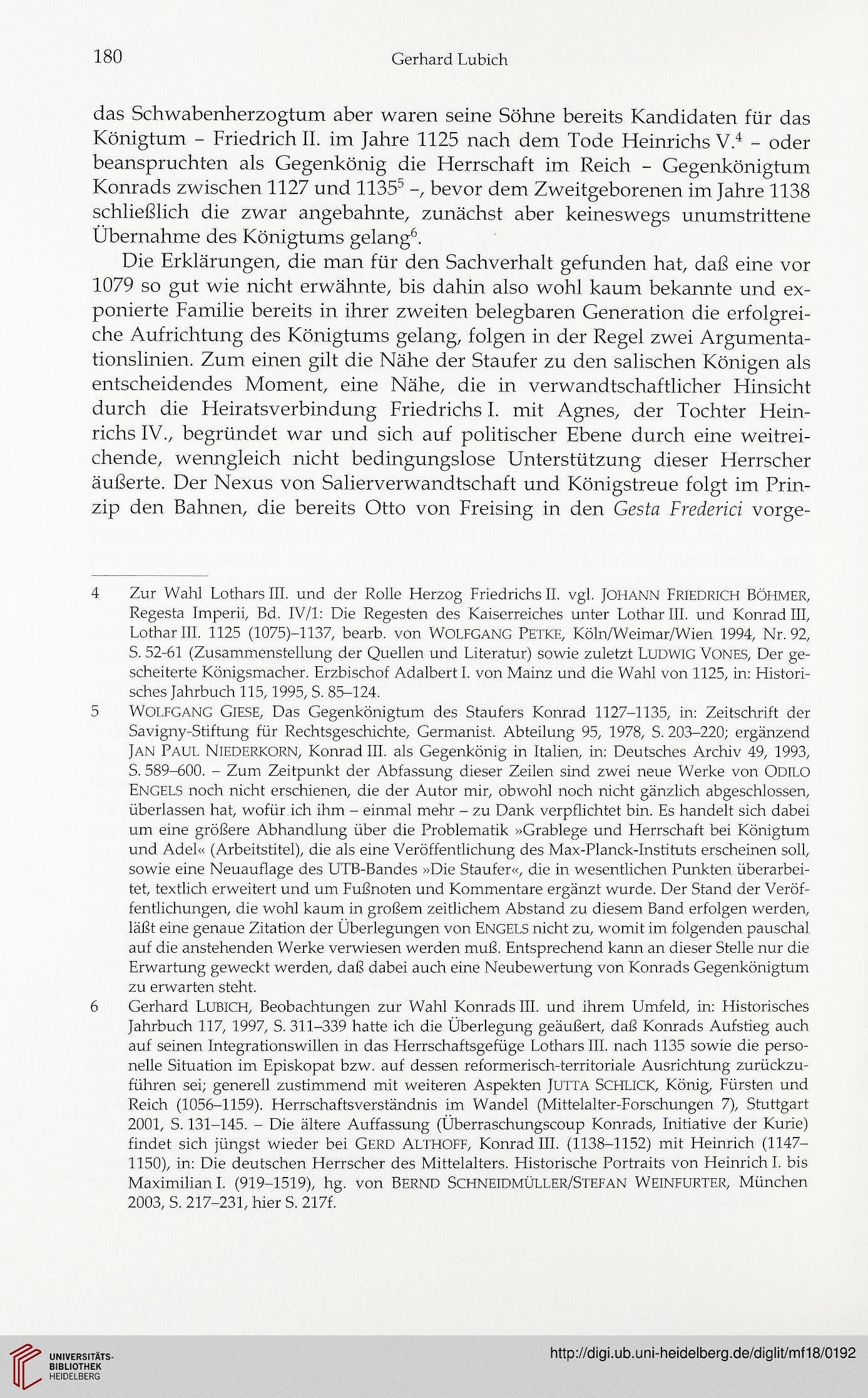180
Gerhard Lubich
das Schwabenherzogtum aber waren seine Söhne bereits Kandidaten für das
Königtum - Friedrich II. im Jahre 1125 nach dem Tode Heinrichs V.4 - oder
beanspruchten als Gegenkönig die Herrschaft im Reich - Gegenkönigtum
Konrads zwischen 1127 und 11355 -, bevor dem Zweitgeborenen im Jahre 1138
schließlich die zwar angebahnte, zunächst aber keineswegs unumstrittene
Übernahme des Königtums gelang6.
Die Erklärungen, die man für den Sachverhalt gefunden hat, daß eine vor
1079 so gut wie nicht erwähnte, bis dahin also wohl kaum bekannte und ex-
ponierte Familie bereits in ihrer zweiten belegbaren Generation die erfolgrei-
che Aufrichtung des Königtums gelang, folgen in der Regel zwei Argumenta-
tionslinien. Zum einen gilt die Nähe der Staufer zu den salischen Königen als
entscheidendes Moment, eine Nähe, die in verwandtschaftlicher Hinsicht
durch die Heiratsverbindung Friedrichs I. mit Agnes, der Tochter Hein-
richs IV., begründet war und sich auf politischer Ebene durch eine weitrei-
chende, wenngleich nicht bedingungslose Unterstützung dieser Herrscher
äußerte. Der Nexus von Salierverwandtschaft und Königstreue folgt im Prin-
zip den Bahnen, die bereits Otto von Freising in den Gesta Frederici vorge-
4 Zur Wahl Lothars III. und der Rolle Herzog Friedrichs II. vgl. JOHANN FRIEDRICH BÖHMER,
Regesta Imperii, Bd. IV/1: Die Regesten des Kaiserreiches unter Lothar III. und Konrad III,
Lothar III. 1125 (1075)—1137, bearb. von WOLFGANG PETKE, Köln/Weimar/Wien 1994, Nr. 92,
S. 52-61 (Zusammenstellung der Quellen und Literatur) sowie zuletzt LUDWIG VONES, Der ge-
scheiterte Königsmacher. Erzbischof Adalbert I. von Mainz und die Wahl von 1125, in: Histori-
sches Jahrbuch 115,1995, S. 85-124.
5 WOLFGANG Giese, Das Gegenkönigtum des Staufers Konrad 1127-1135, in: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abteilung 95, 1978, S. 203-220; ergänzend
JAN Paul Niederkorn, Konrad III. als Gegenkönig in Italien, in: Deutsches Archiv 49, 1993,
S. 589-600. - Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Zeilen sind zwei neue Werke von ODILO
ENGELS noch nicht erschienen, die der Autor mir, obwohl noch nicht gänzlich abgeschlossen,
überlassen hat, wofür ich ihm - einmal mehr - zu Dank verpflichtet bin. Es handelt sich dabei
um eine größere Abhandlung über die Problematik »Grablege und Herrschaft bei Königtum
und Adel« (Arbeitsütel), die als eine Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts erscheinen soll,
sowie eine Neuauflage des UTB-Bandes »Die Staufer«, die in wesentlichen Punkten überarbei-
tet, textlich erweitert und um Fußnoten und Kommentare ergänzt wurde. Der Stand der Veröf-
fentlichungen, die wohl kaum in großem zeitlichem Abstand zu diesem Band erfolgen werden,
läßt eine genaue Zitation der Überlegungen von ENGELS nicht zu, womit im folgenden pauschal
auf die anstehenden Werke verwiesen werden muß. Entsprechend kann an dieser Stelle nur die
Erwartung geweckt werden, daß dabei auch eine Neubewertung von Konrads Gegenkönigtum
zu erwarten steht.
6 Gerhard LUBICH, Beobachtungen zur Wahl Konrads III. und ihrem Umfeld, in: Historisches
Jahrbuch 117, 1997, S. 311-339 hatte ich die Überlegung geäußert, daß Konrads Aufstieg auch
auf seinen Integrationswillen in das Herrschaftsgefüge Lothars III. nach 1135 sowie die perso-
nelle Situation im Episkopat bzw. auf dessen reformerisch-territoriale Ausrichtung zurückzu-
führen sei; generell zustimmend mit weiteren Aspekten JUTTA SCHLICK, König, Fürsten und
Reich (1056-1159). Herrschaftsverständnis im Wandel (Mittelalter-Forschungen 7), Stuttgart
2001, S. 131-145. - Die ältere Auffassung (Überraschungscoup Konrads, Initiative der Kurie)
findet sich jüngst wieder bei GERD ALTHOFF, Konrad III. (1138-1152) mit Heinrich (1147-
1150), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis
Maximilian I. (919-1519), hg. von Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter, München
2003, S. 217-231, hier S. 217f.
Gerhard Lubich
das Schwabenherzogtum aber waren seine Söhne bereits Kandidaten für das
Königtum - Friedrich II. im Jahre 1125 nach dem Tode Heinrichs V.4 - oder
beanspruchten als Gegenkönig die Herrschaft im Reich - Gegenkönigtum
Konrads zwischen 1127 und 11355 -, bevor dem Zweitgeborenen im Jahre 1138
schließlich die zwar angebahnte, zunächst aber keineswegs unumstrittene
Übernahme des Königtums gelang6.
Die Erklärungen, die man für den Sachverhalt gefunden hat, daß eine vor
1079 so gut wie nicht erwähnte, bis dahin also wohl kaum bekannte und ex-
ponierte Familie bereits in ihrer zweiten belegbaren Generation die erfolgrei-
che Aufrichtung des Königtums gelang, folgen in der Regel zwei Argumenta-
tionslinien. Zum einen gilt die Nähe der Staufer zu den salischen Königen als
entscheidendes Moment, eine Nähe, die in verwandtschaftlicher Hinsicht
durch die Heiratsverbindung Friedrichs I. mit Agnes, der Tochter Hein-
richs IV., begründet war und sich auf politischer Ebene durch eine weitrei-
chende, wenngleich nicht bedingungslose Unterstützung dieser Herrscher
äußerte. Der Nexus von Salierverwandtschaft und Königstreue folgt im Prin-
zip den Bahnen, die bereits Otto von Freising in den Gesta Frederici vorge-
4 Zur Wahl Lothars III. und der Rolle Herzog Friedrichs II. vgl. JOHANN FRIEDRICH BÖHMER,
Regesta Imperii, Bd. IV/1: Die Regesten des Kaiserreiches unter Lothar III. und Konrad III,
Lothar III. 1125 (1075)—1137, bearb. von WOLFGANG PETKE, Köln/Weimar/Wien 1994, Nr. 92,
S. 52-61 (Zusammenstellung der Quellen und Literatur) sowie zuletzt LUDWIG VONES, Der ge-
scheiterte Königsmacher. Erzbischof Adalbert I. von Mainz und die Wahl von 1125, in: Histori-
sches Jahrbuch 115,1995, S. 85-124.
5 WOLFGANG Giese, Das Gegenkönigtum des Staufers Konrad 1127-1135, in: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abteilung 95, 1978, S. 203-220; ergänzend
JAN Paul Niederkorn, Konrad III. als Gegenkönig in Italien, in: Deutsches Archiv 49, 1993,
S. 589-600. - Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Zeilen sind zwei neue Werke von ODILO
ENGELS noch nicht erschienen, die der Autor mir, obwohl noch nicht gänzlich abgeschlossen,
überlassen hat, wofür ich ihm - einmal mehr - zu Dank verpflichtet bin. Es handelt sich dabei
um eine größere Abhandlung über die Problematik »Grablege und Herrschaft bei Königtum
und Adel« (Arbeitsütel), die als eine Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts erscheinen soll,
sowie eine Neuauflage des UTB-Bandes »Die Staufer«, die in wesentlichen Punkten überarbei-
tet, textlich erweitert und um Fußnoten und Kommentare ergänzt wurde. Der Stand der Veröf-
fentlichungen, die wohl kaum in großem zeitlichem Abstand zu diesem Band erfolgen werden,
läßt eine genaue Zitation der Überlegungen von ENGELS nicht zu, womit im folgenden pauschal
auf die anstehenden Werke verwiesen werden muß. Entsprechend kann an dieser Stelle nur die
Erwartung geweckt werden, daß dabei auch eine Neubewertung von Konrads Gegenkönigtum
zu erwarten steht.
6 Gerhard LUBICH, Beobachtungen zur Wahl Konrads III. und ihrem Umfeld, in: Historisches
Jahrbuch 117, 1997, S. 311-339 hatte ich die Überlegung geäußert, daß Konrads Aufstieg auch
auf seinen Integrationswillen in das Herrschaftsgefüge Lothars III. nach 1135 sowie die perso-
nelle Situation im Episkopat bzw. auf dessen reformerisch-territoriale Ausrichtung zurückzu-
führen sei; generell zustimmend mit weiteren Aspekten JUTTA SCHLICK, König, Fürsten und
Reich (1056-1159). Herrschaftsverständnis im Wandel (Mittelalter-Forschungen 7), Stuttgart
2001, S. 131-145. - Die ältere Auffassung (Überraschungscoup Konrads, Initiative der Kurie)
findet sich jüngst wieder bei GERD ALTHOFF, Konrad III. (1138-1152) mit Heinrich (1147-
1150), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis
Maximilian I. (919-1519), hg. von Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter, München
2003, S. 217-231, hier S. 217f.