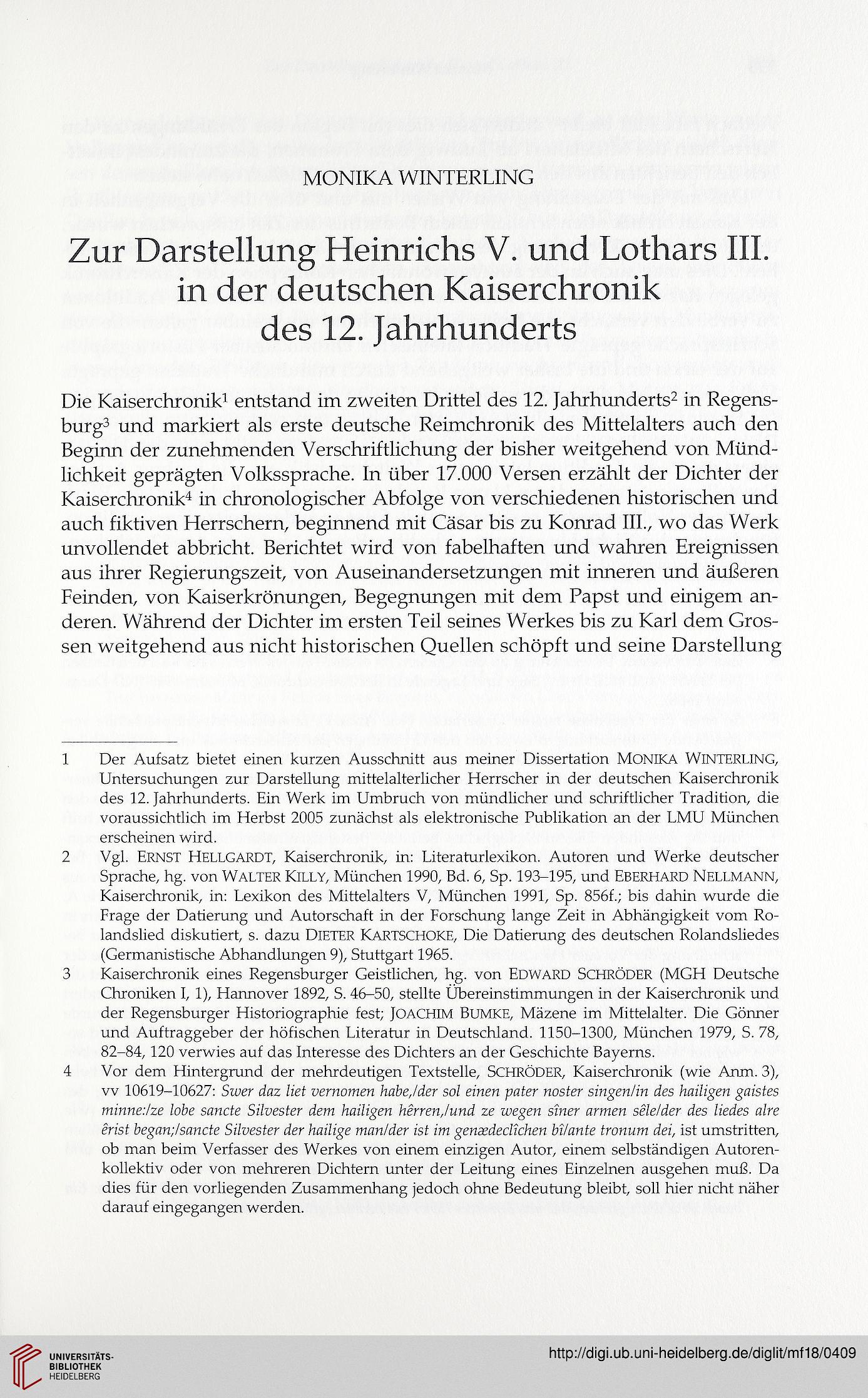MONIKA WINTERLING
Zur Darstellung Heinrichs V. und Lothars III.
in der deutschen Kaiserchronik
des 12. Jahrhunderts
Die Kaiserchronik1 entstand im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts2 in Regens-
burg3 und markiert als erste deutsche Reimchronik des Mittelalters auch den
Beginn der zunehmenden Verschriftlichung der bisher weitgehend von Münd-
lichkeit geprägten Volkssprache. In über 17.000 Versen erzählt der Dichter der
Kaiserchronik4 in chronologischer Abfolge von verschiedenen historischen und
auch fiktiven Herrschern, beginnend mit Cäsar bis zu Konrad III., wo das Werk
unvollendet abbricht. Berichtet wird von fabelhaften und wahren Ereignissen
aus ihrer Regierungszeit, von Auseinandersetzungen mit inneren und äußeren
Feinden, von Kaiserkrönungen, Begegnungen mit dem Papst und einigem an-
deren. Während der Dichter im ersten Teil seines Werkes bis zu Karl dem Gros-
sen weitgehend aus nicht historischen Quellen schöpft und seine Darstellung
1 Der Aufsatz bietet einen kurzen Ausschnitt aus meiner Dissertation MONIKA WINTERLING,
Untersuchungen zur Darstellung mittelalterlicher Herrscher in der deutschen Kaiserchronik
des 12. Jahrhunderts. Ein Werk im Umbruch von mündlicher und schriftlicher Tradition, die
voraussichtlich im Herbst 2005 zunächst als elektronische Publikation an der LMU München
erscheinen wird.
2 Vgl. ERNST Hellgardt, Kaiserchronik, in: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher
Sprache, hg. von Walter Killy, München 1990, Bd. 6, Sp. 193-195, und EBERHARD NELLMANN,
Kaiserchronik, in: Lexikon des Mittelalters V, München 1991, Sp. 856f.; bis dahin wurde die
Frage der Datierung und Autorschaft in der Forschung lange Zeit in Abhängigkeit vom Ro-
landslied diskutiert, s. dazu Dieter KARTSCHOKE, Die Datierung des deutschen Rolandsliedes
(Germanistische Abhandlungen 9), Stuttgart 1965.
3 Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen, hg. von EDWARD SCHRÖDER (MGH Deutsche
Chroniken I, 1), Hannover 1892, S. 46-50, stellte Übereinstimmungen in der Kaiserchronik und
der Regensburger Historiographie fest; JOACHIM Bumke, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner
und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland. 1150-1300, München 1979, S. 78,
82-84,120 verwies auf das Interesse des Dichters an der Geschichte Bayerns.
4 Vor dem Hintergrund der mehrdeutigen Textstelle, SCHRÖDER, Kaiserchronik (wie Anm. 3),
vv 10619-10627: Swer daz lief vernomen habe,/der sol einen pater noster singen/in des hailigen gaistes
minnedze lobe sancte Silvester dem hailigen Herren,/und ze wegen siner armen sele/der des liedes alre
erist began;/sancte Silvester der hailige man!der ist im genaedeclichen bi/ante tronum dei, ist umstritten,
ob man beim Verfasser des Werkes von einem einzigen Autor, einem selbständigen Autoren-
kollektiv oder von mehreren Dichtern unter der Leitung eines Einzelnen ausgehen muß. Da
dies für den vorliegenden Zusammenhang jedoch ohne Bedeutung bleibt, soll hier nicht näher
darauf eingegangen werden.
Zur Darstellung Heinrichs V. und Lothars III.
in der deutschen Kaiserchronik
des 12. Jahrhunderts
Die Kaiserchronik1 entstand im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts2 in Regens-
burg3 und markiert als erste deutsche Reimchronik des Mittelalters auch den
Beginn der zunehmenden Verschriftlichung der bisher weitgehend von Münd-
lichkeit geprägten Volkssprache. In über 17.000 Versen erzählt der Dichter der
Kaiserchronik4 in chronologischer Abfolge von verschiedenen historischen und
auch fiktiven Herrschern, beginnend mit Cäsar bis zu Konrad III., wo das Werk
unvollendet abbricht. Berichtet wird von fabelhaften und wahren Ereignissen
aus ihrer Regierungszeit, von Auseinandersetzungen mit inneren und äußeren
Feinden, von Kaiserkrönungen, Begegnungen mit dem Papst und einigem an-
deren. Während der Dichter im ersten Teil seines Werkes bis zu Karl dem Gros-
sen weitgehend aus nicht historischen Quellen schöpft und seine Darstellung
1 Der Aufsatz bietet einen kurzen Ausschnitt aus meiner Dissertation MONIKA WINTERLING,
Untersuchungen zur Darstellung mittelalterlicher Herrscher in der deutschen Kaiserchronik
des 12. Jahrhunderts. Ein Werk im Umbruch von mündlicher und schriftlicher Tradition, die
voraussichtlich im Herbst 2005 zunächst als elektronische Publikation an der LMU München
erscheinen wird.
2 Vgl. ERNST Hellgardt, Kaiserchronik, in: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher
Sprache, hg. von Walter Killy, München 1990, Bd. 6, Sp. 193-195, und EBERHARD NELLMANN,
Kaiserchronik, in: Lexikon des Mittelalters V, München 1991, Sp. 856f.; bis dahin wurde die
Frage der Datierung und Autorschaft in der Forschung lange Zeit in Abhängigkeit vom Ro-
landslied diskutiert, s. dazu Dieter KARTSCHOKE, Die Datierung des deutschen Rolandsliedes
(Germanistische Abhandlungen 9), Stuttgart 1965.
3 Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen, hg. von EDWARD SCHRÖDER (MGH Deutsche
Chroniken I, 1), Hannover 1892, S. 46-50, stellte Übereinstimmungen in der Kaiserchronik und
der Regensburger Historiographie fest; JOACHIM Bumke, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner
und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland. 1150-1300, München 1979, S. 78,
82-84,120 verwies auf das Interesse des Dichters an der Geschichte Bayerns.
4 Vor dem Hintergrund der mehrdeutigen Textstelle, SCHRÖDER, Kaiserchronik (wie Anm. 3),
vv 10619-10627: Swer daz lief vernomen habe,/der sol einen pater noster singen/in des hailigen gaistes
minnedze lobe sancte Silvester dem hailigen Herren,/und ze wegen siner armen sele/der des liedes alre
erist began;/sancte Silvester der hailige man!der ist im genaedeclichen bi/ante tronum dei, ist umstritten,
ob man beim Verfasser des Werkes von einem einzigen Autor, einem selbständigen Autoren-
kollektiv oder von mehreren Dichtern unter der Leitung eines Einzelnen ausgehen muß. Da
dies für den vorliegenden Zusammenhang jedoch ohne Bedeutung bleibt, soll hier nicht näher
darauf eingegangen werden.