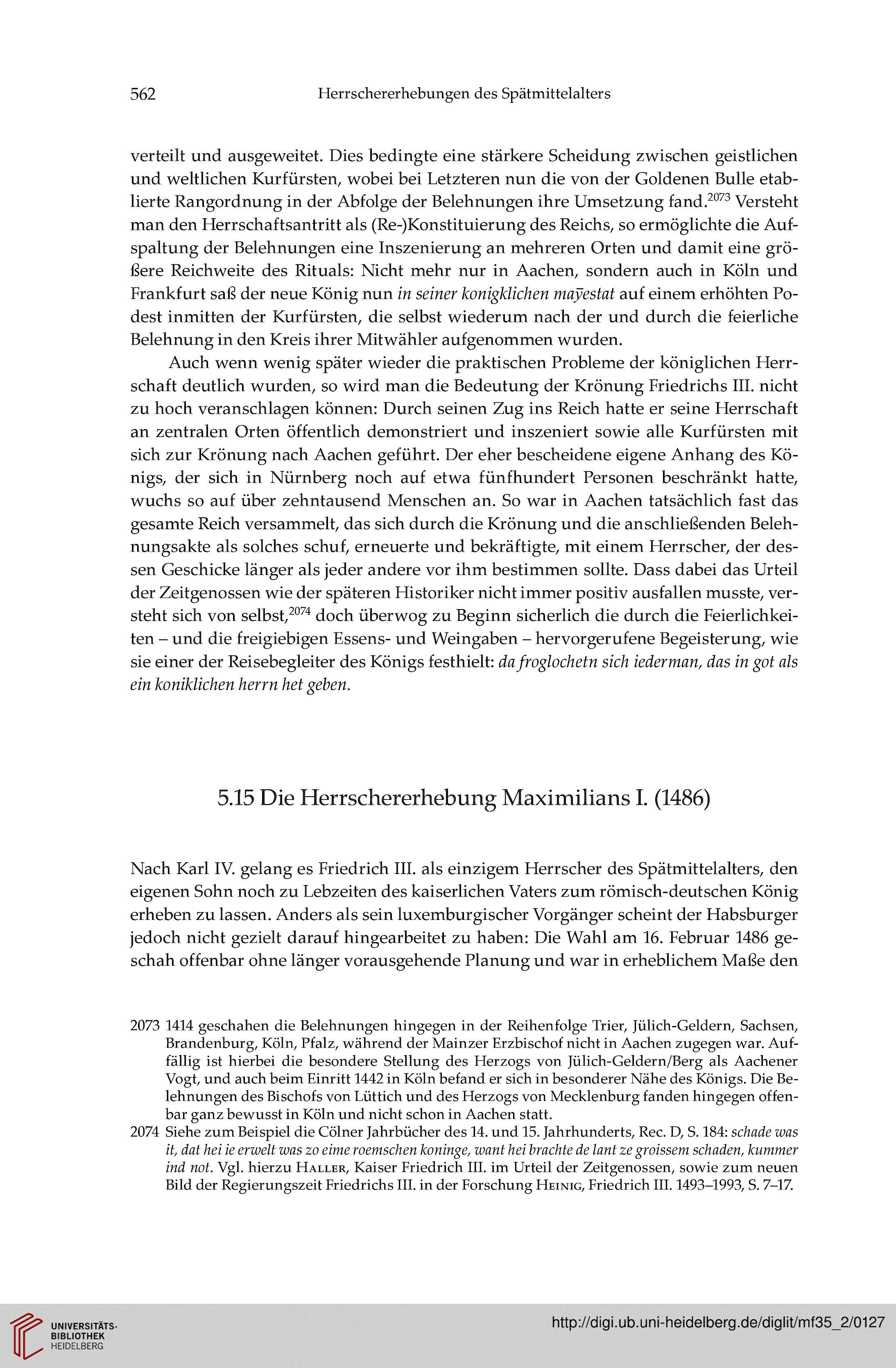562
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
verteilt und ausgeweitet. Dies bedingte eine stärkere Scheidung zwischen geistlichen
und weltlichen Kurfürsten, wobei bei Letzteren nun die von der Goldenen Bulle etab-
lierte Rangordnung in der Abfolge der Belehnungen ihre Umsetzung fand Versteht
man den Herrschaftsantritt als (Re-)Konstituierung des Reichs, so ermöglichte die Auf-
spaltung der Belehnungen eine Inszenierung an mehreren Orten und damit eine grö-
ßere Reichweite des Rituals: Nicht mehr nur in Aachen, sondern auch in Köln und
Frankfurt saß der neue König nun in seiner iconigidici?en nMveshü auf einem erhöhten Po-
dest inmitten der Kurfürsten, die selbst wiederum nach der und durch die feierliche
Belehnung in den Kreis ihrer Mitwähler aufgenommen wurden.
Auch wenn wenig später wieder die praktischen Probleme der königlichen Herr-
schaft deutlich wurden, so wird man die Bedeutung der Krönung Friedrichs III. nicht
zu hoch veranschlagen können: Durch seinen Zug ins Reich hatte er seine Herrschaft
an zentralen Orten öffentlich demonstriert und inszeniert sowie alle Kurfürsten mit
sich zur Krönung nach Aachen geführt. Der eher bescheidene eigene Anhang des Kö-
nigs, der sich in Nürnberg noch auf etwa fünfhundert Personen beschränkt hatte,
wuchs so auf über zehntausend Menschen an. So war in Aachen tatsächlich fast das
gesamte Reich versammelt, das sich durch die Krönung und die anschließenden Beleh-
nungsakte als solches schuf, erneuerte und bekräftigte, mit einem Herrscher, der des-
sen Geschicke länger als jeder andere vor ihm bestimmen sollte. Dass dabei das Urteil
der Zeitgenossen wie der späteren Historiker nicht immer positiv ausfallen musste, ver-
steht sich von selbst/"^ doch überwog zu Beginn sicherlich die durch die Feierlichkei-
ten - und die freigiebigen Essens- und Weingaben - hervorgerufene Begeisterung, wie
sie einer der Reisebegleiter des Königs festhielt: da/n%IoclzHü szclz zederzTMü, das z'zz als
cz'zz /(ozzz'/dz'rdczz dczvzz dH ^cdczz.
5.15 Die Herrschererhebung Maximilians I. (1486)
Nach Karl IV. gelang es Friedrich III. als einzigem Herrscher des Spätmittelalters, den
eigenen Sohn noch zu Lebzeiten des kaiserlichen Vaters zum römisch-deutschen König
erheben zu lassen. Anders als sein luxemburgischer Vorgänger scheint der Habsburger
jedoch nicht gezielt darauf hingearbeitet zu haben: Die Wahl am 16. Februar 1486 ge-
schah offenbar ohne länger vorausgehende Planung und war in erheblichem Maße den
2073 1414 geschahen die Belehnungen hingegen in der Reihenfolge Trier, Jülich-Geldern, Sachsen,
Brandenburg, Köln, Pfalz, während der Mainzer Erzbischof nicht in Aachen zugegen war. Auf-
fällig ist hierbei die besondere Stellung des Herzogs von Jülich-Geldern/Berg als Aachener
Vogt, und auch beim Einritt 1442 in Köln befand er sich in besonderer Nähe des Königs. Die Be-
lehnungen des Bischofs von Lüttich und des Herzogs von Mecklenburg fanden hingegen offen-
bar ganz bewusst in Köln und nicht schon in Aachen statt.
2074 Siehe zum Beispiel die Cölner Jahrbücher des 14. und 15. Jahrhunderts, Rec. D, S. 184: sc/mA was
zf, Ad Az z'e crwcd was zo cz'zzzc roezzzscAzz Azzz'zzge, wazzf Az AacAe A lauf ze gzuz'ssezzz sc/za Azz, Azzzzzzzez*
Ad zzof. Vgl. hierzu HALLER, Kaiser Friedrich III. im Urteil der Zeitgenossen, sowie zum neuen
Bild der Regierungszeit Friedrichs III. in der Forschung lüiNiG, Friedrich III. 1493-1993, S. 7-17.
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
verteilt und ausgeweitet. Dies bedingte eine stärkere Scheidung zwischen geistlichen
und weltlichen Kurfürsten, wobei bei Letzteren nun die von der Goldenen Bulle etab-
lierte Rangordnung in der Abfolge der Belehnungen ihre Umsetzung fand Versteht
man den Herrschaftsantritt als (Re-)Konstituierung des Reichs, so ermöglichte die Auf-
spaltung der Belehnungen eine Inszenierung an mehreren Orten und damit eine grö-
ßere Reichweite des Rituals: Nicht mehr nur in Aachen, sondern auch in Köln und
Frankfurt saß der neue König nun in seiner iconigidici?en nMveshü auf einem erhöhten Po-
dest inmitten der Kurfürsten, die selbst wiederum nach der und durch die feierliche
Belehnung in den Kreis ihrer Mitwähler aufgenommen wurden.
Auch wenn wenig später wieder die praktischen Probleme der königlichen Herr-
schaft deutlich wurden, so wird man die Bedeutung der Krönung Friedrichs III. nicht
zu hoch veranschlagen können: Durch seinen Zug ins Reich hatte er seine Herrschaft
an zentralen Orten öffentlich demonstriert und inszeniert sowie alle Kurfürsten mit
sich zur Krönung nach Aachen geführt. Der eher bescheidene eigene Anhang des Kö-
nigs, der sich in Nürnberg noch auf etwa fünfhundert Personen beschränkt hatte,
wuchs so auf über zehntausend Menschen an. So war in Aachen tatsächlich fast das
gesamte Reich versammelt, das sich durch die Krönung und die anschließenden Beleh-
nungsakte als solches schuf, erneuerte und bekräftigte, mit einem Herrscher, der des-
sen Geschicke länger als jeder andere vor ihm bestimmen sollte. Dass dabei das Urteil
der Zeitgenossen wie der späteren Historiker nicht immer positiv ausfallen musste, ver-
steht sich von selbst/"^ doch überwog zu Beginn sicherlich die durch die Feierlichkei-
ten - und die freigiebigen Essens- und Weingaben - hervorgerufene Begeisterung, wie
sie einer der Reisebegleiter des Königs festhielt: da/n%IoclzHü szclz zederzTMü, das z'zz als
cz'zz /(ozzz'/dz'rdczz dczvzz dH ^cdczz.
5.15 Die Herrschererhebung Maximilians I. (1486)
Nach Karl IV. gelang es Friedrich III. als einzigem Herrscher des Spätmittelalters, den
eigenen Sohn noch zu Lebzeiten des kaiserlichen Vaters zum römisch-deutschen König
erheben zu lassen. Anders als sein luxemburgischer Vorgänger scheint der Habsburger
jedoch nicht gezielt darauf hingearbeitet zu haben: Die Wahl am 16. Februar 1486 ge-
schah offenbar ohne länger vorausgehende Planung und war in erheblichem Maße den
2073 1414 geschahen die Belehnungen hingegen in der Reihenfolge Trier, Jülich-Geldern, Sachsen,
Brandenburg, Köln, Pfalz, während der Mainzer Erzbischof nicht in Aachen zugegen war. Auf-
fällig ist hierbei die besondere Stellung des Herzogs von Jülich-Geldern/Berg als Aachener
Vogt, und auch beim Einritt 1442 in Köln befand er sich in besonderer Nähe des Königs. Die Be-
lehnungen des Bischofs von Lüttich und des Herzogs von Mecklenburg fanden hingegen offen-
bar ganz bewusst in Köln und nicht schon in Aachen statt.
2074 Siehe zum Beispiel die Cölner Jahrbücher des 14. und 15. Jahrhunderts, Rec. D, S. 184: sc/mA was
zf, Ad Az z'e crwcd was zo cz'zzzc roezzzscAzz Azzz'zzge, wazzf Az AacAe A lauf ze gzuz'ssezzz sc/za Azz, Azzzzzzzez*
Ad zzof. Vgl. hierzu HALLER, Kaiser Friedrich III. im Urteil der Zeitgenossen, sowie zum neuen
Bild der Regierungszeit Friedrichs III. in der Forschung lüiNiG, Friedrich III. 1493-1993, S. 7-17.