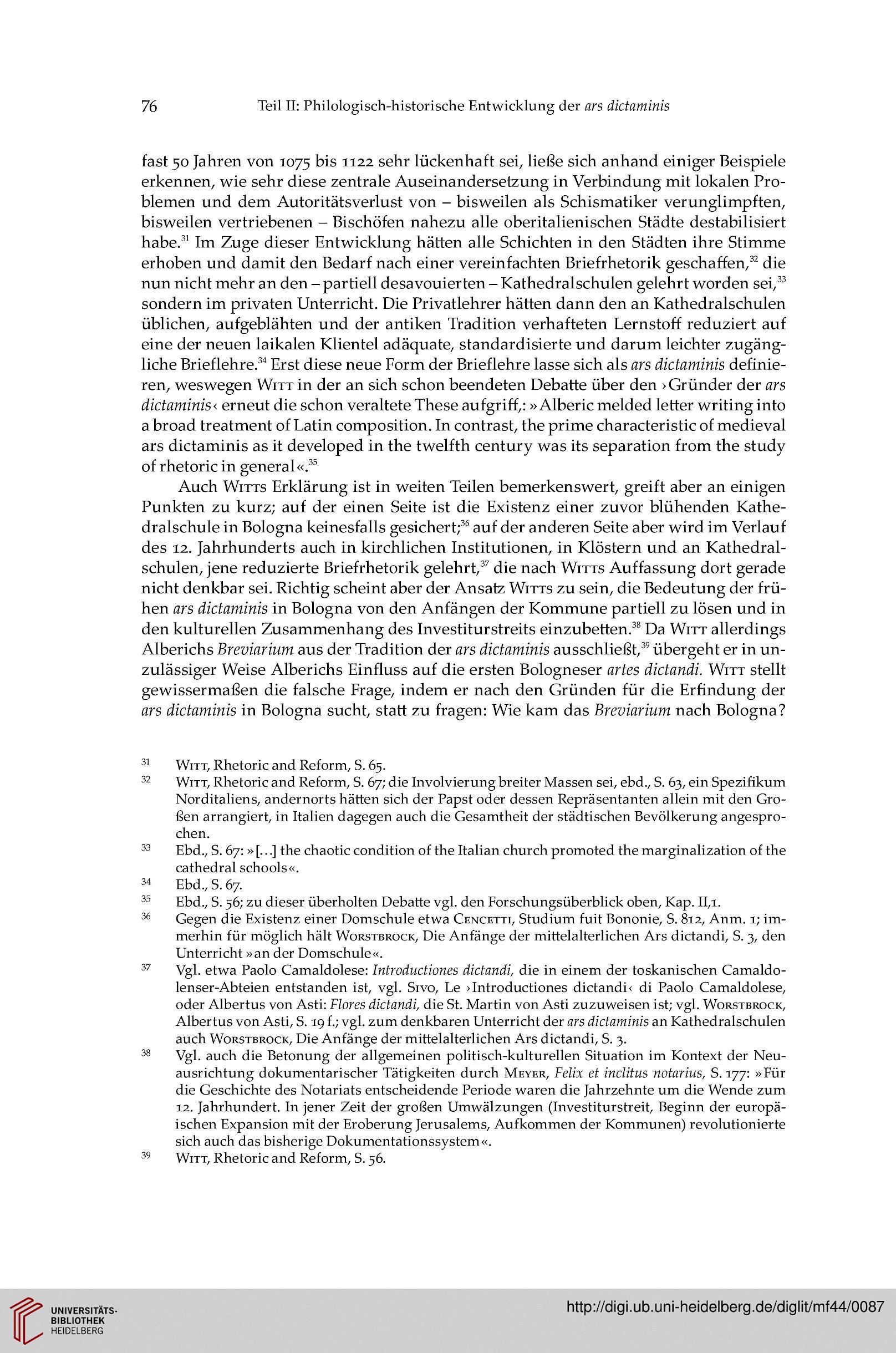76
Teil II: Philologisch-historische Entwicklung der ars dz'Uzzzzzz'zzz's
fast Jahren von 1075 bis 1122 sehr lückenhaft sek ließe sich anhand einiger Beispiele
erkennen, wie sehr diese zentrale Auseinandersetzung in Verbindung mit lokalen Pro-
blemen und dem Autoritätsverlust von - bisweilen als Schismatiker verunglimpften,
bisweilen vertriebenen - Bischöfen nahezu alle oberitalienischen Städte destabilisiert
habe. ' Im Zuge dieser Entwicklung hätten alle Schichten in den Städten ihre Stimme
erhoben und damit den Bedarf nach einer vereinfachten Briefrhetorik geschaffen,^ die
nun nicht mehr an den - partiell desavouierten - Kathedralschulen gelehrt worden sei,
sondern im privaten Unterricht. Die Privatlehrer hätten dann den an Kathedralschulen
üblichen, aufgeblähten und der antiken Tradition verhafteten Lernstoff reduziert auf
eine der neuen laikalen Klientel adäquate, standardisierte und darum leichter zugäng-
liche BrieflehreA Erst diese neue Form der Brieflehre lasse sich als ars dzcfamznzs definie-
ren, weswegen WiTT in der an sich schon beendeten Debatte über den > Gründer der ars
dzcfawmzs< erneut die schon veraltete These aufgriff,: » Alberic melded letter writing into
a broad treatment of Latin composition. In contrast, the prime characteristic of medieval
ars dictaminis as it developed in the twelfth Century was its Separation from the study
of rhetoric in general« A
Auch WiTTs Erklärung ist in weiten Teilen bemerkenswert, greift aber an einigen
Punkten zu kurz; auf der einen Seite ist die Existenz einer zuvor blühenden Kathe-
dralschule in Bologna keinesfalls gesichert;^ auf der anderen Seite aber wird im Verlauf
des 12. Jahrhunderts auch in kirchlichen Institutionen, in Klöstern und an Kathedral-
schulen, jene reduzierte Briefrhetorik gelehrt, ^ die nach WiTTs Auffassung dort gerade
nicht denkbar sei. Richtig scheint aber der Ansatz WiTTs zu sein, die Bedeutung der frü-
hen ars dzcfamznzs in Bologna von den Anfängen der Kommune partiell zu lösen und in
den kulturellen Zusammenhang des Investiturstreits einzubetten. ' Da WiTT allerdings
Alberichs Brcuz'arz'nzrz aus der Tradition der ars dzcfamznzs ausschließt/'' übergeht er in un-
zulässiger Weise Alberichs Einfluss auf die ersten Bologneser arfes dzcfandz. WiTT stellt
gewissermaßen die falsche Frage, indem er nach den Gründen für die Erfindung der
ars dzcfamznzs in Bologna sucht, statt zu fragen: Wie kam das Breuzarznw nach Bologna?
31 Wn i, Rhetoric and Reform, S. 65.
32 WiTT, Rhetoric and Reform, S. 67; die Involvierung breiter Massen sei, ebd., S. 6ß, ein Spezifikum
Norditaliens, andernorts hätten sich der Papst oder dessen Repräsentanten allein mit den Gro-
ßen arrangiert, in Italien dagegen auch die Gesamtheit der städtischen Bevölkerung angespro-
chen.
33 Ebd., S. 67: »[...] the chaotic condition of the Italian church promoted the marginalization of the
cathedral schools«.
34 Ebd., S. 67.
33 Ebd., S. 56; zu dieser überholten Debatte vgl. den Forschungsüberblick oben, Kap. II,i.
3-' Gegen die Existenz einer Domschule etwa CENCETTi, Studium fuit Bononie, S. 812, Anm. 1; im-
merhin für möglich hält WoRSTBRoex, Die Anfänge der mittelalterlichen Ars dictandi, S. ß, den
Unterricht »an der Domschule«.
33 Vgl. etwa Paolo Camaldolese: fzzfrodacfz'ozzos dz'cfazzdz, die in einem der toskanischen Camaldo-
lenser-Abteien entstanden ist, vgl. Sivo, Le Tntroductiones dictandi< di Paolo Camaldolese,
oder Albertus von Asti: Flores dz'cfazzdz, die St. Martin von Asti zuzuweisen ist; vgl. WoRSTBRoex,
Albertus von Asti, S. 19 f.; vgl. zum denkbaren Unterricht der ars dz'cfazzzz'zzz's an Kathedralschulen
auch WoRSTBRoex, Die Anfänge der mittelalterlichen Ars dictandi, S. ß.
33 Vgl. auch die Betonung der allgemeinen politisch-kulturellen Situation im Kontext der Neu-
ausrichtung dokumentarischer Tätigkeiten durch MEYER, FUz'x U z'zzcizfas zzofarz'as, S. 177: »Für
die Geschichte des Notariats entscheidende Periode waren die Jahrzehnte um die Wende zum
12. Jahrhundert. In jener Zeit der großen Umwälzungen (Investiturstreit, Beginn der europä-
ischen Expansion mit der Eroberung Jerusalems, Aufkommen der Kommunen) revolutionierte
sich auch das bisherige Dokumentationssystem«.
39 WiTT, Rhetoric and Reform, S. 56.
Teil II: Philologisch-historische Entwicklung der ars dz'Uzzzzzz'zzz's
fast Jahren von 1075 bis 1122 sehr lückenhaft sek ließe sich anhand einiger Beispiele
erkennen, wie sehr diese zentrale Auseinandersetzung in Verbindung mit lokalen Pro-
blemen und dem Autoritätsverlust von - bisweilen als Schismatiker verunglimpften,
bisweilen vertriebenen - Bischöfen nahezu alle oberitalienischen Städte destabilisiert
habe. ' Im Zuge dieser Entwicklung hätten alle Schichten in den Städten ihre Stimme
erhoben und damit den Bedarf nach einer vereinfachten Briefrhetorik geschaffen,^ die
nun nicht mehr an den - partiell desavouierten - Kathedralschulen gelehrt worden sei,
sondern im privaten Unterricht. Die Privatlehrer hätten dann den an Kathedralschulen
üblichen, aufgeblähten und der antiken Tradition verhafteten Lernstoff reduziert auf
eine der neuen laikalen Klientel adäquate, standardisierte und darum leichter zugäng-
liche BrieflehreA Erst diese neue Form der Brieflehre lasse sich als ars dzcfamznzs definie-
ren, weswegen WiTT in der an sich schon beendeten Debatte über den > Gründer der ars
dzcfawmzs< erneut die schon veraltete These aufgriff,: » Alberic melded letter writing into
a broad treatment of Latin composition. In contrast, the prime characteristic of medieval
ars dictaminis as it developed in the twelfth Century was its Separation from the study
of rhetoric in general« A
Auch WiTTs Erklärung ist in weiten Teilen bemerkenswert, greift aber an einigen
Punkten zu kurz; auf der einen Seite ist die Existenz einer zuvor blühenden Kathe-
dralschule in Bologna keinesfalls gesichert;^ auf der anderen Seite aber wird im Verlauf
des 12. Jahrhunderts auch in kirchlichen Institutionen, in Klöstern und an Kathedral-
schulen, jene reduzierte Briefrhetorik gelehrt, ^ die nach WiTTs Auffassung dort gerade
nicht denkbar sei. Richtig scheint aber der Ansatz WiTTs zu sein, die Bedeutung der frü-
hen ars dzcfamznzs in Bologna von den Anfängen der Kommune partiell zu lösen und in
den kulturellen Zusammenhang des Investiturstreits einzubetten. ' Da WiTT allerdings
Alberichs Brcuz'arz'nzrz aus der Tradition der ars dzcfamznzs ausschließt/'' übergeht er in un-
zulässiger Weise Alberichs Einfluss auf die ersten Bologneser arfes dzcfandz. WiTT stellt
gewissermaßen die falsche Frage, indem er nach den Gründen für die Erfindung der
ars dzcfamznzs in Bologna sucht, statt zu fragen: Wie kam das Breuzarznw nach Bologna?
31 Wn i, Rhetoric and Reform, S. 65.
32 WiTT, Rhetoric and Reform, S. 67; die Involvierung breiter Massen sei, ebd., S. 6ß, ein Spezifikum
Norditaliens, andernorts hätten sich der Papst oder dessen Repräsentanten allein mit den Gro-
ßen arrangiert, in Italien dagegen auch die Gesamtheit der städtischen Bevölkerung angespro-
chen.
33 Ebd., S. 67: »[...] the chaotic condition of the Italian church promoted the marginalization of the
cathedral schools«.
34 Ebd., S. 67.
33 Ebd., S. 56; zu dieser überholten Debatte vgl. den Forschungsüberblick oben, Kap. II,i.
3-' Gegen die Existenz einer Domschule etwa CENCETTi, Studium fuit Bononie, S. 812, Anm. 1; im-
merhin für möglich hält WoRSTBRoex, Die Anfänge der mittelalterlichen Ars dictandi, S. ß, den
Unterricht »an der Domschule«.
33 Vgl. etwa Paolo Camaldolese: fzzfrodacfz'ozzos dz'cfazzdz, die in einem der toskanischen Camaldo-
lenser-Abteien entstanden ist, vgl. Sivo, Le Tntroductiones dictandi< di Paolo Camaldolese,
oder Albertus von Asti: Flores dz'cfazzdz, die St. Martin von Asti zuzuweisen ist; vgl. WoRSTBRoex,
Albertus von Asti, S. 19 f.; vgl. zum denkbaren Unterricht der ars dz'cfazzzz'zzz's an Kathedralschulen
auch WoRSTBRoex, Die Anfänge der mittelalterlichen Ars dictandi, S. ß.
33 Vgl. auch die Betonung der allgemeinen politisch-kulturellen Situation im Kontext der Neu-
ausrichtung dokumentarischer Tätigkeiten durch MEYER, FUz'x U z'zzcizfas zzofarz'as, S. 177: »Für
die Geschichte des Notariats entscheidende Periode waren die Jahrzehnte um die Wende zum
12. Jahrhundert. In jener Zeit der großen Umwälzungen (Investiturstreit, Beginn der europä-
ischen Expansion mit der Eroberung Jerusalems, Aufkommen der Kommunen) revolutionierte
sich auch das bisherige Dokumentationssystem«.
39 WiTT, Rhetoric and Reform, S. 56.