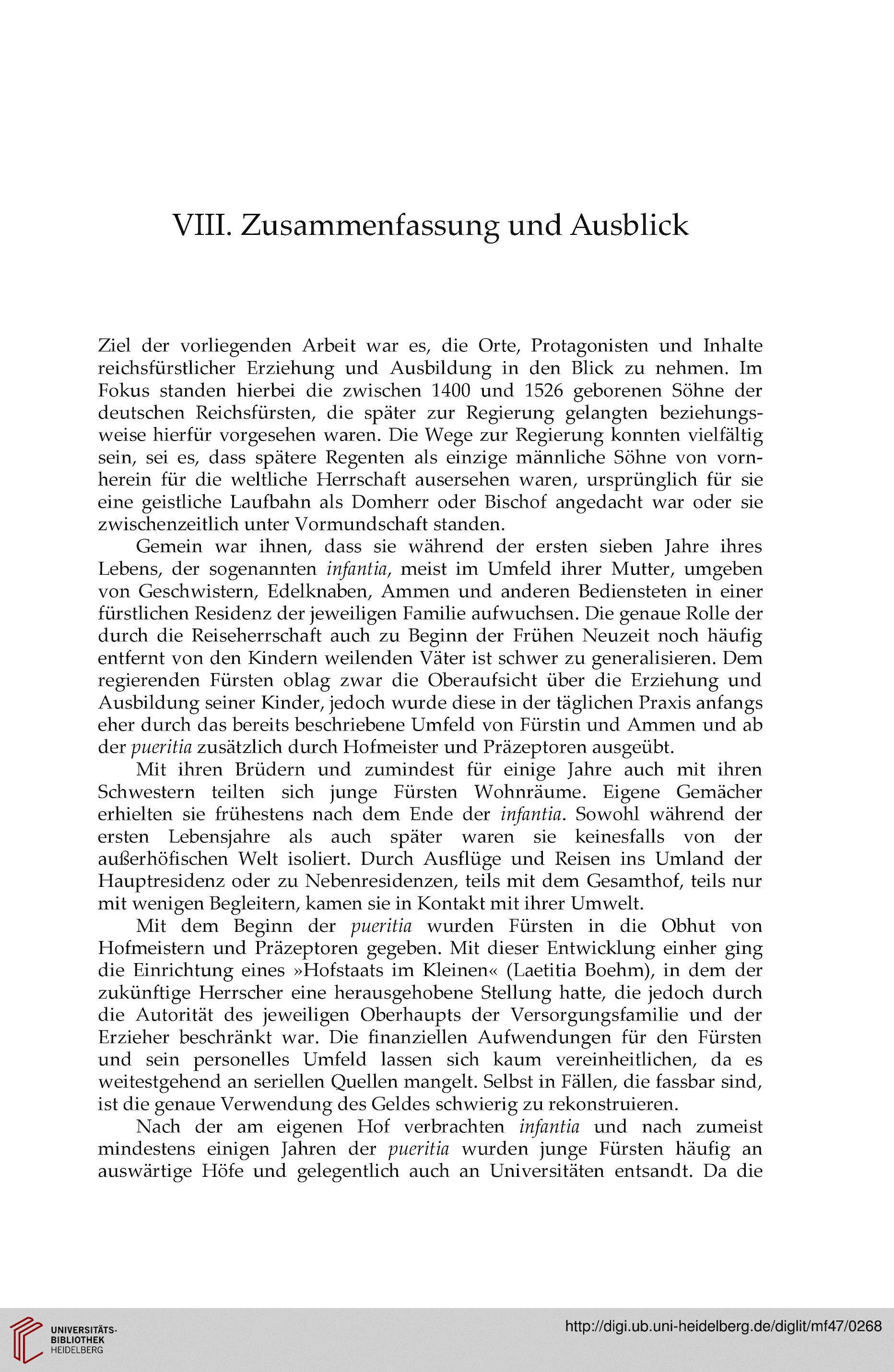VIII. Zusammenfassung und Ausblick
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Orte, Protagonisten und Inhalte
reichstürstlicher Erziehung und Ausbildung in den Blick zu nehmen. Im
Fokus standen hierbei die zwischen 1400 und 1526 geborenen Söhne der
deutschen Reichsfürsten, die später zur Regierung gelangten beziehungs-
weise hierfür vorgesehen waren. Die Wege zur Regierung konnten vielfältig
sein, sei es, dass spätere Regenten als einzige männliche Söhne von vorn-
herein für die weltliche Herrschaft ausersehen waren, ursprünglich für sie
eine geistliche Laufbahn als Domherr oder Bischof angedacht war oder sie
zwischenzeitlich unter Vormundschaft standen.
Gemein war ihnen, dass sie während der ersten sieben Jahre ihres
Lebens, der sogenannten /n/hniM, meist im Umfeld ihrer Mutter, umgeben
von Geschwistern, Edelknaben, Ammen und anderen Bediensteten in einer
fürstlichen Residenz der jeweiligen Familie auf wuchsen. Die genaue Rolle der
durch die Reiseherrschaft auch zu Beginn der Frühen Neuzeit noch häufig
entfernt von den Kindern weilenden Väter ist schwer zu generalisieren. Dem
regierenden Fürsten oblag zwar die Oberaufsicht über die Erziehung und
Ausbildung seiner Kinder, jedoch wurde diese in der täglichen Praxis anfangs
eher durch das bereits beschriebene Umfeld von Fürstin und Ammen und ab
der zusätzlich durch Hofmeister und Präzeptoren ausgeübt.
Mit ihren Brüdern und zumindest für einige Jahre auch mit ihren
Schwestern teilten sich junge Fürsten Wohnräume. Eigene Gemächer
erhielten sie frühestens nach dem Ende der /n/hniM. Sowohl während der
ersten Lebensjahre als auch später waren sie keinesfalls von der
außerhöfischen Welt isoliert. Durch Ausflüge und Reisen ins Umland der
Hauptresidenz oder zu Nebenresidenzen, teils mit dem Gesamthof, teils nur
mit wenigen Begleitern, kamen sie in Kontakt mit ihrer Umwelt.
Mit dem Beginn der pMcnfM wurden Fürsten in die Obhut von
Hofmeistern und Präzeptoren gegeben. Mit dieser Entwicklung einher ging
die Einrichtung eines »Hofstaats im Kleinen« (Laetitia Boehm), in dem der
zukünftige Herrscher eine herausgehobene Stellung hatte, die jedoch durch
die Autorität des jeweiligen Oberhaupts der Versorgungsfamilie und der
Erzieher beschränkt war. Die finanziellen Aufwendungen für den Fürsten
und sein personelles Umfeld lassen sich kaum vereinheitlichen, da es
weitestgehend an seriellen Quellen mangelt. Selbst in Fällen, die fassbar sind,
ist die genaue Verwendung des Geldes schwierig zu rekonstruieren.
Nach der am eigenen Hof verbrachten /n/hniM und nach zumeist
mindestens einigen Jahren der pMcnfm wurden junge Fürsten häufig an
auswärtige Höfe und gelegentlich auch an Universitäten entsandt. Da die
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Orte, Protagonisten und Inhalte
reichstürstlicher Erziehung und Ausbildung in den Blick zu nehmen. Im
Fokus standen hierbei die zwischen 1400 und 1526 geborenen Söhne der
deutschen Reichsfürsten, die später zur Regierung gelangten beziehungs-
weise hierfür vorgesehen waren. Die Wege zur Regierung konnten vielfältig
sein, sei es, dass spätere Regenten als einzige männliche Söhne von vorn-
herein für die weltliche Herrschaft ausersehen waren, ursprünglich für sie
eine geistliche Laufbahn als Domherr oder Bischof angedacht war oder sie
zwischenzeitlich unter Vormundschaft standen.
Gemein war ihnen, dass sie während der ersten sieben Jahre ihres
Lebens, der sogenannten /n/hniM, meist im Umfeld ihrer Mutter, umgeben
von Geschwistern, Edelknaben, Ammen und anderen Bediensteten in einer
fürstlichen Residenz der jeweiligen Familie auf wuchsen. Die genaue Rolle der
durch die Reiseherrschaft auch zu Beginn der Frühen Neuzeit noch häufig
entfernt von den Kindern weilenden Väter ist schwer zu generalisieren. Dem
regierenden Fürsten oblag zwar die Oberaufsicht über die Erziehung und
Ausbildung seiner Kinder, jedoch wurde diese in der täglichen Praxis anfangs
eher durch das bereits beschriebene Umfeld von Fürstin und Ammen und ab
der zusätzlich durch Hofmeister und Präzeptoren ausgeübt.
Mit ihren Brüdern und zumindest für einige Jahre auch mit ihren
Schwestern teilten sich junge Fürsten Wohnräume. Eigene Gemächer
erhielten sie frühestens nach dem Ende der /n/hniM. Sowohl während der
ersten Lebensjahre als auch später waren sie keinesfalls von der
außerhöfischen Welt isoliert. Durch Ausflüge und Reisen ins Umland der
Hauptresidenz oder zu Nebenresidenzen, teils mit dem Gesamthof, teils nur
mit wenigen Begleitern, kamen sie in Kontakt mit ihrer Umwelt.
Mit dem Beginn der pMcnfM wurden Fürsten in die Obhut von
Hofmeistern und Präzeptoren gegeben. Mit dieser Entwicklung einher ging
die Einrichtung eines »Hofstaats im Kleinen« (Laetitia Boehm), in dem der
zukünftige Herrscher eine herausgehobene Stellung hatte, die jedoch durch
die Autorität des jeweiligen Oberhaupts der Versorgungsfamilie und der
Erzieher beschränkt war. Die finanziellen Aufwendungen für den Fürsten
und sein personelles Umfeld lassen sich kaum vereinheitlichen, da es
weitestgehend an seriellen Quellen mangelt. Selbst in Fällen, die fassbar sind,
ist die genaue Verwendung des Geldes schwierig zu rekonstruieren.
Nach der am eigenen Hof verbrachten /n/hniM und nach zumeist
mindestens einigen Jahren der pMcnfm wurden junge Fürsten häufig an
auswärtige Höfe und gelegentlich auch an Universitäten entsandt. Da die