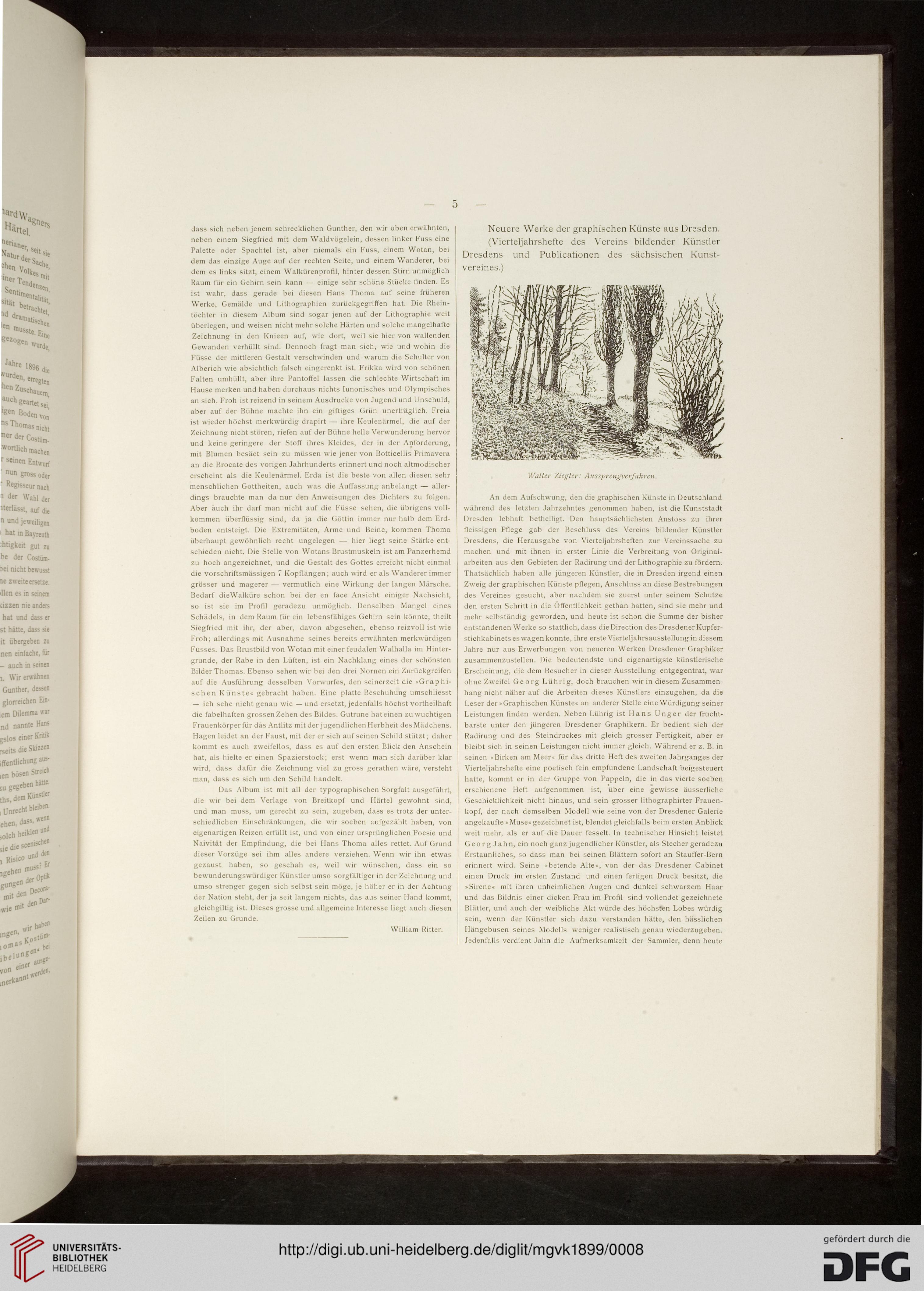', Sei!
Sit
■'«H.,5
etrachtet,'
'üs^.E,nt
Wurde
-•« 1896 iK
*"urden »~_
hcn Z«schauer
auch J
r n»"-
dass sich neben jenem schrecklichen Günther, den wir oben erwähnten,
neben einem Siegfried mit dem Waldvögelein, dessen linker Fuss eine
Palette oder Spachtel ist, aber niemals ein Fuss, einem Wotan, bei
dem das einzige Auge auf der rechten Seite, und einem Wanderer, bei
dem es links sitzt, einem Walkürenprofil, hinter dessen Stirn unmöglich
Raum für ein Gehirn sein kann — einige sehr schöne Stücke linden. Es
ist wahr, dass gerade bei diesen Hans Thoma auf seine früheren
Werke. Gemälde und Lithographien zurückgegriffen hat. Die Rhein-
töchter in diesem Album sind sogar jenen auf der Lithographie weit
überlegen, und weisen nicht mehr solche Härten und solche mangelhafte
Zeichnung in den Knieen auf, wie dort, weil sie hier von wallenden
Gewanden verhüllt sind. Dennoch fragt man sich, wie und wohin die
Füsse der mittleren Gestalt verschwinden und warum die Schulter von
Alberich wie absichtlich falsch eingerenkt ist. Frikka wird von schönen
Falten umhüllt, aber ihre Pantoffel lassen die schlechte Wirtschaft im
Hause merken und haben durchaus nichts Iunonisches und Olympisches
an sich. Froh ist reizend in seinem Ausdrucke von Jugend und Unschuld,
aber auf der Buhne machte ihn ein giftiges Grün unerträglich. Freia
ist wieder höchst merkwürdig drapirt — ihre Keulenärmel, die auf der
Zeichnung nicht stören, riefen auf der Bühne helle Verwunderung hervor
und keine geringere der Stoff ihres Kleides, der in der Anforderung,
mit Blumen besäet sein zu müssen wie jener von Botticellis Primavera
an die Brocate des vorigen Jahrhunderts erinnert und noch altmodischer
erscheint als die Keulenärmel. Erda ist die beste von allen diesen sehr
menschlichen Gottheiten, auch was die Auffassung anbelangt — aller-
dings brauchte man da nur den Anweisungen des Dichters zu folgen.
Aber auch ihr darf man nicht auf die Füsse sehen, die übrigens voll-
kommen überflüssig sind, da ja die Göttin immer nur halb dem Erd-
boden entsteigt. Die Extremitäten, Arme und Beine, kommen Thoma
überhaupt gewöhnlich recht ungelegen — hier liegt seine Stärke ent-
schieden nicht. Die Stelle von Wotans Brustmuskeln ist am Panzerhemd
zu hoch angezeichnet, und die Gestalt des Gottes erreicht nicht einmal
die vorschriftsmässigen 7 Kopflangen, auch wird er als Wanderer immer
grösser und magerer — vermutlich eine Wirkung der langen Märsche.
Bedarf dieWalküre schon bei der en face Ansicht einiger Nachsicht,
so ist sie im Profil geradezu unmöglich. Denselben Mangel eines
Schädels, in dem Raum für ein lebensfähiges Gehirn sein konnte, theilt
Siegfried mit ihr, der aber, davon abgesehen, ebenso reizvoll ist wie
Froh; allerdings mit Ausnahme seines bereits erwähnten merkwürdigen
Fusses. Das Brustbild von Wotan mit einer feudalen Walhalla im Hinter-
grunde, der Rabe in den Lüften, ist ein Nachklang eines der schönsten
Büdei Thomas. Ebenso sehen wir bei den drei Nornen ein Zurückgreifen
auf die Ausführung desselben Vorwurfes, den seinerzeit die »Graphi-
schen Künste« gebracht haben. Eine platte Beschuhung umschliesst
— ich sehe nicht genau wie — und ersetzt, jedenfalls höchst vortheilhaft
die fabelhaften grossen Zehen des Bildes. Gutrune hat einen zu wuchtigen
Frauenkörper für das Antlitz mitder jugendiichenHcrbheit des Mädchens.
Hagen leidet an der Faust, mit der er sich auf seinen Schild stützt; daher
kommt es auch zweifellos, dass es auf den ersten Blick den Anschein
hat, als hielte er einen Spazierstock; erst wenn man sich darüber klar
wird, dass dafür die Zeichnung viel zu gross gcrathen wäre, versteht
man, dass es sich um den Schild handelt.
Das Album ist mit all der typographischen Sorgfalt ausgeführt,
die wir bei dem Verlage von Breitkopf und Härtel gewohnt sind,
und man muss, um gerecht zu sein, zugeben, dass es trotz der unter-
schiedlichen Einschränkungen, die wir soeben aufgezählt haben, von
eigenartigen Reizen erfüllt ist, und von einer ursprünglichen Poesie und
Naivität der Empfindung, die bei Hans Thoma alles rettet. Auf Grund
dieser Vorzüge sei ihm alles andere verziehen. Wenn wir ihn etwas
gezaust haben, so geschah es, weil wir wünschen, dass ein so
bewunderungswürdiger Künstler umso sorgfältiger in der Zeichnung und
umso strenger gegen sich selbst sein möge, je höher er in der Achtung
der Nation steht, der ja seit langem nichts, das aus seiner Hand kommt,
gleichgiltig ist. Dieses grosse und allgemeine Interesse Hegt auch diesen
Zeilen zu Grunde.
William Ritter.
:rka"nt
w*
rde».
Neuere Werke der graphischen Künste aus Dresden.
(Vierteljahrshefte des Vereins bildender Künstler
Dresdens und Publicationen des sächsischen Kunst-
vereines.)
PI-.,
■-
ranna
Waller Ziegler: Aussprengverfahren
An dem Aufschwung, den die graphischen Künste in Deutschland
wahrend des letzten Jahrzehntes genommen haben, ist die Kunststadt
Dresden lebhaft betheiligt. Den hauptsächlichsten Anstoss zu ihrer
fleissigen Pflege gab der Beschluss des Vereins bildender Künstler
Dresdens, die Herausgabe von Vierteljahrsheften zur Vereinssache zu
machen und mit ihnen in erster Linie die Verbreitung von Original-
arbeiten aus den Gebieten der Radirung und der Lithographie zu fördern.
Thatsächlich haben alle jüngeren Künstler, die in Dresden irgend einen
Zweig der graphischen Künste pflegen, AnschUiss an diese Bestrebungen
des Vereines gesucht, aber nachdem sie zuerst unter seinem Schutze
den ersten Schritt in die Öffentlichkeit gethan hatten, sind sie mehr und
mehr selbständig geworden, und heute ist schon die Summe der bisher
entstandenen Werke so stattlich, dass dieDirection des DresdenerKupfer-
stichkabinets es wagen konnte, ihre erste Vierteljahrsausstellung in diesem
Jahre nur aus Erwerbungen von neueren Werken Dresdener Graphiker
zusammenzustellen. Die bedeutendste und eigenartigste künstlerische
Erscheinung, die dem Besucher in dieser Ausstellung entgegentrat, war
ohne Zweifel Georg Lührig, doch brauchen wir in diesem Zusammen-
hang nicht näher auf die Arbeiten dieses Kunstlers einzugehen, da die
Leser der »Graphischen Künste« an anderer Stelle eine Würdigung seiner
Leistungen finden werden. Neben Lührig ist Hans Unger der frucht-
barste unter den jüngeren Dresdener Graphikern. Er bedient sich der
Radirung und des Steindruckes mit gleich grosser Fertigkeit, aber er
bleibt sich in seinen Leistungen nicht immer gleich. Während er z. B. in
seinen »Birken am Meer« für das dritte Heft des zweiten Jahrganges der
Vierteljahrshefte eine poetisch fein empfundene Landschaft beigesteuert
hatte, kommt er in der Gruppe von Pappeln, die in das vierte soeben
erschienene Heft aufgenommen ist, über eine gewisse äusserliche
Geschicklichkeit nicht hinaus, und sein grosser lithographirter Frauen-
kopf, der nach demselben Modell wie seine von der Dresdener Galerie
angekaufte »Muse«gezeichnet ist, blendet gleichfalls beim, ersten Anblick
weit mehr, als er auf die Dauer fesselt. In technischer Hinsicht leistet
Georg Jahn, ein noch ganz jugendlicher Künstler, als Stecher geradezu
Erstaunliches, so dass man bei seinen Blättern sofort an Stauffer-Bern
erinnert wird. Seme »betende Alte«, von der das Dresdener Cabinet
einen Druck im ersten Zustand und einen fertigen Druck besitzt, die
»Sirene« mit ihren unheimlichen Augen und dunkel schwarzem Haar
und das Bildnis einer dicken Frau im Profil sind vollendet gezeichnete
Blätter, und auch der weibliche Akt würde des höchsten Lobes würdig
sein, wenn der Künstler sich dazu verstanden hätte, den hässlichen
Hangebusen seines Modells weniger realistisch genau wiederzugeben.
Jedenfalls verdient Jahn die Aufmerksamkeit der Sammler, denn heute
■NM
■MBB
Sit
■'«H.,5
etrachtet,'
'üs^.E,nt
Wurde
-•« 1896 iK
*"urden »~_
hcn Z«schauer
auch J
r n»"-
dass sich neben jenem schrecklichen Günther, den wir oben erwähnten,
neben einem Siegfried mit dem Waldvögelein, dessen linker Fuss eine
Palette oder Spachtel ist, aber niemals ein Fuss, einem Wotan, bei
dem das einzige Auge auf der rechten Seite, und einem Wanderer, bei
dem es links sitzt, einem Walkürenprofil, hinter dessen Stirn unmöglich
Raum für ein Gehirn sein kann — einige sehr schöne Stücke linden. Es
ist wahr, dass gerade bei diesen Hans Thoma auf seine früheren
Werke. Gemälde und Lithographien zurückgegriffen hat. Die Rhein-
töchter in diesem Album sind sogar jenen auf der Lithographie weit
überlegen, und weisen nicht mehr solche Härten und solche mangelhafte
Zeichnung in den Knieen auf, wie dort, weil sie hier von wallenden
Gewanden verhüllt sind. Dennoch fragt man sich, wie und wohin die
Füsse der mittleren Gestalt verschwinden und warum die Schulter von
Alberich wie absichtlich falsch eingerenkt ist. Frikka wird von schönen
Falten umhüllt, aber ihre Pantoffel lassen die schlechte Wirtschaft im
Hause merken und haben durchaus nichts Iunonisches und Olympisches
an sich. Froh ist reizend in seinem Ausdrucke von Jugend und Unschuld,
aber auf der Buhne machte ihn ein giftiges Grün unerträglich. Freia
ist wieder höchst merkwürdig drapirt — ihre Keulenärmel, die auf der
Zeichnung nicht stören, riefen auf der Bühne helle Verwunderung hervor
und keine geringere der Stoff ihres Kleides, der in der Anforderung,
mit Blumen besäet sein zu müssen wie jener von Botticellis Primavera
an die Brocate des vorigen Jahrhunderts erinnert und noch altmodischer
erscheint als die Keulenärmel. Erda ist die beste von allen diesen sehr
menschlichen Gottheiten, auch was die Auffassung anbelangt — aller-
dings brauchte man da nur den Anweisungen des Dichters zu folgen.
Aber auch ihr darf man nicht auf die Füsse sehen, die übrigens voll-
kommen überflüssig sind, da ja die Göttin immer nur halb dem Erd-
boden entsteigt. Die Extremitäten, Arme und Beine, kommen Thoma
überhaupt gewöhnlich recht ungelegen — hier liegt seine Stärke ent-
schieden nicht. Die Stelle von Wotans Brustmuskeln ist am Panzerhemd
zu hoch angezeichnet, und die Gestalt des Gottes erreicht nicht einmal
die vorschriftsmässigen 7 Kopflangen, auch wird er als Wanderer immer
grösser und magerer — vermutlich eine Wirkung der langen Märsche.
Bedarf dieWalküre schon bei der en face Ansicht einiger Nachsicht,
so ist sie im Profil geradezu unmöglich. Denselben Mangel eines
Schädels, in dem Raum für ein lebensfähiges Gehirn sein konnte, theilt
Siegfried mit ihr, der aber, davon abgesehen, ebenso reizvoll ist wie
Froh; allerdings mit Ausnahme seines bereits erwähnten merkwürdigen
Fusses. Das Brustbild von Wotan mit einer feudalen Walhalla im Hinter-
grunde, der Rabe in den Lüften, ist ein Nachklang eines der schönsten
Büdei Thomas. Ebenso sehen wir bei den drei Nornen ein Zurückgreifen
auf die Ausführung desselben Vorwurfes, den seinerzeit die »Graphi-
schen Künste« gebracht haben. Eine platte Beschuhung umschliesst
— ich sehe nicht genau wie — und ersetzt, jedenfalls höchst vortheilhaft
die fabelhaften grossen Zehen des Bildes. Gutrune hat einen zu wuchtigen
Frauenkörper für das Antlitz mitder jugendiichenHcrbheit des Mädchens.
Hagen leidet an der Faust, mit der er sich auf seinen Schild stützt; daher
kommt es auch zweifellos, dass es auf den ersten Blick den Anschein
hat, als hielte er einen Spazierstock; erst wenn man sich darüber klar
wird, dass dafür die Zeichnung viel zu gross gcrathen wäre, versteht
man, dass es sich um den Schild handelt.
Das Album ist mit all der typographischen Sorgfalt ausgeführt,
die wir bei dem Verlage von Breitkopf und Härtel gewohnt sind,
und man muss, um gerecht zu sein, zugeben, dass es trotz der unter-
schiedlichen Einschränkungen, die wir soeben aufgezählt haben, von
eigenartigen Reizen erfüllt ist, und von einer ursprünglichen Poesie und
Naivität der Empfindung, die bei Hans Thoma alles rettet. Auf Grund
dieser Vorzüge sei ihm alles andere verziehen. Wenn wir ihn etwas
gezaust haben, so geschah es, weil wir wünschen, dass ein so
bewunderungswürdiger Künstler umso sorgfältiger in der Zeichnung und
umso strenger gegen sich selbst sein möge, je höher er in der Achtung
der Nation steht, der ja seit langem nichts, das aus seiner Hand kommt,
gleichgiltig ist. Dieses grosse und allgemeine Interesse Hegt auch diesen
Zeilen zu Grunde.
William Ritter.
:rka"nt
w*
rde».
Neuere Werke der graphischen Künste aus Dresden.
(Vierteljahrshefte des Vereins bildender Künstler
Dresdens und Publicationen des sächsischen Kunst-
vereines.)
PI-.,
■-
ranna
Waller Ziegler: Aussprengverfahren
An dem Aufschwung, den die graphischen Künste in Deutschland
wahrend des letzten Jahrzehntes genommen haben, ist die Kunststadt
Dresden lebhaft betheiligt. Den hauptsächlichsten Anstoss zu ihrer
fleissigen Pflege gab der Beschluss des Vereins bildender Künstler
Dresdens, die Herausgabe von Vierteljahrsheften zur Vereinssache zu
machen und mit ihnen in erster Linie die Verbreitung von Original-
arbeiten aus den Gebieten der Radirung und der Lithographie zu fördern.
Thatsächlich haben alle jüngeren Künstler, die in Dresden irgend einen
Zweig der graphischen Künste pflegen, AnschUiss an diese Bestrebungen
des Vereines gesucht, aber nachdem sie zuerst unter seinem Schutze
den ersten Schritt in die Öffentlichkeit gethan hatten, sind sie mehr und
mehr selbständig geworden, und heute ist schon die Summe der bisher
entstandenen Werke so stattlich, dass dieDirection des DresdenerKupfer-
stichkabinets es wagen konnte, ihre erste Vierteljahrsausstellung in diesem
Jahre nur aus Erwerbungen von neueren Werken Dresdener Graphiker
zusammenzustellen. Die bedeutendste und eigenartigste künstlerische
Erscheinung, die dem Besucher in dieser Ausstellung entgegentrat, war
ohne Zweifel Georg Lührig, doch brauchen wir in diesem Zusammen-
hang nicht näher auf die Arbeiten dieses Kunstlers einzugehen, da die
Leser der »Graphischen Künste« an anderer Stelle eine Würdigung seiner
Leistungen finden werden. Neben Lührig ist Hans Unger der frucht-
barste unter den jüngeren Dresdener Graphikern. Er bedient sich der
Radirung und des Steindruckes mit gleich grosser Fertigkeit, aber er
bleibt sich in seinen Leistungen nicht immer gleich. Während er z. B. in
seinen »Birken am Meer« für das dritte Heft des zweiten Jahrganges der
Vierteljahrshefte eine poetisch fein empfundene Landschaft beigesteuert
hatte, kommt er in der Gruppe von Pappeln, die in das vierte soeben
erschienene Heft aufgenommen ist, über eine gewisse äusserliche
Geschicklichkeit nicht hinaus, und sein grosser lithographirter Frauen-
kopf, der nach demselben Modell wie seine von der Dresdener Galerie
angekaufte »Muse«gezeichnet ist, blendet gleichfalls beim, ersten Anblick
weit mehr, als er auf die Dauer fesselt. In technischer Hinsicht leistet
Georg Jahn, ein noch ganz jugendlicher Künstler, als Stecher geradezu
Erstaunliches, so dass man bei seinen Blättern sofort an Stauffer-Bern
erinnert wird. Seme »betende Alte«, von der das Dresdener Cabinet
einen Druck im ersten Zustand und einen fertigen Druck besitzt, die
»Sirene« mit ihren unheimlichen Augen und dunkel schwarzem Haar
und das Bildnis einer dicken Frau im Profil sind vollendet gezeichnete
Blätter, und auch der weibliche Akt würde des höchsten Lobes würdig
sein, wenn der Künstler sich dazu verstanden hätte, den hässlichen
Hangebusen seines Modells weniger realistisch genau wiederzugeben.
Jedenfalls verdient Jahn die Aufmerksamkeit der Sammler, denn heute
■NM
■MBB