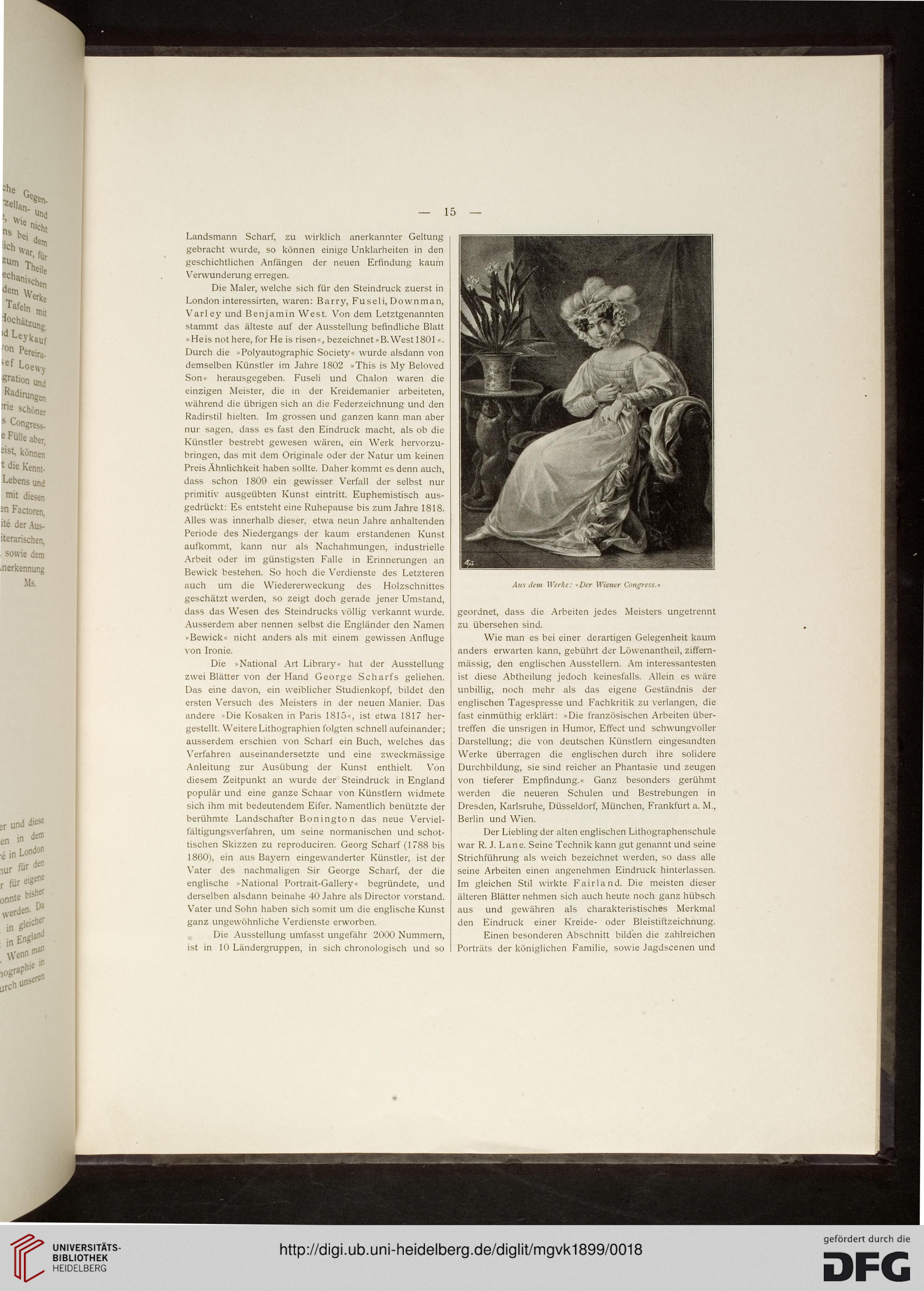15 —
bisher
gland
Landsmann Scharf, zu wirklich anerkannter Geltung
gebracht wurde, so können einige Unklarheiten in den
geschichtlichen Anfängen der neuen Erfindung kaum
Verwunderung erregen.
Die Maler, welche sich für den Steindruck zuerst in
London interessirten, waren: Barry, Fuseli, Downman,
Varley und Benjamin West. Von dem Letztgenannten
stammt das älteste auf der Ausstellung befindliche Blatt
»Heis nothere, for He is risen«, bezeichnet »B.West 1801«.
Durch die »Polyautographic Society« wurde alsdann von
demselben Künstler im Jahre 1802 »This is My Beloved
Son« herausgegeben. Fuseli und Chalon waren die
einzigen Meister, die in der Kreidemanier arbeiteten,
während die übrigen sich an die Federzeichnung und den
Radirstil hielten. Im grossen und ganzen kann man aber
nur sagen, dass es fast den Eindruck macht, als ob die
Künstler bestrebt gewesen wären, ein Werk hervorzu-
bringen, das mit dem Originale oder der Natur um keinen
Preis Ähnlichkeit haben sollte. Daher kommt es denn auch,
dass schon 1809 ein gewisser Verfall der selbst nur
primitiv ausgeübten Kunst eintritt. Euphemistisch aus-
gedrückt: Es entsteht eine Ruhepause bis zum Jahre 1818.
Alles was innerhalb dieser, etwa neun Jahre anhaltenden
Periode des Niedergangs der kaum erstandenen Kunst
aufkommt, kann nur als Nachahmungen, industrielle
Arbeit oder im günstigsten Falle in Erinnerungen an
Bewick bestehen. So hoch die Verdienste des Letzteren
auch um die Wiedererweckung des Holzschnittes
geschätzt werden, so zeigt doch gerade jener Umstand,
dass das Wesen des Steindrucks völlig verkannt wurde.
Ausserdem aber nennen selbst die Engländer den Namen
»Bewick« nicht anders als mit einem gewissen Anfluge
von Ironie.
Die »National Art Library« hat der Ausstellung
zwei Blätter von der Hand George Scharfs geliehen.
Das eine davon, ein weiblicher Studienkopf, bildet den
ersten Versuch des Meisters in der neuen Manier. Das
andere »Die Kosaken in Paris 1813«, ist etwa 1817 her-
gestellt. Weitere Lithographien folgten schnell aufeinander;
ausserdem erschien von Scharf ein Buch, welches das
Verfahren auseinandersetzte und eine zweckmässige
Anleitung zur Ausübung der Kunst enthielt. Von
diesem Zeitpunkt an wurde der Steindruck in England
populär und eine ganze Schaar von Künstlern widmete
sich ihm mit bedeutendem Eifer. Namentlich benützte der
berühmte Landschafter Bonington das neue Verviel-
fältigungsverfahren, um seine normanischen und schot-
tischen Skizzen zu reproduciren. Georg Scharf (1788 bis
1860), ein aus Bayern eingewanderter Künstler, ist der
Vater des nachmaligen Sir George Scharf, der die
englische »National Portrait-Gallery« begründete, und
derselben alsdann beinahe 40 Jahre als Director vorstand.
Vater und Sohn haben sich somit um die englische Kunst
ganz ungewöhnliche Verdienste erworben.
Die Ausstellung umfasst ungefähr 2000 Nummern,
ist in 10 Ländergruppen, in sich chronologisch und so
Aus dem Werke; «Der Wiener Congress.«
geordnet, dass die Arbeiten jedes Meisters ungetrennt
zu übersehen sind.
Wie man es bei einer derartigen Gelegenheit kaum
anders erwarten kann, gebührt der Löwenantheil, ziffern-
mässig, den englischen Ausstellern. Am interessantesten
ist diese Abtheilung jedoch keinesfalls. Allein es wäre
unbillig, noch mehr als das eigene Geständnis der
englischen Tagespresse und Fachkritik zu verlangen, die
fast einmüthig erklärt: »Die französischen Arbeiten über-
treffen die unsrigen in Humor, Effect und schwungvoller
Darstellung; die von deutschen Künstlern eingesandten
Werke überragen die englischen durch ihre solidere
Durchbildung, sie sind reicher an Phantasie und zeugen
von tieferer Empfindung.« Ganz besonders gerühmt
werden die neueren Schulen und Bestrebungen in
Dresden, Karlsruhe, Düsseldorf, München, Frankfurt a. M.,
Berlin und Wien.
Der Liebling der alten englischen Lithographenschule
war R. J. Lane. Seine Technik kann gut genannt und seine
Strichführung als weich bezeichnet werden, so dass alle
seine Arbeiten einen angenehmen Eindruck hinterlassen.
Im gleichen Stil wirkte Fairland. Die meisten dieser
älteren Blätter nehmen sich auch heute noch ganz hübsch
aus und gewähren als charakteristisches Merkmal
den Eindruck einer Kreide- oder Bleistiftzeichnung.
Einen besonderen Abschnitt bilden die zahlreichen
Porträts der königlichen Familie, sowie Jagdscenen und
bisher
gland
Landsmann Scharf, zu wirklich anerkannter Geltung
gebracht wurde, so können einige Unklarheiten in den
geschichtlichen Anfängen der neuen Erfindung kaum
Verwunderung erregen.
Die Maler, welche sich für den Steindruck zuerst in
London interessirten, waren: Barry, Fuseli, Downman,
Varley und Benjamin West. Von dem Letztgenannten
stammt das älteste auf der Ausstellung befindliche Blatt
»Heis nothere, for He is risen«, bezeichnet »B.West 1801«.
Durch die »Polyautographic Society« wurde alsdann von
demselben Künstler im Jahre 1802 »This is My Beloved
Son« herausgegeben. Fuseli und Chalon waren die
einzigen Meister, die in der Kreidemanier arbeiteten,
während die übrigen sich an die Federzeichnung und den
Radirstil hielten. Im grossen und ganzen kann man aber
nur sagen, dass es fast den Eindruck macht, als ob die
Künstler bestrebt gewesen wären, ein Werk hervorzu-
bringen, das mit dem Originale oder der Natur um keinen
Preis Ähnlichkeit haben sollte. Daher kommt es denn auch,
dass schon 1809 ein gewisser Verfall der selbst nur
primitiv ausgeübten Kunst eintritt. Euphemistisch aus-
gedrückt: Es entsteht eine Ruhepause bis zum Jahre 1818.
Alles was innerhalb dieser, etwa neun Jahre anhaltenden
Periode des Niedergangs der kaum erstandenen Kunst
aufkommt, kann nur als Nachahmungen, industrielle
Arbeit oder im günstigsten Falle in Erinnerungen an
Bewick bestehen. So hoch die Verdienste des Letzteren
auch um die Wiedererweckung des Holzschnittes
geschätzt werden, so zeigt doch gerade jener Umstand,
dass das Wesen des Steindrucks völlig verkannt wurde.
Ausserdem aber nennen selbst die Engländer den Namen
»Bewick« nicht anders als mit einem gewissen Anfluge
von Ironie.
Die »National Art Library« hat der Ausstellung
zwei Blätter von der Hand George Scharfs geliehen.
Das eine davon, ein weiblicher Studienkopf, bildet den
ersten Versuch des Meisters in der neuen Manier. Das
andere »Die Kosaken in Paris 1813«, ist etwa 1817 her-
gestellt. Weitere Lithographien folgten schnell aufeinander;
ausserdem erschien von Scharf ein Buch, welches das
Verfahren auseinandersetzte und eine zweckmässige
Anleitung zur Ausübung der Kunst enthielt. Von
diesem Zeitpunkt an wurde der Steindruck in England
populär und eine ganze Schaar von Künstlern widmete
sich ihm mit bedeutendem Eifer. Namentlich benützte der
berühmte Landschafter Bonington das neue Verviel-
fältigungsverfahren, um seine normanischen und schot-
tischen Skizzen zu reproduciren. Georg Scharf (1788 bis
1860), ein aus Bayern eingewanderter Künstler, ist der
Vater des nachmaligen Sir George Scharf, der die
englische »National Portrait-Gallery« begründete, und
derselben alsdann beinahe 40 Jahre als Director vorstand.
Vater und Sohn haben sich somit um die englische Kunst
ganz ungewöhnliche Verdienste erworben.
Die Ausstellung umfasst ungefähr 2000 Nummern,
ist in 10 Ländergruppen, in sich chronologisch und so
Aus dem Werke; «Der Wiener Congress.«
geordnet, dass die Arbeiten jedes Meisters ungetrennt
zu übersehen sind.
Wie man es bei einer derartigen Gelegenheit kaum
anders erwarten kann, gebührt der Löwenantheil, ziffern-
mässig, den englischen Ausstellern. Am interessantesten
ist diese Abtheilung jedoch keinesfalls. Allein es wäre
unbillig, noch mehr als das eigene Geständnis der
englischen Tagespresse und Fachkritik zu verlangen, die
fast einmüthig erklärt: »Die französischen Arbeiten über-
treffen die unsrigen in Humor, Effect und schwungvoller
Darstellung; die von deutschen Künstlern eingesandten
Werke überragen die englischen durch ihre solidere
Durchbildung, sie sind reicher an Phantasie und zeugen
von tieferer Empfindung.« Ganz besonders gerühmt
werden die neueren Schulen und Bestrebungen in
Dresden, Karlsruhe, Düsseldorf, München, Frankfurt a. M.,
Berlin und Wien.
Der Liebling der alten englischen Lithographenschule
war R. J. Lane. Seine Technik kann gut genannt und seine
Strichführung als weich bezeichnet werden, so dass alle
seine Arbeiten einen angenehmen Eindruck hinterlassen.
Im gleichen Stil wirkte Fairland. Die meisten dieser
älteren Blätter nehmen sich auch heute noch ganz hübsch
aus und gewähren als charakteristisches Merkmal
den Eindruck einer Kreide- oder Bleistiftzeichnung.
Einen besonderen Abschnitt bilden die zahlreichen
Porträts der königlichen Familie, sowie Jagdscenen und