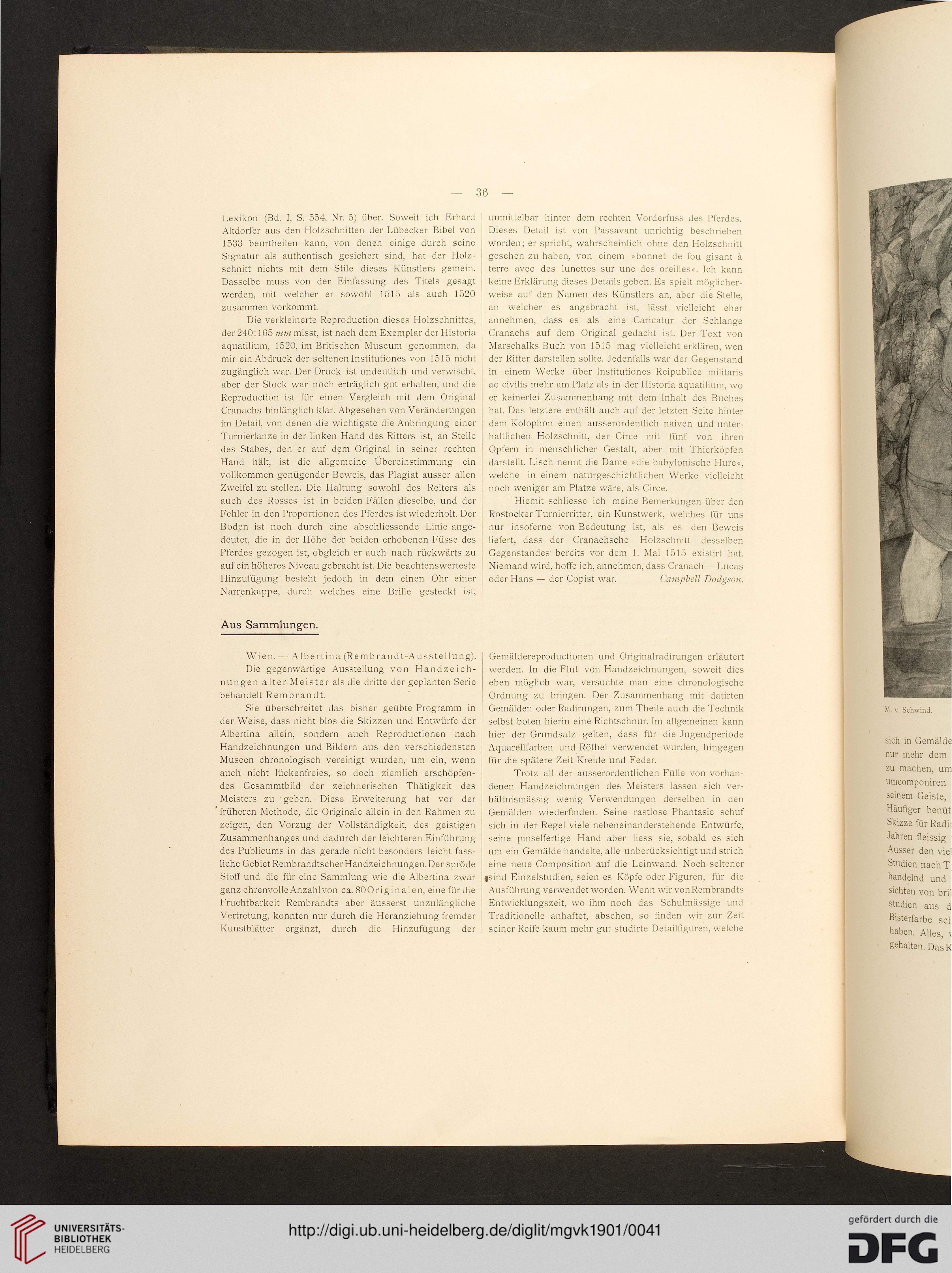Lexikon (Bd. I, S. 554, Nr. 5) über. Soweit ich Erhard
Altdorfer aus den Holzschnitten der Lübecker Bibel von
1533 beurtheilen kann, von denen einige durch seine
Signatur als authentisch gesichert sind, hat der Holz-
schnitt nichts mit dem Stile dieses Künstlers gemein.
Dasselbe muss von der Einfassung des Titels gesagt
werden, mit welcher er sowohl 1515 als auch 1520
zusammen vorkommt.
Die verkleinerte Reproduction dieses Holzschnittes,
der 240:165 mm misst, ist nach dem Exemplar der Historia
aquatilium, 1520, im Britischen Museum genommen, da
mir ein Abdruck der seltenen Institutiones von 1515 nicht
zugänglich war. Der Druck ist undeutlich und verwischt,
aber der Stock war noch erträglich gut erhalten, und die
Reproduction ist für einen Vergleich mit dem Original
Cranachs hinlänglich klar. Abgesehen von Veränderungen
im Detail, von denen die wichtigste die Anbringung einer
Turnierlanze in der linken Hand des Ritters ist, an Stelle
des Stabes, den er auf dem Original in seiner rechten
Hand hält, ist die allgemeine Übereinstimmung ein
vollkommen genügender Beweis, das Plagiat ausser allen
Zweifel zu stellen. Die Haltung sowohl des Reiters als
auch des Rosses ist in beiden Fällen dieselbe, und der
Fehler in den Proportionen des Pferdes ist wiederholt. Der
Boden ist noch durch eine abschliessende Linie ange-
deutet, die in der Höhe der beiden erhobenen Füsse des
Pferdes gezogen ist, obgleich er auch nach rückwärts zu
auf ein höheres Niveau gebracht ist. Die beachtenswerteste
Hinzufügung besteht jedoch in dem einen Ohr einer
Narrenkappe, durch welches eine Brille gesteckt ist,
unmittelbar hinter dem rechten Vorderfuss des Pferdes.
Dieses Detail ist von Passavant unrichtig beschrieben
worden; er spricht, wahrscheinlich ohne den Holzschnitt
gesehen zu haben, von einem »bonnet de fou gisant ä
terre avec des lunettes sur une des oreilles«. Ich kann
keine Erklärung dieses Details geben. Es spielt möglicher-
weise auf den Namen des Künstlers an, aber die Stelle,
an welcher es angebracht ist, lässt vielleicht eher
annehmen, dass es als eine Caricatur der Schlange
Cranachs auf dem Original gedacht ist. Der Text von
Marschalks Buch von 1515 mag vielleicht erklären, wen
der Ritter darstellen sollte. Jedenfalls war der Gegenstand
in einem Werke über Institutiones Reipublice militaris
ac civilis mehr am Platz als in der Historia aquatilium, wo
er keinerlei Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches
hat. Das letztere enthält auch auf der letzten Seite hinter
dem Kolophon einen ausserordentlich naiven und unter-
haltlichen Holzschnitt, der Circe mit fünf von ihren
Opfern in menschlicher Gestalt, aber mit Thierköpfen
darstellt. Lisch nennt die Dame »die babylonische Hure«,
welche in einem naturgeschichtlichen Werke vielleicht
noch weniger am Platze wäre, als Circe.
Hiemit schliesse ich meine Bemerkungen über den
Rostocker Turnierritter, ein Kunstwerk, welches für uns
nur insoferne von Bedeutung ist, als es den Beweis
liefert, dass der Cranachsche Holzschnitt desselben
Gegenstandes" bereits vor dem 1. Mai 1515 existirt hat.
Niemand wird, hofse ich, annehmen, dass Cranach — Lucas
oder Hans — der Copist war. Campbell Dodgson.
Aus Sammlungen.
Wien. — Albertina (Rembrandt-Ausstellung).
Die gegenwärtige Ausstellung von Handzeich-
nungen alter Meister als die dritte der geplanten Serie
behandelt Rembrandt.
Sie überschreitet das bisher geübte Programm in
der Weise, dass nicht blos die Skizzen und Entwürfe der
Albertina allein, sondern auch Reproductionen nach
Handzeichnungen und Bildern aus den verschiedensten
Museen chronologisch vereinigt wurden, um ein, wenn
auch nicht lückenfreies, so doch ziemlich erschöpfen-
des Gesammtbild der zeichnerischen Thätigkeit des
Meisters zu ' geben. Diese Erweiterung hat vor der
früheren Methode, die Originale allein in den Rahmen zu
zeigen; den Vorzug der Vollständigkeit, des geistigen
Zusammenhanges und dadurch der leichteren Einführung
des Publicums in das gerade nicht besonders leicht fass-
liche Gebiet Rembrandtscher Handzeichnungen. Der spröde
Stosf und die für eine Sammlung wie die Albertina zwar
ganz ehrenvolle Anzahl von ca. 80Originalen, eine für die
Fruchtbarkeit Rembrandts aber äusserst unzulängliche
Vertretung, konnten nur durch die Heranziehung fremder
Kunstblätter ergänzt, durch die Hinzufügung der
Gemäldereproductionen und Originalradirangen erläutert
werden. In die Flut von Handzeichnungen, soweit dies
eben möglich war, versuchte man eine chronologische
Ordnung zu bringen. Der Zusammenhang mit datirten
Gemälden oder Radirungen, zum Theile auch die Technik
selbst boten hierin eine Richtschnur. Im allgemeinen kann
hier der Grundsatz gelten, dass für die Jugendperiode
Aquarellfarben und Röthel verwendet wurden, hingegen
für die spätere Zeit Kreide und Feder.
Trotz all der ausserordentlichen Fülle von vorhan-
denen Handzeichnungen des Meisters lassen sich ver-
hältnismässig wenig Verwendungen derselben in den
Gemälden wiederfinden. Seine rastlose Phantasie schuf
sich in der Regel viele nebeneinanderstehende Entwürfe,
seine pinselfertige Hand aber liess sie, sobald es sich
um ein Gemälde handelte, alle unberücksichtigt und strich
eine neue Composition auf die Leinwand. Noch seltener
»sind Einzelstudien, seien es Köpfe oder Figuren, für die
Ausführung verwendet worden. Wenn wir von Rembrandts
Entwicklungszeit, wo ihm noch das Schulmässige und
Traditionelle anhaftet, absehen, so finden wir zur Zeit
seiner Reife kaum mehr gut studirte Detailfiguren, welche
Altdorfer aus den Holzschnitten der Lübecker Bibel von
1533 beurtheilen kann, von denen einige durch seine
Signatur als authentisch gesichert sind, hat der Holz-
schnitt nichts mit dem Stile dieses Künstlers gemein.
Dasselbe muss von der Einfassung des Titels gesagt
werden, mit welcher er sowohl 1515 als auch 1520
zusammen vorkommt.
Die verkleinerte Reproduction dieses Holzschnittes,
der 240:165 mm misst, ist nach dem Exemplar der Historia
aquatilium, 1520, im Britischen Museum genommen, da
mir ein Abdruck der seltenen Institutiones von 1515 nicht
zugänglich war. Der Druck ist undeutlich und verwischt,
aber der Stock war noch erträglich gut erhalten, und die
Reproduction ist für einen Vergleich mit dem Original
Cranachs hinlänglich klar. Abgesehen von Veränderungen
im Detail, von denen die wichtigste die Anbringung einer
Turnierlanze in der linken Hand des Ritters ist, an Stelle
des Stabes, den er auf dem Original in seiner rechten
Hand hält, ist die allgemeine Übereinstimmung ein
vollkommen genügender Beweis, das Plagiat ausser allen
Zweifel zu stellen. Die Haltung sowohl des Reiters als
auch des Rosses ist in beiden Fällen dieselbe, und der
Fehler in den Proportionen des Pferdes ist wiederholt. Der
Boden ist noch durch eine abschliessende Linie ange-
deutet, die in der Höhe der beiden erhobenen Füsse des
Pferdes gezogen ist, obgleich er auch nach rückwärts zu
auf ein höheres Niveau gebracht ist. Die beachtenswerteste
Hinzufügung besteht jedoch in dem einen Ohr einer
Narrenkappe, durch welches eine Brille gesteckt ist,
unmittelbar hinter dem rechten Vorderfuss des Pferdes.
Dieses Detail ist von Passavant unrichtig beschrieben
worden; er spricht, wahrscheinlich ohne den Holzschnitt
gesehen zu haben, von einem »bonnet de fou gisant ä
terre avec des lunettes sur une des oreilles«. Ich kann
keine Erklärung dieses Details geben. Es spielt möglicher-
weise auf den Namen des Künstlers an, aber die Stelle,
an welcher es angebracht ist, lässt vielleicht eher
annehmen, dass es als eine Caricatur der Schlange
Cranachs auf dem Original gedacht ist. Der Text von
Marschalks Buch von 1515 mag vielleicht erklären, wen
der Ritter darstellen sollte. Jedenfalls war der Gegenstand
in einem Werke über Institutiones Reipublice militaris
ac civilis mehr am Platz als in der Historia aquatilium, wo
er keinerlei Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches
hat. Das letztere enthält auch auf der letzten Seite hinter
dem Kolophon einen ausserordentlich naiven und unter-
haltlichen Holzschnitt, der Circe mit fünf von ihren
Opfern in menschlicher Gestalt, aber mit Thierköpfen
darstellt. Lisch nennt die Dame »die babylonische Hure«,
welche in einem naturgeschichtlichen Werke vielleicht
noch weniger am Platze wäre, als Circe.
Hiemit schliesse ich meine Bemerkungen über den
Rostocker Turnierritter, ein Kunstwerk, welches für uns
nur insoferne von Bedeutung ist, als es den Beweis
liefert, dass der Cranachsche Holzschnitt desselben
Gegenstandes" bereits vor dem 1. Mai 1515 existirt hat.
Niemand wird, hofse ich, annehmen, dass Cranach — Lucas
oder Hans — der Copist war. Campbell Dodgson.
Aus Sammlungen.
Wien. — Albertina (Rembrandt-Ausstellung).
Die gegenwärtige Ausstellung von Handzeich-
nungen alter Meister als die dritte der geplanten Serie
behandelt Rembrandt.
Sie überschreitet das bisher geübte Programm in
der Weise, dass nicht blos die Skizzen und Entwürfe der
Albertina allein, sondern auch Reproductionen nach
Handzeichnungen und Bildern aus den verschiedensten
Museen chronologisch vereinigt wurden, um ein, wenn
auch nicht lückenfreies, so doch ziemlich erschöpfen-
des Gesammtbild der zeichnerischen Thätigkeit des
Meisters zu ' geben. Diese Erweiterung hat vor der
früheren Methode, die Originale allein in den Rahmen zu
zeigen; den Vorzug der Vollständigkeit, des geistigen
Zusammenhanges und dadurch der leichteren Einführung
des Publicums in das gerade nicht besonders leicht fass-
liche Gebiet Rembrandtscher Handzeichnungen. Der spröde
Stosf und die für eine Sammlung wie die Albertina zwar
ganz ehrenvolle Anzahl von ca. 80Originalen, eine für die
Fruchtbarkeit Rembrandts aber äusserst unzulängliche
Vertretung, konnten nur durch die Heranziehung fremder
Kunstblätter ergänzt, durch die Hinzufügung der
Gemäldereproductionen und Originalradirangen erläutert
werden. In die Flut von Handzeichnungen, soweit dies
eben möglich war, versuchte man eine chronologische
Ordnung zu bringen. Der Zusammenhang mit datirten
Gemälden oder Radirungen, zum Theile auch die Technik
selbst boten hierin eine Richtschnur. Im allgemeinen kann
hier der Grundsatz gelten, dass für die Jugendperiode
Aquarellfarben und Röthel verwendet wurden, hingegen
für die spätere Zeit Kreide und Feder.
Trotz all der ausserordentlichen Fülle von vorhan-
denen Handzeichnungen des Meisters lassen sich ver-
hältnismässig wenig Verwendungen derselben in den
Gemälden wiederfinden. Seine rastlose Phantasie schuf
sich in der Regel viele nebeneinanderstehende Entwürfe,
seine pinselfertige Hand aber liess sie, sobald es sich
um ein Gemälde handelte, alle unberücksichtigt und strich
eine neue Composition auf die Leinwand. Noch seltener
»sind Einzelstudien, seien es Köpfe oder Figuren, für die
Ausführung verwendet worden. Wenn wir von Rembrandts
Entwicklungszeit, wo ihm noch das Schulmässige und
Traditionelle anhaftet, absehen, so finden wir zur Zeit
seiner Reife kaum mehr gut studirte Detailfiguren, welche