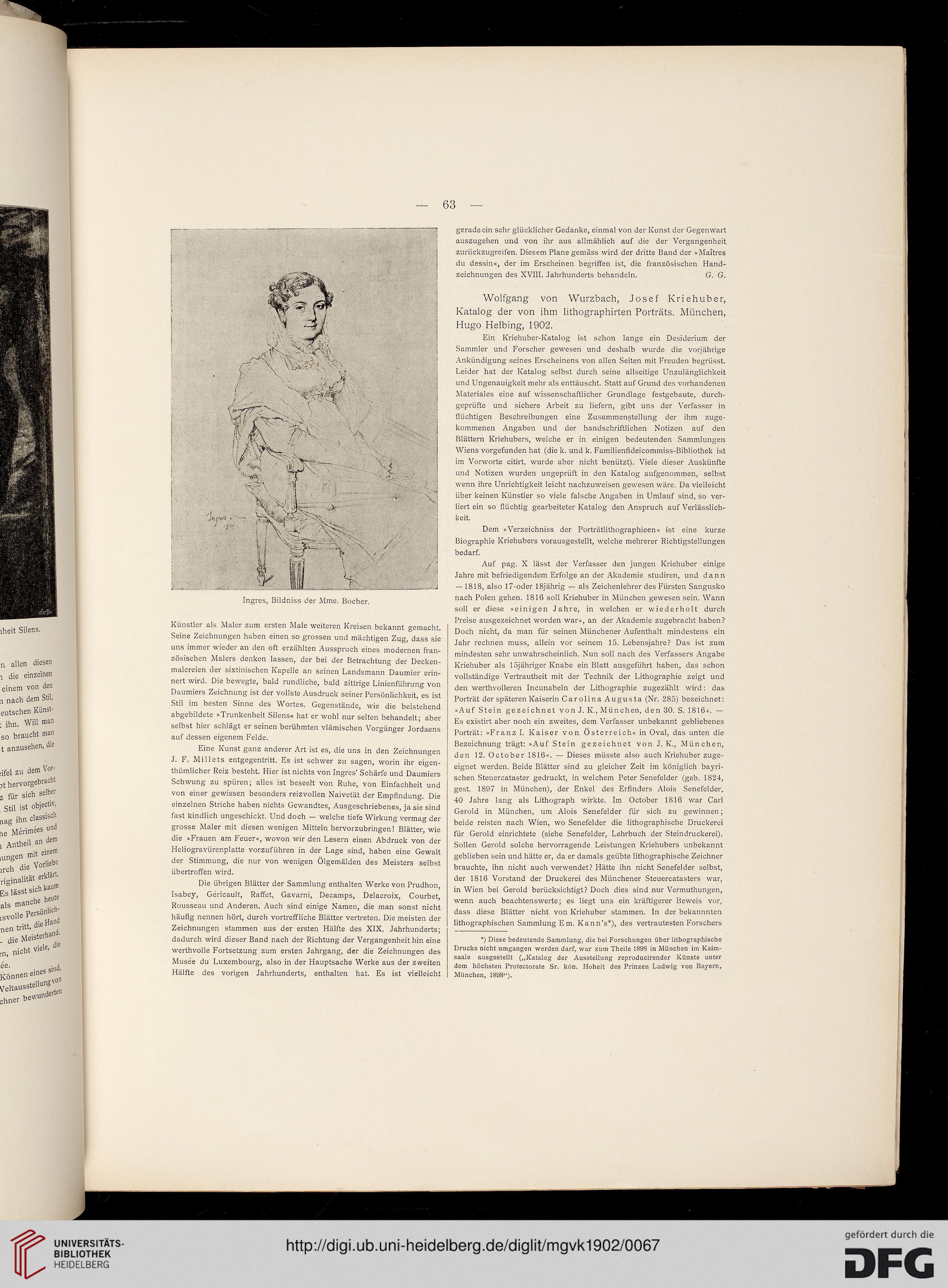— 63
mm
iheit Silens.
n allen diesen
-, die einzelnen
einem von den
a nach dem Stil,
eutschen Kunst-
. ihn. Will man
so braucht man
t anzusehen, die
,jsel zu dem Vor-
,t hervorgebracht
t sür sich selber
Stil ist objecto
„agihnclassisch
ne Merimees un"
, Antheil an dem
amgen mit eine«
irch die Vorueb
nginalitäterk^.
EsDlässtsichkaum
als h;;
nen tri«, ^
-die Meiste^
», nicht viele, d«
Snneneines^
vreltausstellung
chner bewunde*»
Ingres, Bildniss der Mmc. Bocher.
Künstler als Maler zum ersten Male weiteren Kreisen bekannt gemacht.
Seine Zeichnungen haben einen so grossen und mächtigen Zug, dass sie
uns immer wieder an den ost erzählten Ausspruch eines modernen sran-
zösischen Malers denken lassen, der bei der Betrachtung der Decken-
malereien der sixtinischen Kapelle an seinen Landsmann Daumier erin-
nert wird. Die bewegte, bald rundliche, bald zittrige Liniensührung von
Daumiers Zeichnung ist der vollste Ausdruck seiner Persönlichkeit, es ist
Stil im besten Sinne des Wortes. Gegenstände, wie die beistehend
abgebildete »Trunkenheit Silens« hat er wohl nur selten behandelt; aber
selbst hier schlägt er seinen berühmten vlämischen Vorgänger Jordaens
aus dessen eigenem Felde.
Eine Kunst ganz anderer Art ist es, die uns in den Zeichnungen
J. F. Millets entgegentritt. Es ist schwer zu sagen, worin ihr eigen-
thümlicher Reiz besteht. Hier ist nichts von Ingres' Schärse und Daumiers
Schwung zu spüren; alles ist beseelt von Ruhe, von Einfachheit und
von einer gewissen besonders reizvollen Naivetät der Empfindung. Die
einzelnen Striche haben nichts Gewandtes, Ausgeschriebenes, ja sie sind
sast kindlich ungeschickt. Und doch — welche tiefe Wirkung vermag der
grosse Maler mit diesen wenigen Mitteln hervorzubringen! Blätter, wie
die »Frauen am Feuer«, wovon wir den Lesern einen Abdruck von der
Heliogravürenplatte vorzusühren in der Lage sind, haben eine Gewalt
der Stimmung, die nur von wenigen Ölgemälden des Meisters selbst
übertrossen wird.
Die übrigen Blätter der Sammlung enthalten Werke von Prudhon,
Isabey, Gericault, Rafset, Gavarni, Decamps, Delacroix, Courbet,
Rousseau und Anderen. Auch sind einige Namen, die man sonst nicht
häusig nennen hört, durch vortrefsliche Blätter vertreten. Die meisten der
Zeichnungen stammen aus der ersten Hälste des XIX. Jahrhunderts;
dadurch wird dieser Band nach der Richtung der Vergangenheit hin eine
werthvolle Fortsetzung zum ersten Jahrgang, der die Zeichnungen des
Musee du Luxembourg, also in der Hauptsache Werke aus der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts, enthalten hat. Es ist vielleicht
gerade ein sehr glücklicher Gedanke, einmal von der Kunst der Gegenwart
auszugchen und von ihr aus allmählich aus die der Vergangenheit
zurückzugreisen. Diesem Plane gemäss wird der dritte Band der »Maitres
du dessin«, der im Erscheinen begrissen ist, die französischen Hand-
zeichnungen des XVIII. Jahrhunderts behandeln. G. G.
Wolsgang von Wurzbach, Josef Kriehuber,
Katalog der von ihm lithographirten Porträts. München,
Hugo Helbing, 1902.
Ein Kriehuber-Katalog ist schon lange ein Dcsiderium der
Sammler und Forscher gewesen und deshalb wurde die vorjährige
Ankündigung seines Erscheinens von allen Seiten mit Freuden begrüsst.
Leider hat der Katalog selbst durch seine allseitige Unzulänglichkeit
und Ungenauigkeit mehr als enttäuscht. Statt aus Grund des vorhandenen
Materiales eine aus wissenschastlicher Grundlage sestgebaute, durch-
geprüste und sichere Arbeit zu liesern, gibt uns der Versasser in
slüchtigen Beschreibungen eine Zusammenstellung der ihm zuge-
kommenen Angaben und der handschristlichen Notizen aus den
Blättern Kriehubers, welche er in einigen bedeutenden Sammlungen
Wiens vorgesunden hat (die k. und k. Familiensideicommiss-Bibliothek ist
im Vorworte citirt. wurde aber nicht benützt). Viele dieser Auskünste
und Notizen wurden ungeprüst in den Katalog ausgenommen, selbst
wenn ihre Unrichtigkeit leicht nachzuweisen gewesen wäre. Da vielleicht
über keinen Künstler so viele falsche Angaben in Umlauf sind, so ver-
liert ein so flüchtig gearbeiteter Katalog den Anspruch aus Verlässlich-
keit.
Dem »Verzeichniss der Porträtlithographieen« ist eine kurze
Biographie Kriehubers vorausgestellt, welche mehrerer Richtigstellungen
bedars.
Aus pag. X lässt der Verfasser den jungen Kriehuber einige
Jahre mit besriedigendem Erfolge an der Akademie studiren, und dann
— 1818, also 17-oder 18jährig — als Zeichenlehrer des Fürsten Sangusko
nach Polen gehen. 1816 soll Kriehuber in München gewesen sein. Wann
soll er diese »einigen Jahre, in welchen er wiederholt durch
Preise ausgezeichnet worden war«, an der Akademie zugebracht haben?
Doch nicht, da man für seinen Münchener Aufenthalt mindestens ein
Jahr rechnen muss, allein vor seinem 15. Lebensjahre? Das ist zum
mindesten sehr unwahrscheinlich. Nun soll nach des Versassers Angabe
Kriehuber als löjähriger Knabe ein Blatt ausgesührt haben, das schon
vollständige Vertrautheit mit der Technik der Lithographie zeigt und
den werthvolleren Incunabeln der Lithographie zugezählt wird: das
Porträt der späteren Kaiserin Carolina Augusta (Nr. 285) bezeichnet:
»Auf Stein gezeichnet von J. K., München, den 30. S. 1816». —
Es existirt aber noch ein zweites, dem Verfasser unbekannt gebliebenes
Porträt: »Franz I. Kaiser von Österreich« in Oval, das unten die
Bezeichnung trägt: »Auf Stein gezeichnet von J. K., München,
den 12. October 1816«. — Dieses müsste also auch Kriehuber zuge-
eignet werden. Beide Blätter sind zu gleicher Zeit im königlich bayri-
schen Steuercataster gedruckt, in welchem Peter Senefelder (geb. 1824,
gest. 1897 in München), der Enkel des Ersinders Alois Senefelder,
40 Jahre lang als Lithograph wirkte. Im October 1816 war Carl
Gerold in München, um Alois Senefelder sür sich zu gewinnen;
beide reisten nach Wien, wo Senefelder die lithographische Druckerei
für Gerold einrichtete (siehe Senefelder, Lehrbuch der Steindruckerei).
Sollen Gerold solche hervorragende Leistungen Kriehubers unbekannt
geblieben sein und hätte er, da er damals geübte lithographische Zeichner
brauchte, ihn nicht auch verwendet? Hätte ihn nicht Seneselder selbst,
der 1816 Vorstand der Druckerei des Münchener Steuercatasters war,
in Wien bei Gerold berücksichtigt? Doch dies sind nur Vermuthungen,
wenn auch beachtenswerte; es liegt uns ein krästigerer Beweis vor,
dass diese Blätter nicht von Kriehuber stammen. In der bekannnten
lithographischen Sammlung Em. Kann's*), des vertrautesten Forschers
*) Diese bedeutende Sammlung, die bei Forschungen über lithographische
Drucke nicht umgangen werden darf, war zum Theile 189S in München im Kaim-
saale ausgestellt („Katalog der Ausstellung reproducirender Künste unter
dem höchsten Protectorate Sr. lsön. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern,
München, 1898").