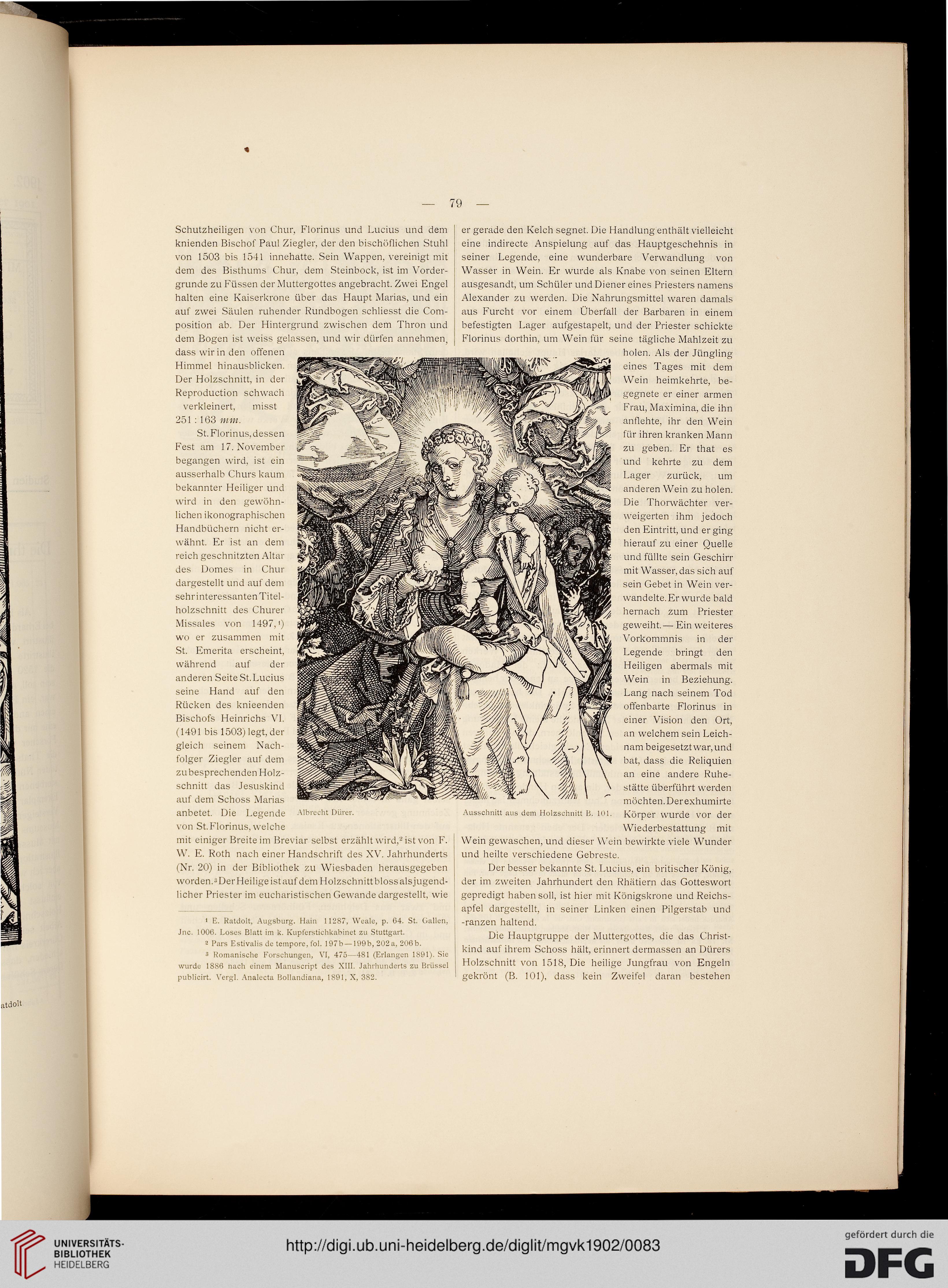79
Schutzheiligen von Chur, Florinus und Lucius und dem
knienden Bischof Paul Ziegler, der den bischöflichen Stuhl
von 1503 bis 1541 innehatte. Sein Wappen, vereinigt mit
dem des Bisthums Chur, dem Steinbock, ist im Vorder-
grunde zu Füssen der Muttergottes angebracht. Zwei Engel
halten eine Kaiserkrone über das Haupt Marias, und ein
auf zwei Säulen ruhender Rundbogen schliesst die Com-
position ab. Der Hintergrund zwischen dem Thron und
dem Bogen ist weiss gelassen, und wir dürfen annehmen,
dasswirinden offenen
Himmel hinausblicken.
Der Holzschnitt, in der
Reproduction schwach
verkleinert, misst
251 : 163 mm.
St. Florinus, dessen
Fest am 17. November
begangen wird, ist ein
ausserhalb Churs kaum
bekannter Heiliger und
wird in den gewöhn-
lichen ikonographischen
Handbüchern nicht er-
wähnt. Er ist an dem
reich geschnitzten Altar
des Domes in Chur
dargestellt und auf dem
sehr interessanten Titel-
holzschnitt des Churer
Missales von 1497,')
wo er zusammen mit
St. Emerita erscheint,
während auf der
anderen Seite St.Lucius
seine Hand auf den
Rücken des knieenden
Bischofs Heinrichs VI.
(1491 bis 1503) legt, der
gleich seinem Nach-
folger Ziegler auf dem
zubesprechenden Holz-
schnitt das Jesuskind
auf dem Schoss Marias
anbetet. Die Legende
von St. Florinus, welche
mit einiger Breite im Breviar selbst erzählt wird,-'ist von F.
W. E. Roth nach einer Handschrift des XV. Jahrhunderts
(Nr. 20) in der Bibliothek zu Wiesbaden herausgegeben
worden.sDerHeilige istauf dem Holzschnittblossalsjugend-
licher Priester im eucharistischen Gewände dargestellt, wie
Albrecht Dürer.
i E. Ratdolt, Augsburg. Hain 11287, Weale, p. 64. St. (lallen,
Jnc. 1006. Loses Blatt im k. Kupl'erstichkabinet zu Stuttgart.
Pars Estivalis de tempore, fol. 197b —199b, 202a, 206b.
• Romanische Forschungen, VI, 475—481 (Erlangen 1891). Sie
wurde 1886 nach einem Manuscript des XIII. Jahrhunderts zu Brüssel
publlclrt. Vergl. Analecta Bollandiana, 1891, X, 382.
er gerade den Kelch segnet. Die Handlung enthält vielleicht
eine indirecte Anspielung auf das Hauptgeschehnis in
seiner Legende, eine wunderbare Verwandlung von
Wasser in Wein. Er wurde als Knabe von seinen Eltern
ausgesandt, um Schüler und Diener eines Priesters namens
Alexander zu werden. Die Nahrungsmittel waren damals
aus Furcht vor einem Überfall der Barbaren in einem
befestigten Lager aufgestapelt, und der Priester schickte
Florinus dorthin, um Wein für seine tägliche Mahlzeit zu
holen. Als der Jüngling
eines Tages mit dem
Wein heimkehrte, be-
gegnete er einer armen
Frau, Maximina, die ihn
anflehte, ihr den Wein
für ihren kranken Mann
zu geben. Er that es
und kehrte zu dem
Lager zurück, um
anderen Wein zu holen.
Die Thorwächter ver-
weigerten ihm jedoch
den Eintritt, und er ging
hierauf zu einer Quelle
und füllte sein Geschirr
mit Wasser, das sich auf
sein Gebet in Wein ver-
wandelte. Er wurde bald
hernach zum Priester
geweiht.— Ein weiteres
Vorkommnis in der
Legende bringt den
Heiligen abermals mit
Wein in Beziehung.
Lang nach seinem Tod
osfenbarte Florinus in
einer Vision den Ort,
an welchem sein Leich-
nam beigesetzt war, und
bat, dass die Reliquien
an eine andere Ruhe-
stätte überführt werden
möchten. Der exhumirte
Körper wurde vor der
Wiederbestattung mit
Wein gewaschen, und dieser Wein bewirkte viele Wunder
und heilte verschiedene Gebreste.
Der besser bekannte St. Lucius, ein britischer König,
der im zweiten Jahrhundert den Rhätiern das Gotteswort
gepredigt habensoll, ist hier mit Königskrone und Reichs-
apfel dargestellt, in seiner Linken einen Pilgerstab und
-ranzen haltend.
Die Hauptgruppe der Muttergottes, die das Christ-
kind auf ihrem Schoss hält, erinnert dermassen an Dürers
Holzschnitt von 1518, Die heilige Jungfrau von Engeln
gekrönt (B. 101), dass kein Zweifel daran bestehen
Ausschnitt aus dem Holzschnitt B. 101.
Schutzheiligen von Chur, Florinus und Lucius und dem
knienden Bischof Paul Ziegler, der den bischöflichen Stuhl
von 1503 bis 1541 innehatte. Sein Wappen, vereinigt mit
dem des Bisthums Chur, dem Steinbock, ist im Vorder-
grunde zu Füssen der Muttergottes angebracht. Zwei Engel
halten eine Kaiserkrone über das Haupt Marias, und ein
auf zwei Säulen ruhender Rundbogen schliesst die Com-
position ab. Der Hintergrund zwischen dem Thron und
dem Bogen ist weiss gelassen, und wir dürfen annehmen,
dasswirinden offenen
Himmel hinausblicken.
Der Holzschnitt, in der
Reproduction schwach
verkleinert, misst
251 : 163 mm.
St. Florinus, dessen
Fest am 17. November
begangen wird, ist ein
ausserhalb Churs kaum
bekannter Heiliger und
wird in den gewöhn-
lichen ikonographischen
Handbüchern nicht er-
wähnt. Er ist an dem
reich geschnitzten Altar
des Domes in Chur
dargestellt und auf dem
sehr interessanten Titel-
holzschnitt des Churer
Missales von 1497,')
wo er zusammen mit
St. Emerita erscheint,
während auf der
anderen Seite St.Lucius
seine Hand auf den
Rücken des knieenden
Bischofs Heinrichs VI.
(1491 bis 1503) legt, der
gleich seinem Nach-
folger Ziegler auf dem
zubesprechenden Holz-
schnitt das Jesuskind
auf dem Schoss Marias
anbetet. Die Legende
von St. Florinus, welche
mit einiger Breite im Breviar selbst erzählt wird,-'ist von F.
W. E. Roth nach einer Handschrift des XV. Jahrhunderts
(Nr. 20) in der Bibliothek zu Wiesbaden herausgegeben
worden.sDerHeilige istauf dem Holzschnittblossalsjugend-
licher Priester im eucharistischen Gewände dargestellt, wie
Albrecht Dürer.
i E. Ratdolt, Augsburg. Hain 11287, Weale, p. 64. St. (lallen,
Jnc. 1006. Loses Blatt im k. Kupl'erstichkabinet zu Stuttgart.
Pars Estivalis de tempore, fol. 197b —199b, 202a, 206b.
• Romanische Forschungen, VI, 475—481 (Erlangen 1891). Sie
wurde 1886 nach einem Manuscript des XIII. Jahrhunderts zu Brüssel
publlclrt. Vergl. Analecta Bollandiana, 1891, X, 382.
er gerade den Kelch segnet. Die Handlung enthält vielleicht
eine indirecte Anspielung auf das Hauptgeschehnis in
seiner Legende, eine wunderbare Verwandlung von
Wasser in Wein. Er wurde als Knabe von seinen Eltern
ausgesandt, um Schüler und Diener eines Priesters namens
Alexander zu werden. Die Nahrungsmittel waren damals
aus Furcht vor einem Überfall der Barbaren in einem
befestigten Lager aufgestapelt, und der Priester schickte
Florinus dorthin, um Wein für seine tägliche Mahlzeit zu
holen. Als der Jüngling
eines Tages mit dem
Wein heimkehrte, be-
gegnete er einer armen
Frau, Maximina, die ihn
anflehte, ihr den Wein
für ihren kranken Mann
zu geben. Er that es
und kehrte zu dem
Lager zurück, um
anderen Wein zu holen.
Die Thorwächter ver-
weigerten ihm jedoch
den Eintritt, und er ging
hierauf zu einer Quelle
und füllte sein Geschirr
mit Wasser, das sich auf
sein Gebet in Wein ver-
wandelte. Er wurde bald
hernach zum Priester
geweiht.— Ein weiteres
Vorkommnis in der
Legende bringt den
Heiligen abermals mit
Wein in Beziehung.
Lang nach seinem Tod
osfenbarte Florinus in
einer Vision den Ort,
an welchem sein Leich-
nam beigesetzt war, und
bat, dass die Reliquien
an eine andere Ruhe-
stätte überführt werden
möchten. Der exhumirte
Körper wurde vor der
Wiederbestattung mit
Wein gewaschen, und dieser Wein bewirkte viele Wunder
und heilte verschiedene Gebreste.
Der besser bekannte St. Lucius, ein britischer König,
der im zweiten Jahrhundert den Rhätiern das Gotteswort
gepredigt habensoll, ist hier mit Königskrone und Reichs-
apfel dargestellt, in seiner Linken einen Pilgerstab und
-ranzen haltend.
Die Hauptgruppe der Muttergottes, die das Christ-
kind auf ihrem Schoss hält, erinnert dermassen an Dürers
Holzschnitt von 1518, Die heilige Jungfrau von Engeln
gekrönt (B. 101), dass kein Zweifel daran bestehen
Ausschnitt aus dem Holzschnitt B. 101.