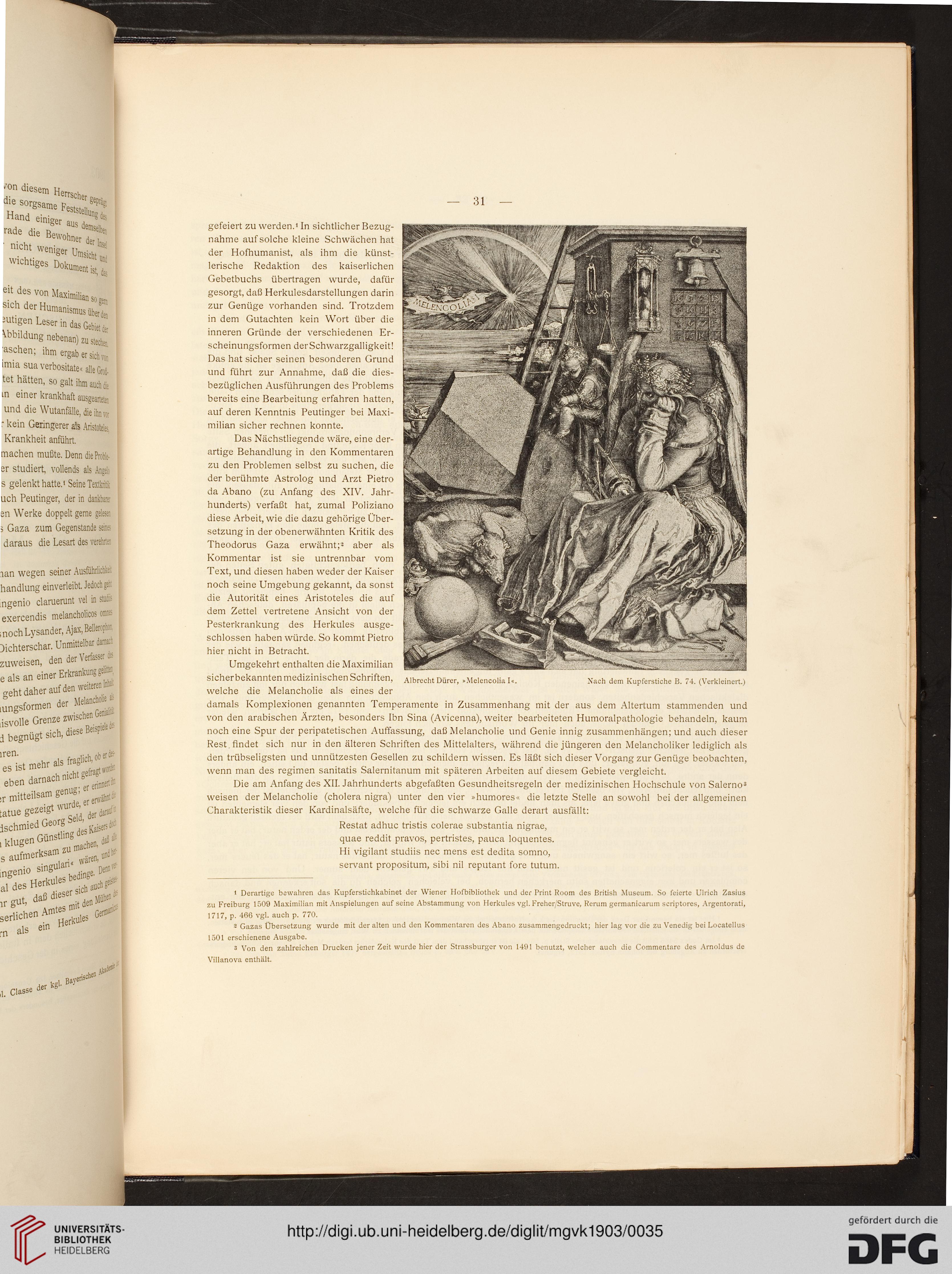gefeiert zu werden.' In sichtlicher Bezug-
nahme auf solche kleine Schwächen hat
der Hofhumanist, als ihm die künst-
lerische Redaktion des kaiserlichen
Gebetbuchs übertragen wurde, dafür
gesorgt, daß Herkulesdarstellungen darin
zur Genüge vorhanden sind. Trotzdem
in dem Gutachten kein Wort über die
inneren Gründe der verschiedenen Er-
scheinungsformen der Schwarzgalligkeit!
Das hat sicher seinen besonderen Grund
und führt zur Annahme, daß die dies-
bezüglichen Ausführungen des Problems
bereits eine Bearbeitung erfahren hatten,
auf deren Kenntnis Peutinger bei Maxi-
milian sicher rechnen konnte.
Das Nächstliegende wäre, eine der-
artige Behandlung in den Kommentaren
zu den Problemen selbst zu suchen, die
der berühmte Astrolog und Arzt Pietro
da Abano (zu Anfang des XIV. Jahr-
hunderts) verfaßt hat, zumal Poliziano
diese Arbeit, wie die dazu gehörige Über-
setzung in der obenerwähnten Kritik des
Theodorus Gaza erwähnt;2 aber als
Kommentar ist sie untrennbar vom
Text, und diesen haben weder der Kaiser
noch seine Umgebung gekannt, da sonst
die Autorität eines Aristoteles die auf
dem Zettel vertretene Ansicht von der
Pesterkrankung des Herkules ausge-
schlossen haben würde. So kommt Pietro
hier nicht in Betracht.
Umgekehrt enthalten die Maximilian
sicherbekannten medizinischen Schriften,
welche die Melancholie als eines der
damals Komplexionen genannten Temperamente in Zusammenhang mit der aus dem Altertum stammenden und
von den arabischen Ärzten, besonders Ibn Sina (Avicenna), weiter bearbeiteten Humoralpathologie behandeln, kaum
noch eine Spur der peripatetischen Auffassung, daß Melancholie und Genie innig zusammenhängen; und auch dieser
Rest findet sich nur in den älteren Schriften des Mittelalters, während die jüngeren den Melancholiker lediglich als
den trübseligsten und unnützesten Gesellen zu schildern wissen. Es läßt sich dieser Vorgang zur Genüge beobachten,
wenn man des regimen sanitatis Salernitanum mit späteren Arbeiten auf diesem Gebiete vergleicht.
Die am Anfang des XII. Jahrhunderts abgefaßten Gesundheitsregeln der medizinischen Hochschule von Salerno3
weisen der Melancholie (cholera nigra) unter den vier »humores« die letzte Stelle an sowohl bei der allgemeinen
Charakteristik dieser Kardinalsäfte, welche für die schwarze Galle derart ausfällt:
Restat adhuc tristis colerae substantia nigrae,
quae reddit pravos, pertristes, pauca loquentes.
Hi vigilant studiis nec mens est dedita somno,
servant propositum, sibi nil reputant fore tutum.
1 Derartige bewahren das Kupserstichkabinet der Wiener Hosbibliothek und der Print Room des British Museum. So seierte Ulrich Zasius
ZU Freiburg 1509 Maximilian mit Anspielungen auf seine Abstammung von Herkules vgl. Freher/Struve, Rerum germanicarum scriptores, Argentorati,
1717, p. 466 vgl. auch p. 770.
2 Gazas Übersetzung wurde mit der alten und den Kommentaren des Abano zusammengedruckt; hier lag vor die zu Venedig bei Locatellus
1501 erschienene Ausgabe.
s Von den zahlreichen Drucken jener Zeit wurde hier der Strassburger von 1491 benutzt, welcher auch die Commentare des Arnoldus de
Villanova enthält.
nahme auf solche kleine Schwächen hat
der Hofhumanist, als ihm die künst-
lerische Redaktion des kaiserlichen
Gebetbuchs übertragen wurde, dafür
gesorgt, daß Herkulesdarstellungen darin
zur Genüge vorhanden sind. Trotzdem
in dem Gutachten kein Wort über die
inneren Gründe der verschiedenen Er-
scheinungsformen der Schwarzgalligkeit!
Das hat sicher seinen besonderen Grund
und führt zur Annahme, daß die dies-
bezüglichen Ausführungen des Problems
bereits eine Bearbeitung erfahren hatten,
auf deren Kenntnis Peutinger bei Maxi-
milian sicher rechnen konnte.
Das Nächstliegende wäre, eine der-
artige Behandlung in den Kommentaren
zu den Problemen selbst zu suchen, die
der berühmte Astrolog und Arzt Pietro
da Abano (zu Anfang des XIV. Jahr-
hunderts) verfaßt hat, zumal Poliziano
diese Arbeit, wie die dazu gehörige Über-
setzung in der obenerwähnten Kritik des
Theodorus Gaza erwähnt;2 aber als
Kommentar ist sie untrennbar vom
Text, und diesen haben weder der Kaiser
noch seine Umgebung gekannt, da sonst
die Autorität eines Aristoteles die auf
dem Zettel vertretene Ansicht von der
Pesterkrankung des Herkules ausge-
schlossen haben würde. So kommt Pietro
hier nicht in Betracht.
Umgekehrt enthalten die Maximilian
sicherbekannten medizinischen Schriften,
welche die Melancholie als eines der
damals Komplexionen genannten Temperamente in Zusammenhang mit der aus dem Altertum stammenden und
von den arabischen Ärzten, besonders Ibn Sina (Avicenna), weiter bearbeiteten Humoralpathologie behandeln, kaum
noch eine Spur der peripatetischen Auffassung, daß Melancholie und Genie innig zusammenhängen; und auch dieser
Rest findet sich nur in den älteren Schriften des Mittelalters, während die jüngeren den Melancholiker lediglich als
den trübseligsten und unnützesten Gesellen zu schildern wissen. Es läßt sich dieser Vorgang zur Genüge beobachten,
wenn man des regimen sanitatis Salernitanum mit späteren Arbeiten auf diesem Gebiete vergleicht.
Die am Anfang des XII. Jahrhunderts abgefaßten Gesundheitsregeln der medizinischen Hochschule von Salerno3
weisen der Melancholie (cholera nigra) unter den vier »humores« die letzte Stelle an sowohl bei der allgemeinen
Charakteristik dieser Kardinalsäfte, welche für die schwarze Galle derart ausfällt:
Restat adhuc tristis colerae substantia nigrae,
quae reddit pravos, pertristes, pauca loquentes.
Hi vigilant studiis nec mens est dedita somno,
servant propositum, sibi nil reputant fore tutum.
1 Derartige bewahren das Kupserstichkabinet der Wiener Hosbibliothek und der Print Room des British Museum. So seierte Ulrich Zasius
ZU Freiburg 1509 Maximilian mit Anspielungen auf seine Abstammung von Herkules vgl. Freher/Struve, Rerum germanicarum scriptores, Argentorati,
1717, p. 466 vgl. auch p. 770.
2 Gazas Übersetzung wurde mit der alten und den Kommentaren des Abano zusammengedruckt; hier lag vor die zu Venedig bei Locatellus
1501 erschienene Ausgabe.
s Von den zahlreichen Drucken jener Zeit wurde hier der Strassburger von 1491 benutzt, welcher auch die Commentare des Arnoldus de
Villanova enthält.