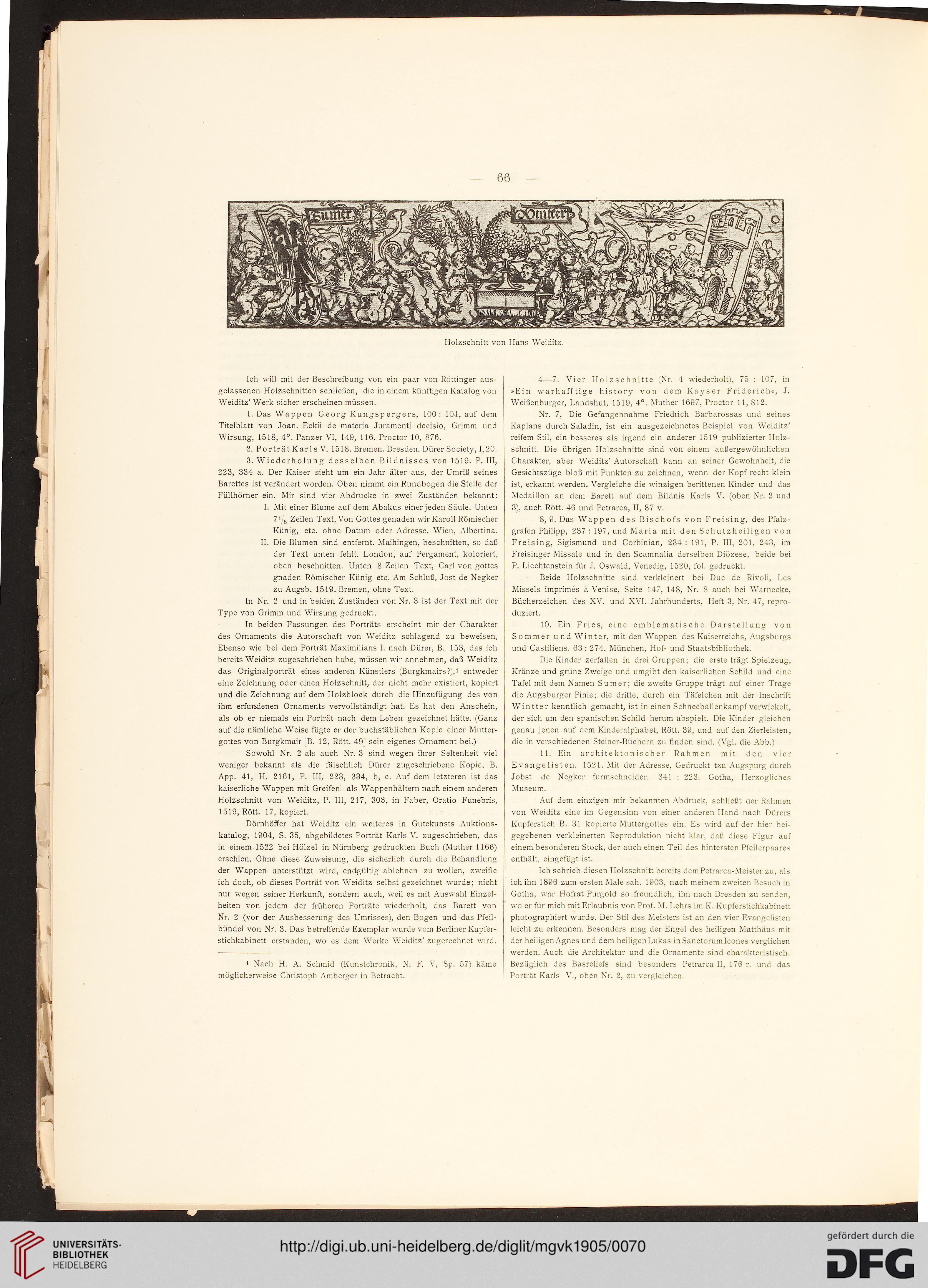Holzschnitt von Hans Weiditz.
Ich will mit der Beschreibung von ein paar von Röttinger aus-
gelassenen Holzschnitten schließen, die in einem künftigen Katalog von
Weiditz' Werk sicher erscheinen müssen.
1. Das Wappen Georg Kungspergers, 100: 101, auf dem
Titelblatt von Joan. Eckii de materia Juramenti decisio, Grimm und
Wirsung, 1518, 4°. Panzer VI, 149, 116. Proctor 10, 876.
2. Porträt Karls V. 1518. Bremen. Dresden. Dürer Society, 1,20.
3. Wiederholung desselben Bildnisses von 1519. P. III,
223, 334 a. Der Kaiser sieht um ein Jahr älter aus, der Umriß seines
Barettes ist verändert worden. Oben nimmt ein Rundbogen die Stelle der
Füllhörner ein. Mir sind vier Abdrucke in zwei Zuständen bekannt:
I. Mit einer Blume auf dem Abakus einer jeden Säule. Unten
71/8 Zeilen Text, Von Gottes genaden wir Karoll Römischer
Künig, etc. ohne Datum oder Adresse. Wien, Albertina.
II. Die Blumen sind entfernt. Maihingen, beschnitten, so daß
der Text unten fehlt. London, auf Pergament, koloriert,
oben beschnitten. Unten 8 Zeilen Text, Carl von gottes
gnaden Römischer Künig etc. Am Schluß, Jost de Negker
zu Augsb. 1519. Bremen, ohne Text.
In Nr. 2 und in beiden Zuständen von Nr. 3 ist der Text mit der
Type von Grimm und Wirsung gedruckt.
In beiden Fassungen des Porträts erscheint mir der Charakter
des Ornaments die Autorschaft von Weiditz schlagend zu beweisen.
Ebenso wie bei dem Porträt Maximilians I. nach Dürer, B. 153, das ich
bereits Weiditz zugeschrieben habe, müssen wir annehmen, daß Weiditz
das Originalporträt eines anderen Künstlers (Burgkmairs?),1 entweder
eine Zeichnung oder einen Holzschnitt, der nicht mehr existiert, kopiert
und die Zeichnung auf dem Holzblock durch die Hinzufügung des von
ihm erfundenen Ornaments vervollständigt hat. Es hat den Anschein,
als ob er niemals ein Porträt nach dem Leben gezeichnet hätte. (Ganz
auf die nämliche Weise fügte er der buchstäblichen Kopie einer Mutter-
gottes von Burgkmair [B. 12, Rott. 49] sein eigenes Ornament bei.)
Sowohl Nr. 2 als auch Nr. 3 sind wegen ihrer Seltenheit viel
weniger bekannt als die fälschlich Dürer zugeschriebene Kopie, B.
App. 41, H. 2161, P. III, 223, 334, b, c. Auf dem letzteren ist das
kaiserliche Wappen mit Greifen als Wappenhältern nach einem anderen
Holzschnitt von Weiditz, P. III, 217, 303, in Faber, Oratio Funebris,
1519, Rott. 17, kopiert.
Dörnhöffer hat Weiditz ein weiteres in Gutekunsts Auktions-
katalog, 1904, S. 35, abgebildetes Porträt Karls V. zugeschrieben, das
in einem 1522 bei Holzel in Nürnberg gedruckten Buch (Muther 1166)
erschien. Ohne diese Zuweisung, die sicherlich durch die Behandlung
der Wappen unterstützt wird, endgültig ablehnen zu wollen, zweifle
ich doch, ob dieses Porträt von Weiditz selbst gezeichnet wurde; nicht
nur wegen seiner Herkunft, sondern auch, weil es mit Auswahl Einzel-
heiten von jedem der früheren Porträte wiederholt, das Barett von
Nr. 2 (vor der Ausbesserung des Umrisses), den Bogen und das Pfeil-
bündel von Nr. 3. Das betreffende Exemplar wurde vom Berliner Kupfer-
stichkabinett erstanden, wo es dem Werke Weiditz' zugerechnet wird.
1 Nach H. A. Schmid (Kunstchronik, N. F. V, Sp. 57) käme
möglicherweise Christoph Amberger in Betracht.
4—7. Vier Holzschnitte (Nr. 4 wiederholt), 75 : 107, in
»Ein warhafftige history von dem Kayser Friderich«, J.
Weißenburger, Landshut, 1519, 4°. Muther 1697, Proctor 11, 812.
Nr. 7, Die Gefangennahme Friedrich Barbarossas und seines
Kaplans durch Saladin, ist ein ausgezeichnetes Beispiel von Weiditz'
reifem Stil, ein besseres als irgend ein anderer 1519 publizierter Holz-
schnitt. Die übrigen Holzschnitte sind von einem außergewöhnlichen
Charakter, aber Weiditz' Autorschaft kann an seiner Gewohnheit, die
Gesichtszüge bloß mit Punkten zu zeichnen, wenn der Kopf recht klein
ist, erkannt werden. Vergleiche die winzigen berittenen Kinder und das
Medaillon an dem Barett auf dem Bildnis Karls V. (oben Nr. 2 und
3), auch Rott. 46 und Petrarca, II, 87 v.
8, 9. Das Wappen des Bischofs von Freising, des Pfalz-
grafen Philipp, 237 : 197, und Maria mit den Schutzheiligen von
Freising, Sigismund und Corbinian, 234 : 191, P. III. 201, 243, im
Freisinger Missale und in den Scamnalia derselben Diözese, beide bei
P. Liechtenstein für J. Oswald, Venedig, 1520, fol. gedruckt.
Beide Holzschnitte sind verkleinert bei Duc de Rivoli, Les
Misseis imprimes ä Venise, Seite 147, 148, Nr. 8 auch bei Warnecke,
Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts, Heft 3, Nr. 47, repro-
duziert.
10. Ein Fries, eine emblematische Darstellung von
Sommer und Winter, mit den Wappen des Kaiserreichs, Augsburgs
und Castiliens. 63 : 274. München, Hof- und Staatsbibliothek.
Die Kinder zerfallen in drei Gruppen; die erste trägt Spielzeug,
Kränze und grüne Zweige und umgibt den kaiserlichen Schild und eine
Tafel mit dem Namen Sumer; die zweite Gruppe trägt auf einer Trage
die Augsburger Pinie; die dritte, durch ein Täfelchen mit der Inschrift
Wintter kenntlich gemacht, ist in einen Schneeballenkampf verwickelt,
der sich um den spanischen Schild herum abspielt. Die Kinder gleichen
genau jenen auf dem Kinderalphabet, Rott. 39, und auf den Zierleisten,
die in verschiedenen Steiner-Büchern zu finden sind. (Vgl. die Abb.)
11. Ein architektonischer Rahmen mit den vier
Evangelisten. 1521. Mit der Adresse, Gedruckt tzu Augspurg durch
Jobst de Negker furmschneider. 341 : 223. Gotha, Herzogliches
Museum.
Auf dem einzigen mir bekannten Abdruck, schließt der Rahmen
von Weiditz eine im Gegensinn von einer anderen Hand nach Dürers
Kupferstich B. 31 kopierte Muttergottes ein. Es wird auf der hier bei-
gegebenen verkleinerten Reproduktion nicht klar, daß diese Figur auf
einem besonderen Stock, der auch einen Teil des hintersten Pfeilerpaares
enthält, eingefügt ist.
Ich schrieb diesen Holzschnitt bereits dem Petrarca-Meister zu, als
ich ihn 1896 zum ersten Male sah. 1903, nach meinem zweiten Besuch in
Gotha, war Hofrat Purgold so freundlich, ihn nach Dresden zu senden,
wo er für mich mit Erlaubnis von Prof. M. Lehrs im K. Kupferstichkabinett
photographiert wurde. Der Stil des Meisters ist an den vier Evangelisten
leicht zu erkennen. Besonders mag der Engel des heiligen Matthäus mit
der heiligen Agnes und dem heiligen Lukas inSanctorumlcones verglichen
werden. Auch die Architektur und die Ornamente sind charakteristisch.
Bezüglich des Basreliefs sind besonders Petrarca II, 176 r. und das
Porträt Karls V., oben Nr. 2, zu vergleichen.
Ich will mit der Beschreibung von ein paar von Röttinger aus-
gelassenen Holzschnitten schließen, die in einem künftigen Katalog von
Weiditz' Werk sicher erscheinen müssen.
1. Das Wappen Georg Kungspergers, 100: 101, auf dem
Titelblatt von Joan. Eckii de materia Juramenti decisio, Grimm und
Wirsung, 1518, 4°. Panzer VI, 149, 116. Proctor 10, 876.
2. Porträt Karls V. 1518. Bremen. Dresden. Dürer Society, 1,20.
3. Wiederholung desselben Bildnisses von 1519. P. III,
223, 334 a. Der Kaiser sieht um ein Jahr älter aus, der Umriß seines
Barettes ist verändert worden. Oben nimmt ein Rundbogen die Stelle der
Füllhörner ein. Mir sind vier Abdrucke in zwei Zuständen bekannt:
I. Mit einer Blume auf dem Abakus einer jeden Säule. Unten
71/8 Zeilen Text, Von Gottes genaden wir Karoll Römischer
Künig, etc. ohne Datum oder Adresse. Wien, Albertina.
II. Die Blumen sind entfernt. Maihingen, beschnitten, so daß
der Text unten fehlt. London, auf Pergament, koloriert,
oben beschnitten. Unten 8 Zeilen Text, Carl von gottes
gnaden Römischer Künig etc. Am Schluß, Jost de Negker
zu Augsb. 1519. Bremen, ohne Text.
In Nr. 2 und in beiden Zuständen von Nr. 3 ist der Text mit der
Type von Grimm und Wirsung gedruckt.
In beiden Fassungen des Porträts erscheint mir der Charakter
des Ornaments die Autorschaft von Weiditz schlagend zu beweisen.
Ebenso wie bei dem Porträt Maximilians I. nach Dürer, B. 153, das ich
bereits Weiditz zugeschrieben habe, müssen wir annehmen, daß Weiditz
das Originalporträt eines anderen Künstlers (Burgkmairs?),1 entweder
eine Zeichnung oder einen Holzschnitt, der nicht mehr existiert, kopiert
und die Zeichnung auf dem Holzblock durch die Hinzufügung des von
ihm erfundenen Ornaments vervollständigt hat. Es hat den Anschein,
als ob er niemals ein Porträt nach dem Leben gezeichnet hätte. (Ganz
auf die nämliche Weise fügte er der buchstäblichen Kopie einer Mutter-
gottes von Burgkmair [B. 12, Rott. 49] sein eigenes Ornament bei.)
Sowohl Nr. 2 als auch Nr. 3 sind wegen ihrer Seltenheit viel
weniger bekannt als die fälschlich Dürer zugeschriebene Kopie, B.
App. 41, H. 2161, P. III, 223, 334, b, c. Auf dem letzteren ist das
kaiserliche Wappen mit Greifen als Wappenhältern nach einem anderen
Holzschnitt von Weiditz, P. III, 217, 303, in Faber, Oratio Funebris,
1519, Rott. 17, kopiert.
Dörnhöffer hat Weiditz ein weiteres in Gutekunsts Auktions-
katalog, 1904, S. 35, abgebildetes Porträt Karls V. zugeschrieben, das
in einem 1522 bei Holzel in Nürnberg gedruckten Buch (Muther 1166)
erschien. Ohne diese Zuweisung, die sicherlich durch die Behandlung
der Wappen unterstützt wird, endgültig ablehnen zu wollen, zweifle
ich doch, ob dieses Porträt von Weiditz selbst gezeichnet wurde; nicht
nur wegen seiner Herkunft, sondern auch, weil es mit Auswahl Einzel-
heiten von jedem der früheren Porträte wiederholt, das Barett von
Nr. 2 (vor der Ausbesserung des Umrisses), den Bogen und das Pfeil-
bündel von Nr. 3. Das betreffende Exemplar wurde vom Berliner Kupfer-
stichkabinett erstanden, wo es dem Werke Weiditz' zugerechnet wird.
1 Nach H. A. Schmid (Kunstchronik, N. F. V, Sp. 57) käme
möglicherweise Christoph Amberger in Betracht.
4—7. Vier Holzschnitte (Nr. 4 wiederholt), 75 : 107, in
»Ein warhafftige history von dem Kayser Friderich«, J.
Weißenburger, Landshut, 1519, 4°. Muther 1697, Proctor 11, 812.
Nr. 7, Die Gefangennahme Friedrich Barbarossas und seines
Kaplans durch Saladin, ist ein ausgezeichnetes Beispiel von Weiditz'
reifem Stil, ein besseres als irgend ein anderer 1519 publizierter Holz-
schnitt. Die übrigen Holzschnitte sind von einem außergewöhnlichen
Charakter, aber Weiditz' Autorschaft kann an seiner Gewohnheit, die
Gesichtszüge bloß mit Punkten zu zeichnen, wenn der Kopf recht klein
ist, erkannt werden. Vergleiche die winzigen berittenen Kinder und das
Medaillon an dem Barett auf dem Bildnis Karls V. (oben Nr. 2 und
3), auch Rott. 46 und Petrarca, II, 87 v.
8, 9. Das Wappen des Bischofs von Freising, des Pfalz-
grafen Philipp, 237 : 197, und Maria mit den Schutzheiligen von
Freising, Sigismund und Corbinian, 234 : 191, P. III. 201, 243, im
Freisinger Missale und in den Scamnalia derselben Diözese, beide bei
P. Liechtenstein für J. Oswald, Venedig, 1520, fol. gedruckt.
Beide Holzschnitte sind verkleinert bei Duc de Rivoli, Les
Misseis imprimes ä Venise, Seite 147, 148, Nr. 8 auch bei Warnecke,
Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts, Heft 3, Nr. 47, repro-
duziert.
10. Ein Fries, eine emblematische Darstellung von
Sommer und Winter, mit den Wappen des Kaiserreichs, Augsburgs
und Castiliens. 63 : 274. München, Hof- und Staatsbibliothek.
Die Kinder zerfallen in drei Gruppen; die erste trägt Spielzeug,
Kränze und grüne Zweige und umgibt den kaiserlichen Schild und eine
Tafel mit dem Namen Sumer; die zweite Gruppe trägt auf einer Trage
die Augsburger Pinie; die dritte, durch ein Täfelchen mit der Inschrift
Wintter kenntlich gemacht, ist in einen Schneeballenkampf verwickelt,
der sich um den spanischen Schild herum abspielt. Die Kinder gleichen
genau jenen auf dem Kinderalphabet, Rott. 39, und auf den Zierleisten,
die in verschiedenen Steiner-Büchern zu finden sind. (Vgl. die Abb.)
11. Ein architektonischer Rahmen mit den vier
Evangelisten. 1521. Mit der Adresse, Gedruckt tzu Augspurg durch
Jobst de Negker furmschneider. 341 : 223. Gotha, Herzogliches
Museum.
Auf dem einzigen mir bekannten Abdruck, schließt der Rahmen
von Weiditz eine im Gegensinn von einer anderen Hand nach Dürers
Kupferstich B. 31 kopierte Muttergottes ein. Es wird auf der hier bei-
gegebenen verkleinerten Reproduktion nicht klar, daß diese Figur auf
einem besonderen Stock, der auch einen Teil des hintersten Pfeilerpaares
enthält, eingefügt ist.
Ich schrieb diesen Holzschnitt bereits dem Petrarca-Meister zu, als
ich ihn 1896 zum ersten Male sah. 1903, nach meinem zweiten Besuch in
Gotha, war Hofrat Purgold so freundlich, ihn nach Dresden zu senden,
wo er für mich mit Erlaubnis von Prof. M. Lehrs im K. Kupferstichkabinett
photographiert wurde. Der Stil des Meisters ist an den vier Evangelisten
leicht zu erkennen. Besonders mag der Engel des heiligen Matthäus mit
der heiligen Agnes und dem heiligen Lukas inSanctorumlcones verglichen
werden. Auch die Architektur und die Ornamente sind charakteristisch.
Bezüglich des Basreliefs sind besonders Petrarca II, 176 r. und das
Porträt Karls V., oben Nr. 2, zu vergleichen.