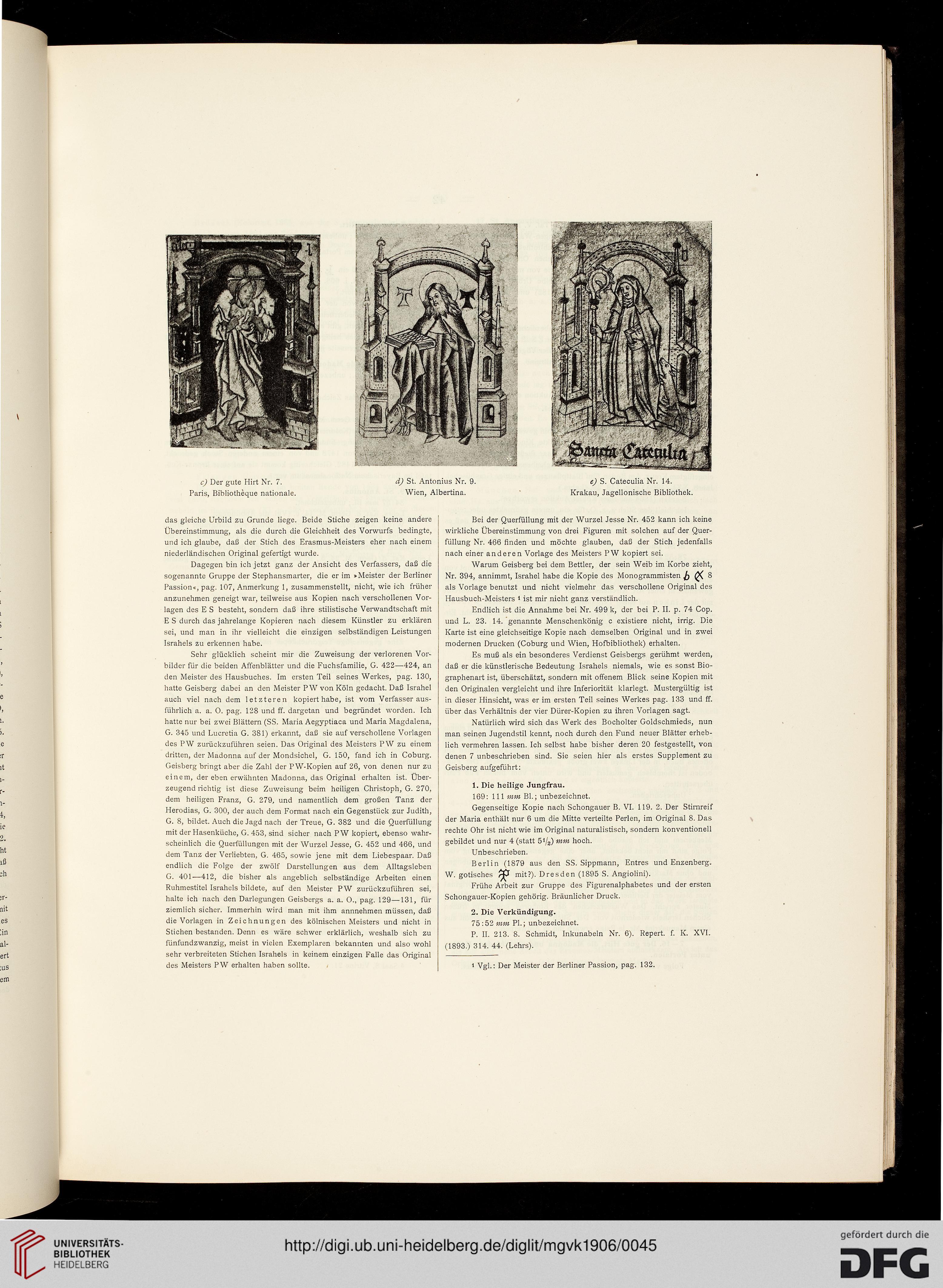c) Der gute Hirt Nr. 7.
Paris, Bibliotheque nationale.
d) St. Antonius Nr. 9.
Wien, Albertina.
t) S. Cateculia Nr. 14.
Krakau, Jagelionische Bibliothek.
das gleiche Urbild zu Grunde liege. Beide Stiche zeigen keine andere
Übereinstimmung, als die durch die Gleichheit des Vorwurfs bedingte,
und ich glaube, daß der Stich des Erasmus-Meisters eher nach einem
niederländischen Original gefertigt wurde.
Dagegen bin ich jetzt ganz der Ansicht des Versassers, daß die
sogenannte Gruppe der Stephansmarter, die er im »Meister der Berliner
Passion«, pag. 107, Anmerkung 1, zusammenstellt, nicht, wie ich früher
anzunehmen geneigt war, teilweise aus Kopien nach verschollenen Vor-
lagen des E S besteht, sondern daß ihre stilistische Verwandtschaft mit
E S durch das jahrelange Kopieren nach diesem Künstler zu erklären
sei, und man in ihr vielleicht die einzigen selbständigen Leistungen
Israhels zu erkennen habe.
Sehr glücklich scheint mir die Zuweisung der verlorenen Vor-
bilder für die beiden Afsenblätter und die Fuchsfamilie, G. 422—424, an
den Meister des Hausbuches. Im ersten Teil seines Werkes, pag. 130,
hatte Geisberg dabei an den Meister PW von Köln gedacht. Daß Israhel
auch viel nach dem letzteren kopiert habe, ist vom Verfasser aus-
sührlich a. a. 0. pag. 128 und sf. dargetan und begründet worden. Ich
hatte nur bei zwei Blättern (SS. Maria Aegyptiaca und Maria Magdalena,
G. 345 und Lucretia G. 381) erkannt, daß sie auf verschollene Vorlagen
des PW zurückzuführen seien. Das Original des Meisters PW zu einem
dritten, der Madonna auf der Mondsichel, G. 150, sand ich in Coburg.
Geisberg bringt aber die Zahl der PW-Kopien aus 26, von denen nur zu
einem, der eben erwähnten Madonna, das Original erhalten ist. Über-
zeugend richtig ist diese Zuweisung beim heiligen Christoph, G. 270,
dem heiligen Franz, G. 279, und namentlich dem großen Tanz der
Herodias, G. 300, der auch dem Format nach ein Gegenstück zur Judith,
G. 8, bildet. Auch die Jagd nach der Treue, G. 382 und die Querfüllung
mit der Hasenküche, G. 453, sind sicher nach PW kopiert, ebenso wahr-
scheinlich die Quersüllungen mit der Wurzel Jesse, G. 452 und 466, und
dem Tanz der Verliebten, G. 465, sowie jene mit dem Liebespaar. Daß
endlich die Folge der zwölf Darstellungen aus dem Alltagsleben
G. 401—412, die bisher als angeblich selbständige Arbeiten einen
Ruhmestitel Israhels bildete, aus den Meister PW zurückzuführen sei,
halte ich nach den Darlegungen Geisbergs a. a. O., pag. 129—131, sür
ziemlich sicher. Immerhin wird man mit ihm annnehmen müssen, daß
die Vorlagen in Zeichnungen des kölnischen Meisters und nicht in
Stichen bestanden. Denn es wäre schwer erklärlich, weshalb sich zu
fünfundzwanzig, meist in vielen Exemplaren bekannten und also wohl
sehr verbreiteten Stichen Israhels in keinem einzigen Falle das Original
des Meisters PW erhalten haben sollte. ,
Bei der Quersüllung mit der Wurzel Jesse Nr. 452 kann ich keine
wirkliche Übereinstimmung von drei Figuren mit solchen aus der Quer-
süllung Nr. 466 sinden und möchte glauben, daß der Stich jedensalls
nach einer anderen Vorlage des Meisters PW kopiert sei.
Warum Geisberg bei dem Bettler, der sein Weib im Korbe zieht,
Nr. 394, annimmt, Israhel habe die Kopie des Monogrammisten fo Q\ 8
als Vorlage benutzt und nicht vielmehr das verschollene Original des
Hausbuch-Meisters f ist mir nicht ganz verständlich.
Endlich ist die Annahme bei Nr. 499 k, der bei P. II. p. 74 Cop.
und L. 23. 14. genannte Menschenkönig c existiere nicht, irrig. Die
Karte ist eine gleichseitige Kopie nach demselben Original und in zwei
modernen Drucken (Coburg und Wien, Hosbibliothek) erhalten.
Es muß als ein besonderes Verdienst Geisbergs gerühmt werden,
daß er die künstlerische Bedeutung Israhels niemals, wie es sonst Bio-
graphenart ist, überschätzt, sondern mit osfenem Blick seine Kopien mit
den Originalen vergleicht und ihre Inseriorität klarlegt. Mustergültig ist
in dieser Hinsicht, was er im ersten Teil seines Werkes pag. 133 und sf.
über das Verhältnis der vier Dürer-Kopien zu ihren Vorlagen sagt.
Natürlich wird sich das Werk des Bocholter Goldschmieds, nun
man seinen Jugendstil kennt, noch durch den Fund neuer Blätter erheb-
lich vermehren lassen. Ich selbst habe bisher deren 20 sestgestellt, von
denen 7 unbeschrieben sind. Sie seien hier als erstes Supplement zu
Geisberg ausgeführt:
1. Die heilige Jungsrau.
169: 111 mm BL; unbezeichnet.
Gegenseitige Kopie nach Schongauer B. VI. 119. 2. Der Stirnreis
der Maria enthält nur 6 um die Mitte verteilte Perlen, im Original 8. Das
rechte Ohr ist nicht wie im Original naturalistisch, sondern konventionell
gebildet und nur 4 (statt 5'/3) mm hoch.
Unbeschrieben.
Berlin (1879 aus den SS. Sippmann, Entres und Enzenberg.
W. gotisches r& mit?). Dresden (1895 S. Angiolini).
Frühe Arbeit zur Gruppe des Figurenalphabetes und der ersten
Schongauer-Kopien gehörig. Bräunlicher Druck.
2. Die Verkündigung.
75:52 mm PI.; unbezeichnet.
P. IL 213. 8. Schmidt, Inkunabeln Nr. 6). Repert. s. K. XVI.
(1893.) 314. 44. (Lehrs).
i Vgl.: Der Meister der Berliner Passion, pag. 132.