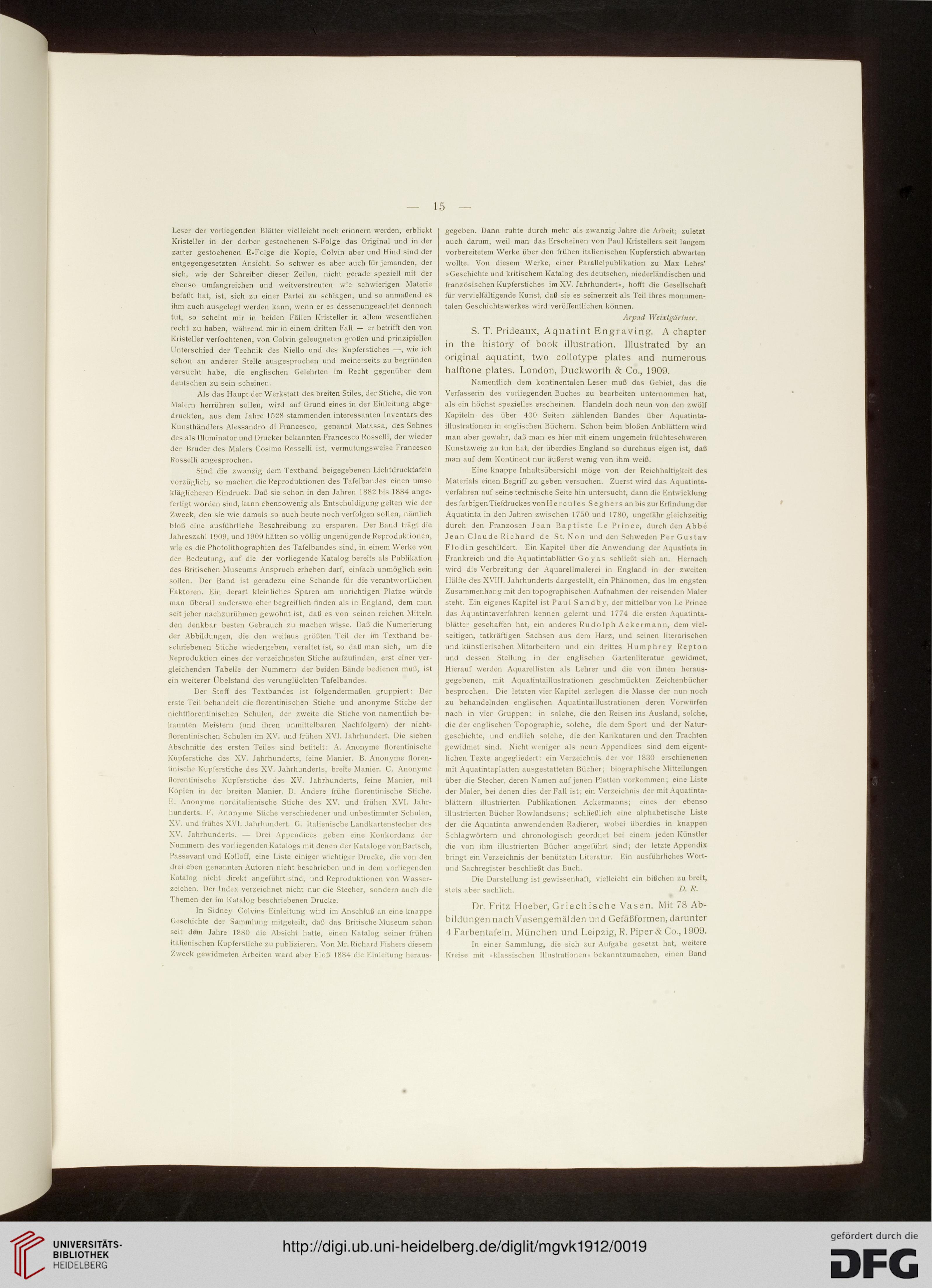15 —
Leser der vorliegenden Blätter vielleicht noch erinnern werden, erblickt
Kristeller in der derber gestochenen S-Folge das Original und in der
zarter gestochenen E-Folge die Kopie, Colvin aber und Hind sind der
entgegengesetzten Ansicht. So schwer es aber auch für jemanden, der
sich, wie der Schreiber dieser Zeilen, nicht gerade speziell mit der
ebenso umfangreichen und weitverstreuten wie schwierigen Materie
befaßt hat, ist, sich zu einer Partei zu schlagen, und so anmaßend es
ihm auch ausgelegt werden kann, wenn er es dessenungeachtet dennoch
tut, so scheint mir in beiden Fällen Kristeller in allem wesentlichen
recht zu haben, wahrend mir in einem dritten Fall — er betrifft den von
Kristeller verfochtenen, von Colvin geleugneten großen und prinzipiellen
Unterschied der Technik des Niello und des Kupferstiches —, wie ich
schon an anderer Stelle ausgesprochen und meinerseits zu begründen
versucht habe, die englischen Gelehrten im Recht gegenüber dem
deutschen zu sein scheinen.
Als das Haupt der Werkstatt des breiten Stiles, der Stiche, die von
Malern herrühren sollen, wird auf Grund eines in der Einleitung abge-
druckten, aus dem Jahre 1528 stammenden interessanten Inventars des
Kunsthändlers Alessandro di Francesco, genannt Matassa, des Sohnes
des als Illuminator und Drucker bekannten Francesco Rosselli, der wieder
der Bruder des Malers Cosimo Rosselli ist, vermutungsweise Francesco
Rosselli angesprochen.
Sind die zwanzig dem Textband beigegebenen Lichtdrucktafeln
vorzüglich, so machen die Reproduktionen des Tafelbandes einen umso
kläglicheren Eindruck. Daß sie schon in den Jahren 1882 bis 1884 ange-
fertigt worden sind, kann ebensowenig als Entschuldigung gelten wie der
Zweck, den sie wie damals so auch heute noch verfolgen sollen, nämlich
bloß eine ausführliche Beschreibung zu ersparen. Der Band trägt die
Jahreszahl 1909, und 1909 hätten so völlig ungenügende Reproduktionen,
wie es die Photolithographien des Tafelbandes sind, in einem Werke von
der Bedeutung, auf die der vorliegende Katalog bereits als Publikation
des Britischen Museums Anspruch erheben darf, einfach unmöglich sein
sollen. Der Band ist geradezu eine Schande für die verantwortlichen
Faktoten. Ein derart kleinliches Sparen am unrichtigen Platze würde
man überall anderswo eher begreiflich finden als in England, dem man
seit Jeher nachzurühmen gewohnt ist, daß es von seinen reichen Mitteln
den denkbar besten Gebrauch zu machen wisse. Daß die Numerierung
der Abbildungen, die den weitaus größten Teil der im Textband be-
schriebenen Stiche wiedergeben, veraltet ist, so daß man sich, um die
Reproduktion eines der \ erzeichneten Stiche aufzufinden, erst einer ver-
gleichenden Tabelle der Nummern der beiden Bände bedienen muß, ist
ein weiterer Übelstand des verunglückten Tafelbandes.
Der Stoff des Textbandes ist folgendermaßen gruppiert: Der
erste Teil behandelt die florentinischen Stiche und anonj'me Stiche der
nichtfiorentinischen Schulen, der zweite die Stiche von namentlich be-
kannten Meistern (und ihren unmittelbaren Nachfolgern) der nicht-
fiorentinischen Schulen im XV. und frühen XVI. Jahrhundert. Die sieben
Abschnitte des ersten Teiles sind betitelt: A. Anonyme florentinische
Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, feine Manier. B. Anonyme floren-
tinische Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, breite Manier. C. Anonyme
florentinische Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, feine Manier, mit
Kopien in der breiten Manier. D. Andere frühe florentinische Stiche.
E. Anonyme nordilalienische Stiche des XV. und frühen XVI. Jahr-
hunderts. F. Anonyme Stiche verschiedener und unbestimmter Schulen,
XV. und frühes XVI. Jahrhundert. G. Italienische Landkartenstecher des
XV. Jahrhunderts. — Drei Appendices geben eine Konkordanz der
Nummern des vorliegenden Katalogs mit denen der Kataloge von Bartsch,
Passavant und Kolloff, eine Liste einiger wichtiger Drucke, die von den
drei eben genannten Autoren nicht beschrieben und in dem vorliegenden
Katalog nicht direkt angeführt sind, und Reproduktionen von Wasser-
zeichen. Der Index verzeichnet nicht nur die Stecher, sondern auch die
Themen der im Katalog beschriebenen Drucke.
In Sidney Colvins Einleitung wird im Anschluß an eine knappe
Geschichte der Sammlung mitgeteilt, daß das Britische Museum schon
seit dem Jahre 1880 die Absicht hatte, einen Katalog seiner frühen
italienischen Kupferstiche zu publizieren. Von Mr. Richard Fishers diesem
Zweck gewidmeten Arbeiten ward aber bloß 1884 die Einleitung heraus-
gegeben. Dann ruhte durch mehr als zwanzig Jahre die Arbeit; zuletzt
auch darum, weil man das Erscheinen von Paul Kristellers seit langem
vorbereitetem Werke über den frühen italienischen Kupferstich abwarten
wollte. Von diesem Werke, einer Pnrallelpublikation zu Max Lehrs"
»Geschichte und kritischem Katalog des deutschen, niederländischen und
französischen Kupferstiches im XV. Jahrhundert«, hofft die Gesellschaft
für vervielfältigende Kunst, daß sie es seinerzeit als Teil ihres monumen-
talen Gcscluchtswerkes wird veröffentlichen können.
Arpad Weixlgärtner.
S. T. Prideaux, Aquatint Engraving. A chapter
in the history of book Illustration. Illustrated by an
original aquatint, tvvo collotype plates and numerous
halftone plates. London, Duckworth & Co., 1909.
Namentlich dem kontinentalen Leser muß das Gebiet, das die
Verfasserin des vorliegenden Buches zu bearbeiten unternommen hat,
als ein höchst spezielles erscheinen. Handeln doch neun von den zwölf
Kapiteln des über 400 Seiten zählenden Bandes über Aquatinta-
illustrationen in englischen Büchern. Schon beim bloßen Anblättern wird
man aber gewahr, daß man es hier mit einem ungemein früchteschweren
Kunstzweig zu tun hat, der überdies England so durchaus eigen ist, daß
man auf dem Kontinent nur äußerst wenig von ihm weiß.
Eine knappe Inhaltsübersicht möge von der Reichhaltigkeit des
Materials einen Begriff zu geben versuchen. Zuerst wird das Aquatinta-
verfahren auf seine technische Seite hin untersucht, dann die Entwicklung
des farbigen Tiefdruckes von Hercules Seghers an bis zur Erfindung der
Aquatinta in den Jahren zwischen 1750 und 1780, ungefähr gleichzeitig
durch den Franzosen Jean Baptiste Le Prince, durch den Abbe
Jean Claude Richard de St. Non und den Schweden Per Gustav
Fl od in geschildert. Ein Kapitel über die Anwendung der Aquatinta in
Frankreich und die Aquatintablätter Go vas schließt sich an. Hernach
wird die Verbreitung der Aquarellmalerei in England in der zweiten
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts dargestellt, ein Phänomen, das im engsten
Zusammenhang mit den topographischen Aufnahmen der reisenden Maler
steht. Ein eigenes Kapitel ist Paul Sandby, der mittelbar von Le Prince
das Aquatintaverfahren kennen gelernt und 1774 die ersten Aquatinta-
blätter geschaffen hat. ein anderes Rudolph Ackermann, dem viel-
seitigen, tatkräftigen Sachsen aus dem Harz, und seinen literarischen
und künstlerischen Mitarbeitein und ein drittes Humphrey Repton
und dessen Stellung in der englischen Gaitenliteratur gewidmet.
Hierauf werden Aquarellisten als Lehrer und die von ihnen heraus-
gegebenen, mit Aquatinlaillustrationen geschmückten Zeichenbucher
besprochen. Die letzten vier Kapitel zerlegen die Masse der nun noch
zu behandelnden englischen Aquatintaillustrationen deren Vorwürfen
nach in vier Gruppen: in solche, die den Reisen ins Ausland, solche,
die der englischen Topographie, solche, die dem Sport und der Natur-
geschichte, und endlich solche, die den Karikaturen und den Trachten
gewidmet sind. Nicht weniger als neun Appendices sind dem eigent-
lichen Texte angegliedert: ein Verzeichnis der vor 1830 erschienenen
mit Aquatintaplatten ausgestatteten Bücher; biographische Mitteilungen
über die Stecher, deren Namen auf jenen Platten vorkommen; eine Liste
der Maler, bei denen dies der Fall ist, ein Verzeichnis der mit Aquatinta-
blättem illustrierten Publikationen Ackermanns; eines der ebenso
illustrierten Bücher Rowlandsons; schließlich eine alphabetische Liste
der die Aquatinta anwendenden Radierer, wobei überdies in knappen
Schlagwörtern und chronologisch geordnet bei einem jeden Künstler
die von ihm illustrierten Bücher angeführt sind; der letzte Appendix
billigt ein Verzeichnis der benützten Literatur. Ein ausführliches Wort-
und Sachregister beschließt das Buch.
Die Darstellung ist gewissenhaft, vielleicht ein bißchen zu breit,
stets aber sachlich. D- Ä.
Dr. Fritz Hoeber, Griechische Vasen. Mit 7S Ab-
bildungen nach Vasengemälden und Gefäßformen, darunter
4 Faibentafeln. München und Leipzig, R. Piper & Co., 1909.
In einer Sammlung, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, weitere
Kreise mit klassischen Illustrationen« bekanntzumachen, einen Band
Leser der vorliegenden Blätter vielleicht noch erinnern werden, erblickt
Kristeller in der derber gestochenen S-Folge das Original und in der
zarter gestochenen E-Folge die Kopie, Colvin aber und Hind sind der
entgegengesetzten Ansicht. So schwer es aber auch für jemanden, der
sich, wie der Schreiber dieser Zeilen, nicht gerade speziell mit der
ebenso umfangreichen und weitverstreuten wie schwierigen Materie
befaßt hat, ist, sich zu einer Partei zu schlagen, und so anmaßend es
ihm auch ausgelegt werden kann, wenn er es dessenungeachtet dennoch
tut, so scheint mir in beiden Fällen Kristeller in allem wesentlichen
recht zu haben, wahrend mir in einem dritten Fall — er betrifft den von
Kristeller verfochtenen, von Colvin geleugneten großen und prinzipiellen
Unterschied der Technik des Niello und des Kupferstiches —, wie ich
schon an anderer Stelle ausgesprochen und meinerseits zu begründen
versucht habe, die englischen Gelehrten im Recht gegenüber dem
deutschen zu sein scheinen.
Als das Haupt der Werkstatt des breiten Stiles, der Stiche, die von
Malern herrühren sollen, wird auf Grund eines in der Einleitung abge-
druckten, aus dem Jahre 1528 stammenden interessanten Inventars des
Kunsthändlers Alessandro di Francesco, genannt Matassa, des Sohnes
des als Illuminator und Drucker bekannten Francesco Rosselli, der wieder
der Bruder des Malers Cosimo Rosselli ist, vermutungsweise Francesco
Rosselli angesprochen.
Sind die zwanzig dem Textband beigegebenen Lichtdrucktafeln
vorzüglich, so machen die Reproduktionen des Tafelbandes einen umso
kläglicheren Eindruck. Daß sie schon in den Jahren 1882 bis 1884 ange-
fertigt worden sind, kann ebensowenig als Entschuldigung gelten wie der
Zweck, den sie wie damals so auch heute noch verfolgen sollen, nämlich
bloß eine ausführliche Beschreibung zu ersparen. Der Band trägt die
Jahreszahl 1909, und 1909 hätten so völlig ungenügende Reproduktionen,
wie es die Photolithographien des Tafelbandes sind, in einem Werke von
der Bedeutung, auf die der vorliegende Katalog bereits als Publikation
des Britischen Museums Anspruch erheben darf, einfach unmöglich sein
sollen. Der Band ist geradezu eine Schande für die verantwortlichen
Faktoten. Ein derart kleinliches Sparen am unrichtigen Platze würde
man überall anderswo eher begreiflich finden als in England, dem man
seit Jeher nachzurühmen gewohnt ist, daß es von seinen reichen Mitteln
den denkbar besten Gebrauch zu machen wisse. Daß die Numerierung
der Abbildungen, die den weitaus größten Teil der im Textband be-
schriebenen Stiche wiedergeben, veraltet ist, so daß man sich, um die
Reproduktion eines der \ erzeichneten Stiche aufzufinden, erst einer ver-
gleichenden Tabelle der Nummern der beiden Bände bedienen muß, ist
ein weiterer Übelstand des verunglückten Tafelbandes.
Der Stoff des Textbandes ist folgendermaßen gruppiert: Der
erste Teil behandelt die florentinischen Stiche und anonj'me Stiche der
nichtfiorentinischen Schulen, der zweite die Stiche von namentlich be-
kannten Meistern (und ihren unmittelbaren Nachfolgern) der nicht-
fiorentinischen Schulen im XV. und frühen XVI. Jahrhundert. Die sieben
Abschnitte des ersten Teiles sind betitelt: A. Anonyme florentinische
Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, feine Manier. B. Anonyme floren-
tinische Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, breite Manier. C. Anonyme
florentinische Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, feine Manier, mit
Kopien in der breiten Manier. D. Andere frühe florentinische Stiche.
E. Anonyme nordilalienische Stiche des XV. und frühen XVI. Jahr-
hunderts. F. Anonyme Stiche verschiedener und unbestimmter Schulen,
XV. und frühes XVI. Jahrhundert. G. Italienische Landkartenstecher des
XV. Jahrhunderts. — Drei Appendices geben eine Konkordanz der
Nummern des vorliegenden Katalogs mit denen der Kataloge von Bartsch,
Passavant und Kolloff, eine Liste einiger wichtiger Drucke, die von den
drei eben genannten Autoren nicht beschrieben und in dem vorliegenden
Katalog nicht direkt angeführt sind, und Reproduktionen von Wasser-
zeichen. Der Index verzeichnet nicht nur die Stecher, sondern auch die
Themen der im Katalog beschriebenen Drucke.
In Sidney Colvins Einleitung wird im Anschluß an eine knappe
Geschichte der Sammlung mitgeteilt, daß das Britische Museum schon
seit dem Jahre 1880 die Absicht hatte, einen Katalog seiner frühen
italienischen Kupferstiche zu publizieren. Von Mr. Richard Fishers diesem
Zweck gewidmeten Arbeiten ward aber bloß 1884 die Einleitung heraus-
gegeben. Dann ruhte durch mehr als zwanzig Jahre die Arbeit; zuletzt
auch darum, weil man das Erscheinen von Paul Kristellers seit langem
vorbereitetem Werke über den frühen italienischen Kupferstich abwarten
wollte. Von diesem Werke, einer Pnrallelpublikation zu Max Lehrs"
»Geschichte und kritischem Katalog des deutschen, niederländischen und
französischen Kupferstiches im XV. Jahrhundert«, hofft die Gesellschaft
für vervielfältigende Kunst, daß sie es seinerzeit als Teil ihres monumen-
talen Gcscluchtswerkes wird veröffentlichen können.
Arpad Weixlgärtner.
S. T. Prideaux, Aquatint Engraving. A chapter
in the history of book Illustration. Illustrated by an
original aquatint, tvvo collotype plates and numerous
halftone plates. London, Duckworth & Co., 1909.
Namentlich dem kontinentalen Leser muß das Gebiet, das die
Verfasserin des vorliegenden Buches zu bearbeiten unternommen hat,
als ein höchst spezielles erscheinen. Handeln doch neun von den zwölf
Kapiteln des über 400 Seiten zählenden Bandes über Aquatinta-
illustrationen in englischen Büchern. Schon beim bloßen Anblättern wird
man aber gewahr, daß man es hier mit einem ungemein früchteschweren
Kunstzweig zu tun hat, der überdies England so durchaus eigen ist, daß
man auf dem Kontinent nur äußerst wenig von ihm weiß.
Eine knappe Inhaltsübersicht möge von der Reichhaltigkeit des
Materials einen Begriff zu geben versuchen. Zuerst wird das Aquatinta-
verfahren auf seine technische Seite hin untersucht, dann die Entwicklung
des farbigen Tiefdruckes von Hercules Seghers an bis zur Erfindung der
Aquatinta in den Jahren zwischen 1750 und 1780, ungefähr gleichzeitig
durch den Franzosen Jean Baptiste Le Prince, durch den Abbe
Jean Claude Richard de St. Non und den Schweden Per Gustav
Fl od in geschildert. Ein Kapitel über die Anwendung der Aquatinta in
Frankreich und die Aquatintablätter Go vas schließt sich an. Hernach
wird die Verbreitung der Aquarellmalerei in England in der zweiten
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts dargestellt, ein Phänomen, das im engsten
Zusammenhang mit den topographischen Aufnahmen der reisenden Maler
steht. Ein eigenes Kapitel ist Paul Sandby, der mittelbar von Le Prince
das Aquatintaverfahren kennen gelernt und 1774 die ersten Aquatinta-
blätter geschaffen hat. ein anderes Rudolph Ackermann, dem viel-
seitigen, tatkräftigen Sachsen aus dem Harz, und seinen literarischen
und künstlerischen Mitarbeitein und ein drittes Humphrey Repton
und dessen Stellung in der englischen Gaitenliteratur gewidmet.
Hierauf werden Aquarellisten als Lehrer und die von ihnen heraus-
gegebenen, mit Aquatinlaillustrationen geschmückten Zeichenbucher
besprochen. Die letzten vier Kapitel zerlegen die Masse der nun noch
zu behandelnden englischen Aquatintaillustrationen deren Vorwürfen
nach in vier Gruppen: in solche, die den Reisen ins Ausland, solche,
die der englischen Topographie, solche, die dem Sport und der Natur-
geschichte, und endlich solche, die den Karikaturen und den Trachten
gewidmet sind. Nicht weniger als neun Appendices sind dem eigent-
lichen Texte angegliedert: ein Verzeichnis der vor 1830 erschienenen
mit Aquatintaplatten ausgestatteten Bücher; biographische Mitteilungen
über die Stecher, deren Namen auf jenen Platten vorkommen; eine Liste
der Maler, bei denen dies der Fall ist, ein Verzeichnis der mit Aquatinta-
blättem illustrierten Publikationen Ackermanns; eines der ebenso
illustrierten Bücher Rowlandsons; schließlich eine alphabetische Liste
der die Aquatinta anwendenden Radierer, wobei überdies in knappen
Schlagwörtern und chronologisch geordnet bei einem jeden Künstler
die von ihm illustrierten Bücher angeführt sind; der letzte Appendix
billigt ein Verzeichnis der benützten Literatur. Ein ausführliches Wort-
und Sachregister beschließt das Buch.
Die Darstellung ist gewissenhaft, vielleicht ein bißchen zu breit,
stets aber sachlich. D- Ä.
Dr. Fritz Hoeber, Griechische Vasen. Mit 7S Ab-
bildungen nach Vasengemälden und Gefäßformen, darunter
4 Faibentafeln. München und Leipzig, R. Piper & Co., 1909.
In einer Sammlung, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, weitere
Kreise mit klassischen Illustrationen« bekanntzumachen, einen Band