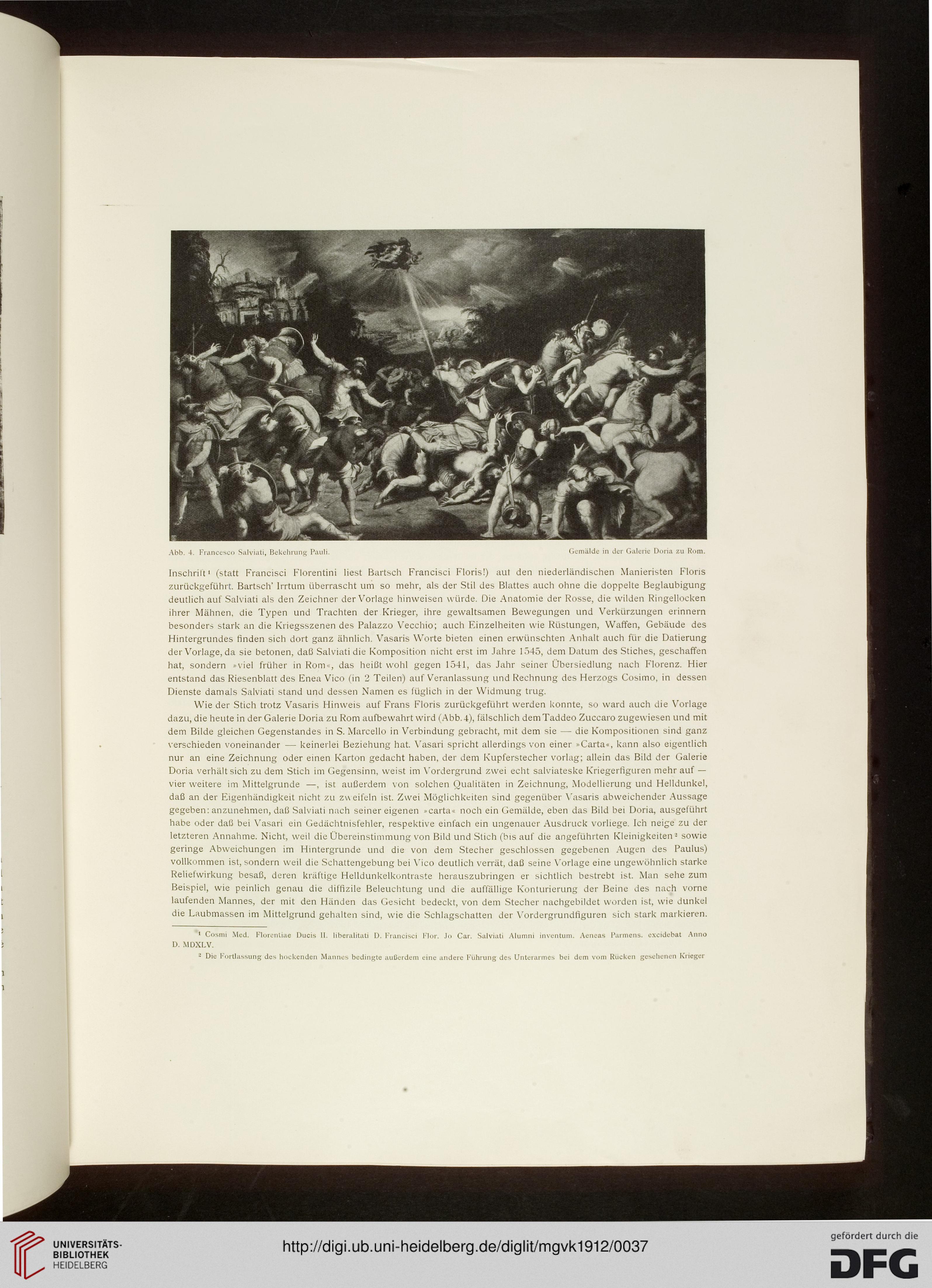■ Galerie Unna zu Rum.
Inschrift' (statt Francisci Florentini liest Bartsch Francisci Floris!) aut den niederländischen Manieristen Kloris
zurückgeführt. Bartsch' Irrtum überrascht um so mehr, als der Stil des Blattes auch ohne die doppelte Beglaubigung
deutlich auf Salviati als den Zeichner der Vorlage hinweisen würde. Die Anatomie der Rosse, die wilden Ringellocken
ihrer Mähnen, die Typen und Trachten der Krieger, ihre gewaltsamen Bewegungen und Verkürzungen erinnern
besonders stark an die Kriegsszenen des Palazzo Vecchio; auch Einzelheiten wie Rüstungen, Waffen, Gebäude des
Hintergrundes finden sich dort ganz ähnlich. Vasaris Worte bieten einen erwünschten Anhalt auch für die Datierung
der Vorlage, da sie betonen, daß Salviati die Komposition nicht erst im Jahre 1545, dem Datum des Stiches, geschaffen
hat, sondern »viel früher in Rom«, das heißt wohl gegen 1541, das Jahr seiner Übersiedlung nach Florenz. Hier
entstand das Riesenblatt des Enea Vico (in 2 Teilen) auf Veranlassung und Rechnung des Herzogs Cosimo, in dessen
Dienste damals Salviati stand und dessen Namen es füglich in der Widmung trug.
Wie der Stich trotz Vasaris Hinweis auf Frans Floris zurückgeführt werden konnte, so ward auch die Vorlage
dazu, die heute in der Galerie Doria zu Rom aufbewahrt wird (Abb.4), fälschlich demTaddeo Zuccaro zugewiesen und mit
dem Bilde gleichen Gegenstandes in S. Marcello in Verbindung gebracht, mit dem sie — die Kompositionen sind ganz
verschieden voneinander — keinerlei Beziehung hat. Vasari spricht allerdings von einer »Carta«, kann also eigentlich
nur an eine Zeichnung oder einen Karton gedacht haben, der dem Kupferstecher vorlag; allein das Bild der Galerie
Doria verhält sich zu dem Stich im Gegensinn, weist im Vordergrund zwei echt salviateske Kriegerfiguren mehr auf —
vier weitere im Mittelgrunde —, ist außerdem von solchen Qualitäten in Zeichnung, Modellierung und Helldunkel,
daß an der Eigenhändigkeit nicht zu zweifeln ist. Zwei Möglichkeiten sind gegenüber Vasaris abweichender Aussage
gegeben: anzunehmen, daß Salviati nach seiner eigenen »carta« noch ein Gemälde, eben das Bild bei Doria, ausgeführt
habe oder daß bei Vasari ein Gedächtnisfehler, respektive einfach ein ungenauer Ausdruck vorliege. Ich neige zu der
letzteren Annahme. Nicht, weil die Übereinstimmung von Bild und Stich (bis auf die angeführten Kleinigkeiten- sowie
geringe Abweichungen im Hintergrunde und die von dem Stecher geschlossen gegebenen Augen des Paulus)
vollkommen ist, sondern weil die Schattengebung bei Vico deutlich verrät, daß seine Vorlage eine ungewöhnlich starke
Reliefwirkung besaß, deren kräftige Helldunkelkontraste herauszubringen er sichtlich bestrebt ist. Man sehe zum
Beispiel, wie peinlich genau die diffizile Beleuchtung und die auffällige Konturierung der Beine des nach vorne
laufenden Mannes, der mit den Händen das Gesicht bedeckt, von dem Stecher nachgebildet worden ist, wie dunkel
die Laubmassen im Mittelgrund gehalten sind, wie die Schlagschatten der Vordergrundfiguren sich stark markieren.
1 Cosmi Med. Florentiae Ducis
D. MDXLV.
2 Die Fortlassung des hockenden Mannes bedingte außerdem eine andere Führung des Unterar
Hberalitati D. Francisci Flur. Jn Car. Salviati Alumni inventum. Aeneas Parmens. exeidebat Anno
ei dem vom Rücken gesehenen Krieger
Inschrift' (statt Francisci Florentini liest Bartsch Francisci Floris!) aut den niederländischen Manieristen Kloris
zurückgeführt. Bartsch' Irrtum überrascht um so mehr, als der Stil des Blattes auch ohne die doppelte Beglaubigung
deutlich auf Salviati als den Zeichner der Vorlage hinweisen würde. Die Anatomie der Rosse, die wilden Ringellocken
ihrer Mähnen, die Typen und Trachten der Krieger, ihre gewaltsamen Bewegungen und Verkürzungen erinnern
besonders stark an die Kriegsszenen des Palazzo Vecchio; auch Einzelheiten wie Rüstungen, Waffen, Gebäude des
Hintergrundes finden sich dort ganz ähnlich. Vasaris Worte bieten einen erwünschten Anhalt auch für die Datierung
der Vorlage, da sie betonen, daß Salviati die Komposition nicht erst im Jahre 1545, dem Datum des Stiches, geschaffen
hat, sondern »viel früher in Rom«, das heißt wohl gegen 1541, das Jahr seiner Übersiedlung nach Florenz. Hier
entstand das Riesenblatt des Enea Vico (in 2 Teilen) auf Veranlassung und Rechnung des Herzogs Cosimo, in dessen
Dienste damals Salviati stand und dessen Namen es füglich in der Widmung trug.
Wie der Stich trotz Vasaris Hinweis auf Frans Floris zurückgeführt werden konnte, so ward auch die Vorlage
dazu, die heute in der Galerie Doria zu Rom aufbewahrt wird (Abb.4), fälschlich demTaddeo Zuccaro zugewiesen und mit
dem Bilde gleichen Gegenstandes in S. Marcello in Verbindung gebracht, mit dem sie — die Kompositionen sind ganz
verschieden voneinander — keinerlei Beziehung hat. Vasari spricht allerdings von einer »Carta«, kann also eigentlich
nur an eine Zeichnung oder einen Karton gedacht haben, der dem Kupferstecher vorlag; allein das Bild der Galerie
Doria verhält sich zu dem Stich im Gegensinn, weist im Vordergrund zwei echt salviateske Kriegerfiguren mehr auf —
vier weitere im Mittelgrunde —, ist außerdem von solchen Qualitäten in Zeichnung, Modellierung und Helldunkel,
daß an der Eigenhändigkeit nicht zu zweifeln ist. Zwei Möglichkeiten sind gegenüber Vasaris abweichender Aussage
gegeben: anzunehmen, daß Salviati nach seiner eigenen »carta« noch ein Gemälde, eben das Bild bei Doria, ausgeführt
habe oder daß bei Vasari ein Gedächtnisfehler, respektive einfach ein ungenauer Ausdruck vorliege. Ich neige zu der
letzteren Annahme. Nicht, weil die Übereinstimmung von Bild und Stich (bis auf die angeführten Kleinigkeiten- sowie
geringe Abweichungen im Hintergrunde und die von dem Stecher geschlossen gegebenen Augen des Paulus)
vollkommen ist, sondern weil die Schattengebung bei Vico deutlich verrät, daß seine Vorlage eine ungewöhnlich starke
Reliefwirkung besaß, deren kräftige Helldunkelkontraste herauszubringen er sichtlich bestrebt ist. Man sehe zum
Beispiel, wie peinlich genau die diffizile Beleuchtung und die auffällige Konturierung der Beine des nach vorne
laufenden Mannes, der mit den Händen das Gesicht bedeckt, von dem Stecher nachgebildet worden ist, wie dunkel
die Laubmassen im Mittelgrund gehalten sind, wie die Schlagschatten der Vordergrundfiguren sich stark markieren.
1 Cosmi Med. Florentiae Ducis
D. MDXLV.
2 Die Fortlassung des hockenden Mannes bedingte außerdem eine andere Führung des Unterar
Hberalitati D. Francisci Flur. Jn Car. Salviati Alumni inventum. Aeneas Parmens. exeidebat Anno
ei dem vom Rücken gesehenen Krieger