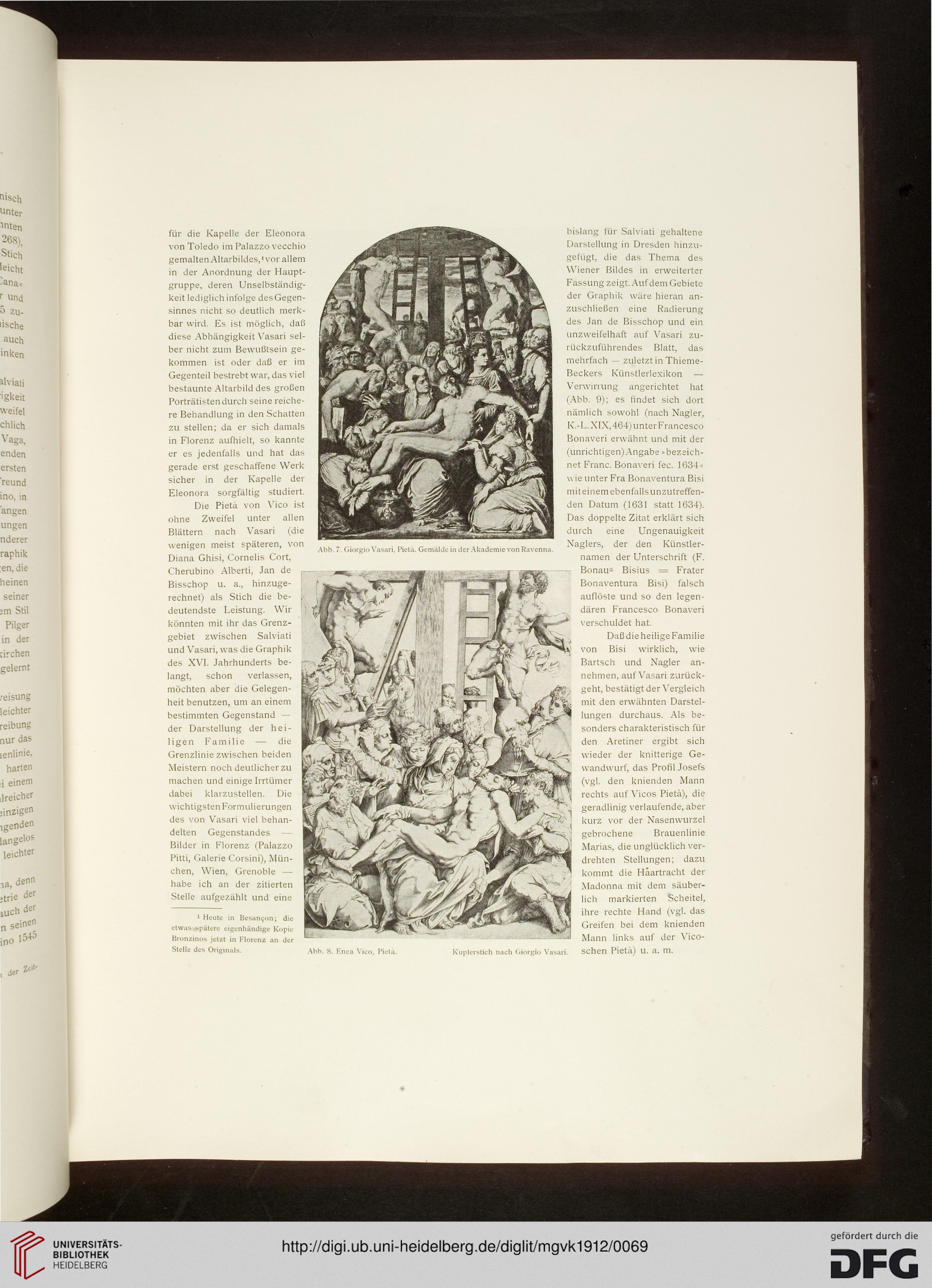für die Kapelle der Eleonora
von Toledo im Palazzo vecchio
gemalten Altarbildes,'vor allem
in der Anordnung der Haupt-
gruppe, deren Unselbständig-
keit lediglieh infolge des Gegen-
sinnes nicht so deutlieh merk-
bar wird. Es ist möglich, daß
diese Abhängigkeit Vasari sel-
ber nicht zum Bewußtsein ge-
kommen ist oder daß er im
Gegenteil bestrebt war, das viel
bestaunte Altarbild des großen
Porträtistendurch seine reiche-
re Behandlung in den Schatten
zu stellen; da er sich damals
in Florenz aufhielt, so kannte
er es jedenfalls und hat das
gerade erst geschaffene Werk
sicher in der Kapelle der
Eleonora sorgfältig studiert.
Die Pieta von Yico ist
ohne Zweifel unter allen
Blättern nach Vasari (die
wenigen meist späteren, von
Diana Ghisi, Cornelis Cort,
Cherubino Alberti, Jan de
Bisschop u. a., hinzuge-
rechnet) als Stich die be-
deutendste Leistung. Wir
könnten mit ihr das Grenz-
gebiet zwischen Salviati
und Vasari, was die Graphik
des XVI. Jahrhunderts be-
langt, schon verlassen,
möchten aber die Gelegen-
heit benutzen, um an einem
bestimmten Gegenstand —
der Darstellung der hei-
ligen Familie — die
Grenzlinie zwischen beiden
Meistern noch deutlicher zu
machen und einige Irrtümer
dabei klarzustellen. Die
wichtigsten Formulierungen
des von Vasari viel behan-
delten Gegenstandes
Bilder in Florenz (Palazzo
Pitti, Galerie Corsini), Mün-
chen, Wien, Grenoble —
habe ich an der zitierten
Stelle aufgezählt und eine
Abb. 7. Giorgio Vasari, Pieta. Gemälde in der Akademie vonRavenna
1 Heute in Besancon; die
etwas spatere eigenhändige Kupie
Bronzinos jetzt in Florenz an der
Stelle des Originals.
, l'leta.
Kupferstich
bislang für Salviati gehaltene
Darstellung in Dresden hinzu-
gefügt, die das Thema des
Wiener Bildes in erweiterter
Fassung zeigt. Auf dem Gebiete
der Graphik wäre hieran an-
zuschließen eine Radierung
des Jan de Bisschop und ein
unzweifelhaft auf Vasari zu-
rückzuführendes Blatt, das
mehrfach — zuletzt in Thieme-
Beckers Künstlerlexikon —
Verwirrung angerichtet hat
(Abb. 9); es findet sich dort
nämlich sowohl (nach Nagler,
K.-L.XIX,464) unter Francesco
Bonaveri erwähnt und mit der
(unrichtigen) Angabe »bezeich-
net Franc. Bonaveri fec. 1634-«
w ie unter Fra Bonaventura Bisi
mit einem ebenfalls unzutreffen-
den Datum (1631 statt 1634).
Das doppelte Zitat erklärt sich
durch eine Ungenauigkeit
Xaglers, der den Künstler-
namen der Unterschrift (F.
Bonaua Bisius = Frater
Bonaventura Bisi) falsch
auflöste und so den legen-
dären Francesco Bonaveri
verschuldet hat.
Daß die heilige Familie
von Bisi wirklich, wie
Bartsch und Nagler an-
nehmen, auf Vasari zurück-
geht, bestätigt der Vergleich
mit den erwähnten Darstel-
lungen durchaus. Als be-
sonders charakteristisch für
den Aretiner ergibt sich
wieder der knitterige Ge-
wandwarf, das Profil Josefs
(vgl. den knienden Mann
rechts auf Vicos Pietä), die
geradlinig verlaufende, aber
kurz vor der Nasenwurzel
gebrochene Brauenlinie
Marias, die unglücklich ver-
drehten Stellungen; dazu
kommt die Haartracht der
Madonna mit dem säuber-
lich markierten Scheitel,
ihre rechte Hand (vgl. das
Greifen bei dem knienden
Mann links auf der Vico-
schen Pietä) u. a. m.
Zeit-
von Toledo im Palazzo vecchio
gemalten Altarbildes,'vor allem
in der Anordnung der Haupt-
gruppe, deren Unselbständig-
keit lediglieh infolge des Gegen-
sinnes nicht so deutlieh merk-
bar wird. Es ist möglich, daß
diese Abhängigkeit Vasari sel-
ber nicht zum Bewußtsein ge-
kommen ist oder daß er im
Gegenteil bestrebt war, das viel
bestaunte Altarbild des großen
Porträtistendurch seine reiche-
re Behandlung in den Schatten
zu stellen; da er sich damals
in Florenz aufhielt, so kannte
er es jedenfalls und hat das
gerade erst geschaffene Werk
sicher in der Kapelle der
Eleonora sorgfältig studiert.
Die Pieta von Yico ist
ohne Zweifel unter allen
Blättern nach Vasari (die
wenigen meist späteren, von
Diana Ghisi, Cornelis Cort,
Cherubino Alberti, Jan de
Bisschop u. a., hinzuge-
rechnet) als Stich die be-
deutendste Leistung. Wir
könnten mit ihr das Grenz-
gebiet zwischen Salviati
und Vasari, was die Graphik
des XVI. Jahrhunderts be-
langt, schon verlassen,
möchten aber die Gelegen-
heit benutzen, um an einem
bestimmten Gegenstand —
der Darstellung der hei-
ligen Familie — die
Grenzlinie zwischen beiden
Meistern noch deutlicher zu
machen und einige Irrtümer
dabei klarzustellen. Die
wichtigsten Formulierungen
des von Vasari viel behan-
delten Gegenstandes
Bilder in Florenz (Palazzo
Pitti, Galerie Corsini), Mün-
chen, Wien, Grenoble —
habe ich an der zitierten
Stelle aufgezählt und eine
Abb. 7. Giorgio Vasari, Pieta. Gemälde in der Akademie vonRavenna
1 Heute in Besancon; die
etwas spatere eigenhändige Kupie
Bronzinos jetzt in Florenz an der
Stelle des Originals.
, l'leta.
Kupferstich
bislang für Salviati gehaltene
Darstellung in Dresden hinzu-
gefügt, die das Thema des
Wiener Bildes in erweiterter
Fassung zeigt. Auf dem Gebiete
der Graphik wäre hieran an-
zuschließen eine Radierung
des Jan de Bisschop und ein
unzweifelhaft auf Vasari zu-
rückzuführendes Blatt, das
mehrfach — zuletzt in Thieme-
Beckers Künstlerlexikon —
Verwirrung angerichtet hat
(Abb. 9); es findet sich dort
nämlich sowohl (nach Nagler,
K.-L.XIX,464) unter Francesco
Bonaveri erwähnt und mit der
(unrichtigen) Angabe »bezeich-
net Franc. Bonaveri fec. 1634-«
w ie unter Fra Bonaventura Bisi
mit einem ebenfalls unzutreffen-
den Datum (1631 statt 1634).
Das doppelte Zitat erklärt sich
durch eine Ungenauigkeit
Xaglers, der den Künstler-
namen der Unterschrift (F.
Bonaua Bisius = Frater
Bonaventura Bisi) falsch
auflöste und so den legen-
dären Francesco Bonaveri
verschuldet hat.
Daß die heilige Familie
von Bisi wirklich, wie
Bartsch und Nagler an-
nehmen, auf Vasari zurück-
geht, bestätigt der Vergleich
mit den erwähnten Darstel-
lungen durchaus. Als be-
sonders charakteristisch für
den Aretiner ergibt sich
wieder der knitterige Ge-
wandwarf, das Profil Josefs
(vgl. den knienden Mann
rechts auf Vicos Pietä), die
geradlinig verlaufende, aber
kurz vor der Nasenwurzel
gebrochene Brauenlinie
Marias, die unglücklich ver-
drehten Stellungen; dazu
kommt die Haartracht der
Madonna mit dem säuber-
lich markierten Scheitel,
ihre rechte Hand (vgl. das
Greifen bei dem knienden
Mann links auf der Vico-
schen Pietä) u. a. m.
Zeit-