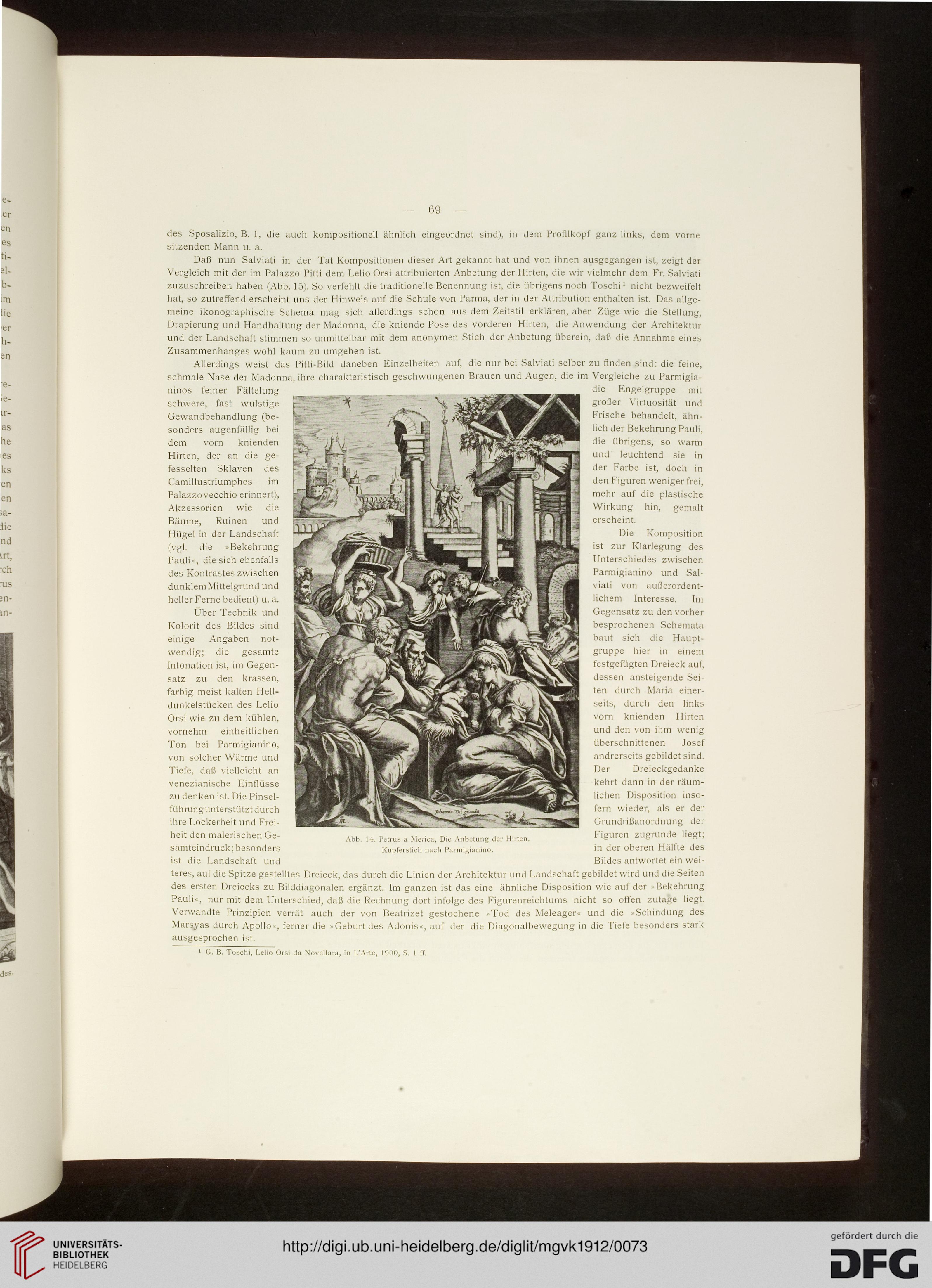— 69
des Sposalizio, B. 1, die auch kompositionell ähnlich eingeordnet sind), in dem Profilkopf ganz links, dem vorne
sitzenden Mann u. a.
Daß nun Salviati in der Tat Kompositionen dieser Art gekannt hat und von ihnen ausgegangen ist, zeigt der
Vergleich mit der im Palazzo Pitti dem Lelio Orsi attribuierten Anbetung der Hirten, die wir vielmehr dem Fr. Salviati
zuzuschreiben haben (Abb. 15). So verfehlt die traditionelle Benennung ist, die übrigens noch Toschi1 nicht bezweifelt
hat, so zutreffend erscheint uns der Hinweis auf die Schule von Parma, der in der Attribution enthalten ist. Das allge-
meine ikonographische Schema mag sich allerdings schon aus dem Zeitstil erklären, aber Züge wie die Stellung,
Diapierung und Handhaltung der Madonna, die kniende Pose des vorderen Hirten, die Anwendung der Architektur
und der Landschaft stimmen so unmittelbar mit dem anonymen Stich der Anbetung überein, daß die Annahme eines
Zusammenhanges wohl kaum zu umgehen ist.
Allerdings weist das Pitti-Bild daneben Einzelheiten auf, die nur bei Salviati selber zu finden sind: die feine,
schmale Nase der Madonna, ihre charakteristisch geschwungenen Brauen und Augen, die im Vergleiche zu Parmigia-
ninos feiner Fältelung
schwere, fast wulstige
Gewandbehandlung (be-
sonders augenfällig bei
dem vorn knienden
Hirten, der an die ge-
fesselten Sklaven des
Camillustriumphes im
Palazzo vecchio erinnert),
Akzessorien wie die
Bäume, Ruinen und
Hügel in der Landschaft
(vgl. die »Bekehrung
Pauli«, die sich ebenfalls
des Kontrastes zwischen
dunklem Mittelgrund und
heller Ferne bedient) u. a.
Über Technik und
Kolorit des Bildes sind
einige Angaben not-
wendig; die gesamte
Intonation ist, im Gegen-
satz zu den krassen,
farbig meist kalten Hell-
dunkelstücken des Lelio
Orsi wie zu dem kühlen,
vornehm einheitlichen
Ton bei Parmigianino,
von solcher Wärme und
Tiefe, daß vielleicht an
venezianische Einflüsse
zu denken ist. Die Pinsel-
führungunterstützt durch
ihre Lockerheit und Frei-
heit den malerischen Ge-
samteindruck; besonders
Petras a Me.ica, Die Anbetung der Hntcn.
Kupferstich nach Parmigianino.
die Engelgruppe mit
großer Virtuosität und
Frische behandelt, ähn-
lich der Bekehrung Pauli,
die übrigens, so warm
und leuchtend sie in
der Farbe ist, doch in
den Figuren weniger frei,
mehr auf die plastische
Wirkung hin, gemalt
erscheint.
Die Komposition
ist zur Klarlegung des
Unterschiedes zwischen
Parmigianino und Sal-
viati von außerordent-
lichem Interesse. Im
Gegensatz zu den vorher
besprochenen Schemata
baut sich die Haupt-
gruppe hier in einem
festgefügten Dreieck auf,
dessen ansteigende Sei-
ten durch Maria einer-
seits, durch den links
vorn knienden Hirten
und den von ihm wenig
überschnittenen Josef
andrerseits gebildet sind.
Der Dreieckgedanke
kehrt dann in der räum-
lichen Disposition inso-
fern wieder, als er der
Grundiißanordnung der
Figuren zugrunde liegt;
in der oberen Hälfte des
Bildes antwortet ein wei-
lst die Landschaft und
teres, auf die Spitze gestelltes Dreieck, das durch die Linien der Architektur und Landschaft gebildet wird und die Seiten
des ersten Dreiecks zu Bilddiagonalen ergänzt. Im ganzen ist das eine ähnliche Disposition wie auf der »Bekehrung
Pauli«, nur mit dem Unterschied, daß die Rechnung dort infolge des Figurenreichtums nicht so offen zutage liegt.
Verwandte Prinzipien verrät auch der von Beatrizet gestochene »Tod des Meleager« und die »Schindung des
Marsyas durch Apollo-, ferner die »Geburt des Adonis«, auf der die Diagonalbewegung in die Tiefe besonders stark
ausgesprochen ist.
• G. B. Toschi, Lelio Orsi Ja Novellara, in L'Arte, 1900, S. 1 ff.
des Sposalizio, B. 1, die auch kompositionell ähnlich eingeordnet sind), in dem Profilkopf ganz links, dem vorne
sitzenden Mann u. a.
Daß nun Salviati in der Tat Kompositionen dieser Art gekannt hat und von ihnen ausgegangen ist, zeigt der
Vergleich mit der im Palazzo Pitti dem Lelio Orsi attribuierten Anbetung der Hirten, die wir vielmehr dem Fr. Salviati
zuzuschreiben haben (Abb. 15). So verfehlt die traditionelle Benennung ist, die übrigens noch Toschi1 nicht bezweifelt
hat, so zutreffend erscheint uns der Hinweis auf die Schule von Parma, der in der Attribution enthalten ist. Das allge-
meine ikonographische Schema mag sich allerdings schon aus dem Zeitstil erklären, aber Züge wie die Stellung,
Diapierung und Handhaltung der Madonna, die kniende Pose des vorderen Hirten, die Anwendung der Architektur
und der Landschaft stimmen so unmittelbar mit dem anonymen Stich der Anbetung überein, daß die Annahme eines
Zusammenhanges wohl kaum zu umgehen ist.
Allerdings weist das Pitti-Bild daneben Einzelheiten auf, die nur bei Salviati selber zu finden sind: die feine,
schmale Nase der Madonna, ihre charakteristisch geschwungenen Brauen und Augen, die im Vergleiche zu Parmigia-
ninos feiner Fältelung
schwere, fast wulstige
Gewandbehandlung (be-
sonders augenfällig bei
dem vorn knienden
Hirten, der an die ge-
fesselten Sklaven des
Camillustriumphes im
Palazzo vecchio erinnert),
Akzessorien wie die
Bäume, Ruinen und
Hügel in der Landschaft
(vgl. die »Bekehrung
Pauli«, die sich ebenfalls
des Kontrastes zwischen
dunklem Mittelgrund und
heller Ferne bedient) u. a.
Über Technik und
Kolorit des Bildes sind
einige Angaben not-
wendig; die gesamte
Intonation ist, im Gegen-
satz zu den krassen,
farbig meist kalten Hell-
dunkelstücken des Lelio
Orsi wie zu dem kühlen,
vornehm einheitlichen
Ton bei Parmigianino,
von solcher Wärme und
Tiefe, daß vielleicht an
venezianische Einflüsse
zu denken ist. Die Pinsel-
führungunterstützt durch
ihre Lockerheit und Frei-
heit den malerischen Ge-
samteindruck; besonders
Petras a Me.ica, Die Anbetung der Hntcn.
Kupferstich nach Parmigianino.
die Engelgruppe mit
großer Virtuosität und
Frische behandelt, ähn-
lich der Bekehrung Pauli,
die übrigens, so warm
und leuchtend sie in
der Farbe ist, doch in
den Figuren weniger frei,
mehr auf die plastische
Wirkung hin, gemalt
erscheint.
Die Komposition
ist zur Klarlegung des
Unterschiedes zwischen
Parmigianino und Sal-
viati von außerordent-
lichem Interesse. Im
Gegensatz zu den vorher
besprochenen Schemata
baut sich die Haupt-
gruppe hier in einem
festgefügten Dreieck auf,
dessen ansteigende Sei-
ten durch Maria einer-
seits, durch den links
vorn knienden Hirten
und den von ihm wenig
überschnittenen Josef
andrerseits gebildet sind.
Der Dreieckgedanke
kehrt dann in der räum-
lichen Disposition inso-
fern wieder, als er der
Grundiißanordnung der
Figuren zugrunde liegt;
in der oberen Hälfte des
Bildes antwortet ein wei-
lst die Landschaft und
teres, auf die Spitze gestelltes Dreieck, das durch die Linien der Architektur und Landschaft gebildet wird und die Seiten
des ersten Dreiecks zu Bilddiagonalen ergänzt. Im ganzen ist das eine ähnliche Disposition wie auf der »Bekehrung
Pauli«, nur mit dem Unterschied, daß die Rechnung dort infolge des Figurenreichtums nicht so offen zutage liegt.
Verwandte Prinzipien verrät auch der von Beatrizet gestochene »Tod des Meleager« und die »Schindung des
Marsyas durch Apollo-, ferner die »Geburt des Adonis«, auf der die Diagonalbewegung in die Tiefe besonders stark
ausgesprochen ist.
• G. B. Toschi, Lelio Orsi Ja Novellara, in L'Arte, 1900, S. 1 ff.