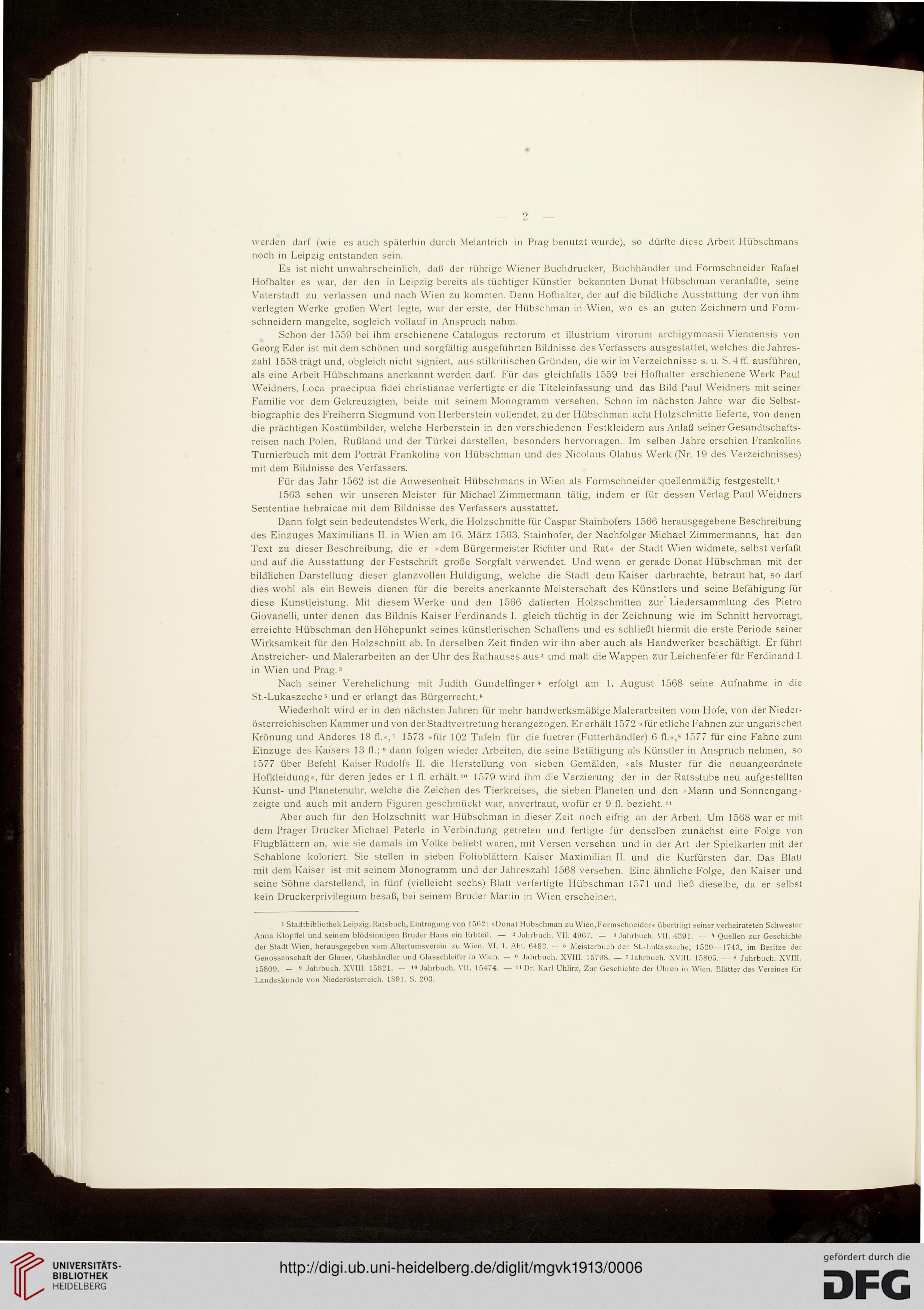2
werden darf (wie es auch späterhin durch Melantrich in Prag benutzt wurde), so dürfte diese Arbeit Hübschmans
noch in Leipzig entstanden sein.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der rührige Wiener Buchdrucker, Buchhändler und Formschneider Rafael
Hofhalter es war, der den in Leipzig bereits als tüchtiger Künstler bekannten Donat Hübschman veranlaßte, seine
Vaterstadt zu verlassen und nach Wien zu kommen. Denn Hofhalter, der auf die bildliche Ausstattung der von ihm
verlegten Werke großen Wert legte, war der erste, der Hübschman in Wien, wo es an guten Zeichnern und Form-
schneidern mangelte, sogleich vollauf in Anspruch nahm
Schon der 1559 bei ihm erschienene Catalogus rectorum et illustrium virorum archigymnasii Viennensis von
Georg Eder ist mit dem schönen und sorgfältig ausgeführten Bildnisse des Verfassers ausgestattet, welches die Jahres-
zahl 1558 trägt und, obgleich nicht signiert, aus stilkritischen Gründen, die wir im Verzeichnisse s. u. S. 4 ff. ausführen,
als eine Arbeit Hübschmans anerkannt werden darf. Für das gleichfalls 1559 bei Hofhalter erschienene Werk Paul
Weidners, Loca praeeipua fidei christianae verfertigte er die Titeleinfassung und das Bild Paul Weidners mit seiner
Familie vor dem Gekreuzigten, beide mit seinem Monogramm versehen. Schon im nächsten Jahre war die Selbst-
biographie des Freiherrn Siegmund von Herberstein vollendet, zu der Hübschman acht Holzschnitte lieferte, von denen
die prächtigen Kostümbilder, welche Herberstein in den verschiedenen Festkleidern aus Anlaß seiner Gesandtschafts-
reisen nach Polen, Rußland und der Türkei darstellen, besonders hervorragen. Im selben Jahre erschien Frankolins
Turnierbuch mit dem Porträt Frankolins von Hübschman und des Nicolaus Olahus Werk (Nr. 19 des Verzeichnisses)
mit dem Bildnisse des Verfassers.
Für das Jahr 1562 ist die Anwesenheit Hübschmans in Wien als Formschneider quellenmäßig festgestellt.1
1563 sehen wir unseren Meister für Michael Zimmermann tätig, indem er für dessen Verlag Paul Weidners
Sententiae hebraicae mit dem Bildnisse des Verfassers ausstattet.
Dann folgt sein bedeutendstes Werk, die Holzschnitte für Caspar Stainhofers 1566 herausgegebene Beschreibung
des Einzuges Maximilians II. in Wien am 16. März 1563. Stainhofer, der Nachfolger Michael Zimmermanns, hat den
Text zu dieser Beschreibung, die er »dem Bürgermeister Richter und Rat« der Stadt Wien widmete, selbst verfaßt
und auf die Ausstattung der Festschrift große Sorgfalt verwendet. Und wenn er gerade Donat Hübschman mit der
bildlichen Darstellung dieser glanzvollen Huldigung, welche die Stadt dem Kaiser darbrachte, betraut hat, so darf
dies wohl als ein Beweis dienen für die bereits anerkannte Meisterschaft des Künstlers und seine Befähigung für
diese Kunstleistung. Mit diesem Werke und den 1566 datierten Holzschnitten zur Liedersammlung des Pietro
Giovanelli, unter denen das Bildnis Kaiser Ferdinands I. gleich tüchtig in der Zeichnung wie im Schnitt hervorragt,
erreichte Hübschman den Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens und es schließt hiermit die erste Periode seiner
Wirksamkeit für den Holzschnitt ab. In derselben Zeit finden wir ihn aber auch als Handwerker beschäftigt. Er führt
Anstreicher- und Malerarbeiten an der Uhr des Rathauses aus3 und malt die Wappen zur Leichenfeier für Ferdinand I.
in Wien und Prag.1
Nach seiner Verehelichung mit Judith Gundelfinger4 erfolgt am 1. August 1568 seine Aufnahme in die
St.-Lukaszeches und er erlangt das Bürgerrecht.«
Wiederholt wird er in den nächsten Jahren für mehr handwerksmäßige Malerarbeiten vom Hofe, von der Nieder-
österreichischen Kammer und von der Stadtvertretung herangezogen. Er erhält 1572 »für etliche Fahnen zur ungarischen
Krönung und Anderes 18 fl.«,' 1573 »für 102 Tafeln für die fuetrer (Futterhändler) 6 fl.«,a 1577 für eine Fahne zum
Einzüge des Kaisers 13 fl.;» dann folgen wieder Arbeiten, die seine Betätigung als Künstler in Anspruch nehmen, so
1577 über Befehl Kaiser Rudolfs II. die Herstellung von sieben Gemälden, »als Muster für die neuangeordnete
Hofkleidung«, für deren jedes er 1 fl. erhält.'" 1579 wird ihm die Verzierung der in der Ratsstube neu aufgestellten
Kunst- und Planetenuhr, welche die Zeichen des Tierkreises, die sieben Planeten und den »Mann und Sonnengang
zeigte und auch mit andern Figuren geschmückt war, anvertraut, wofür er 9 fl. bezieht. "
Aber auch für den Holzschnitt war Hübschman in dieser Zeit noch eifrig an der Arbeit. Um 1568 war er mit
dem Prager Drucker Michael Peterle in Verbindung getreten und fertigte für denselben zunächst eine Folge von
Flugblättern an, wie sie damals im Volke beliebt waren, mit Versen versehen und in der Art der Spielkarten mit der
Schablone koloriert. Sie stellen in sieben Folioblättern Kaiser Maximilian II. und die Kurfürsten dar. Das Blatt
mit dem Kaiser ist mit seinem Monogramm und der Jahreszahl 1568 versehen. Eine ähnliche Folge, den Kaiser und
seine Söhne darstellend, in fünf (vielleicht sechs) Blatt verfertigte Hübschman 1571 und ließ dieselbe, da er selbst
kein Druckerprivilegium besaß, bei seinem Bruder Martin in Wien erscheinen.
' Stadtbibliothek Leipzig. Ratsbuch, Eintragung von 1502: »Donat Hübschman zu Wien, Formschneider« übertragt seiner verheirateten Schwester
Anna Klopffel und seinem blödsinnigen Bruder Hans ein Erbteil. — - Jahrbuch. VII. 4967. — '■'• Jahrbuch. VII. 4391. — * Quellen zur Geschichte
der Stadt Wien, herausgegeben vom Altertumsveiein zu Wien. VI. 1. Abt. 6482. — s Meisterbuch der St.-Lukaszeche, 1529—1743, im Besitze der
Genossenschaft der Glaser. Glashändler und Glasschieiter in Wien. — " Jahrbuch. XVIII. 15798. — 'Jahrbuch. XVIII. 15805. — ö Jahrbuch. XVIII.
15809. — » Jahrbuch. XVIII. 15821. — « Jahrbuch. VII. 15474. — "Dr. Karl Uhlirz, Zur Geschichte der Uhren in Wien. Blätter des Vereines für
Landeskunde von Niederösterreich. 1891. S. 203.
werden darf (wie es auch späterhin durch Melantrich in Prag benutzt wurde), so dürfte diese Arbeit Hübschmans
noch in Leipzig entstanden sein.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der rührige Wiener Buchdrucker, Buchhändler und Formschneider Rafael
Hofhalter es war, der den in Leipzig bereits als tüchtiger Künstler bekannten Donat Hübschman veranlaßte, seine
Vaterstadt zu verlassen und nach Wien zu kommen. Denn Hofhalter, der auf die bildliche Ausstattung der von ihm
verlegten Werke großen Wert legte, war der erste, der Hübschman in Wien, wo es an guten Zeichnern und Form-
schneidern mangelte, sogleich vollauf in Anspruch nahm
Schon der 1559 bei ihm erschienene Catalogus rectorum et illustrium virorum archigymnasii Viennensis von
Georg Eder ist mit dem schönen und sorgfältig ausgeführten Bildnisse des Verfassers ausgestattet, welches die Jahres-
zahl 1558 trägt und, obgleich nicht signiert, aus stilkritischen Gründen, die wir im Verzeichnisse s. u. S. 4 ff. ausführen,
als eine Arbeit Hübschmans anerkannt werden darf. Für das gleichfalls 1559 bei Hofhalter erschienene Werk Paul
Weidners, Loca praeeipua fidei christianae verfertigte er die Titeleinfassung und das Bild Paul Weidners mit seiner
Familie vor dem Gekreuzigten, beide mit seinem Monogramm versehen. Schon im nächsten Jahre war die Selbst-
biographie des Freiherrn Siegmund von Herberstein vollendet, zu der Hübschman acht Holzschnitte lieferte, von denen
die prächtigen Kostümbilder, welche Herberstein in den verschiedenen Festkleidern aus Anlaß seiner Gesandtschafts-
reisen nach Polen, Rußland und der Türkei darstellen, besonders hervorragen. Im selben Jahre erschien Frankolins
Turnierbuch mit dem Porträt Frankolins von Hübschman und des Nicolaus Olahus Werk (Nr. 19 des Verzeichnisses)
mit dem Bildnisse des Verfassers.
Für das Jahr 1562 ist die Anwesenheit Hübschmans in Wien als Formschneider quellenmäßig festgestellt.1
1563 sehen wir unseren Meister für Michael Zimmermann tätig, indem er für dessen Verlag Paul Weidners
Sententiae hebraicae mit dem Bildnisse des Verfassers ausstattet.
Dann folgt sein bedeutendstes Werk, die Holzschnitte für Caspar Stainhofers 1566 herausgegebene Beschreibung
des Einzuges Maximilians II. in Wien am 16. März 1563. Stainhofer, der Nachfolger Michael Zimmermanns, hat den
Text zu dieser Beschreibung, die er »dem Bürgermeister Richter und Rat« der Stadt Wien widmete, selbst verfaßt
und auf die Ausstattung der Festschrift große Sorgfalt verwendet. Und wenn er gerade Donat Hübschman mit der
bildlichen Darstellung dieser glanzvollen Huldigung, welche die Stadt dem Kaiser darbrachte, betraut hat, so darf
dies wohl als ein Beweis dienen für die bereits anerkannte Meisterschaft des Künstlers und seine Befähigung für
diese Kunstleistung. Mit diesem Werke und den 1566 datierten Holzschnitten zur Liedersammlung des Pietro
Giovanelli, unter denen das Bildnis Kaiser Ferdinands I. gleich tüchtig in der Zeichnung wie im Schnitt hervorragt,
erreichte Hübschman den Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens und es schließt hiermit die erste Periode seiner
Wirksamkeit für den Holzschnitt ab. In derselben Zeit finden wir ihn aber auch als Handwerker beschäftigt. Er führt
Anstreicher- und Malerarbeiten an der Uhr des Rathauses aus3 und malt die Wappen zur Leichenfeier für Ferdinand I.
in Wien und Prag.1
Nach seiner Verehelichung mit Judith Gundelfinger4 erfolgt am 1. August 1568 seine Aufnahme in die
St.-Lukaszeches und er erlangt das Bürgerrecht.«
Wiederholt wird er in den nächsten Jahren für mehr handwerksmäßige Malerarbeiten vom Hofe, von der Nieder-
österreichischen Kammer und von der Stadtvertretung herangezogen. Er erhält 1572 »für etliche Fahnen zur ungarischen
Krönung und Anderes 18 fl.«,' 1573 »für 102 Tafeln für die fuetrer (Futterhändler) 6 fl.«,a 1577 für eine Fahne zum
Einzüge des Kaisers 13 fl.;» dann folgen wieder Arbeiten, die seine Betätigung als Künstler in Anspruch nehmen, so
1577 über Befehl Kaiser Rudolfs II. die Herstellung von sieben Gemälden, »als Muster für die neuangeordnete
Hofkleidung«, für deren jedes er 1 fl. erhält.'" 1579 wird ihm die Verzierung der in der Ratsstube neu aufgestellten
Kunst- und Planetenuhr, welche die Zeichen des Tierkreises, die sieben Planeten und den »Mann und Sonnengang
zeigte und auch mit andern Figuren geschmückt war, anvertraut, wofür er 9 fl. bezieht. "
Aber auch für den Holzschnitt war Hübschman in dieser Zeit noch eifrig an der Arbeit. Um 1568 war er mit
dem Prager Drucker Michael Peterle in Verbindung getreten und fertigte für denselben zunächst eine Folge von
Flugblättern an, wie sie damals im Volke beliebt waren, mit Versen versehen und in der Art der Spielkarten mit der
Schablone koloriert. Sie stellen in sieben Folioblättern Kaiser Maximilian II. und die Kurfürsten dar. Das Blatt
mit dem Kaiser ist mit seinem Monogramm und der Jahreszahl 1568 versehen. Eine ähnliche Folge, den Kaiser und
seine Söhne darstellend, in fünf (vielleicht sechs) Blatt verfertigte Hübschman 1571 und ließ dieselbe, da er selbst
kein Druckerprivilegium besaß, bei seinem Bruder Martin in Wien erscheinen.
' Stadtbibliothek Leipzig. Ratsbuch, Eintragung von 1502: »Donat Hübschman zu Wien, Formschneider« übertragt seiner verheirateten Schwester
Anna Klopffel und seinem blödsinnigen Bruder Hans ein Erbteil. — - Jahrbuch. VII. 4967. — '■'• Jahrbuch. VII. 4391. — * Quellen zur Geschichte
der Stadt Wien, herausgegeben vom Altertumsveiein zu Wien. VI. 1. Abt. 6482. — s Meisterbuch der St.-Lukaszeche, 1529—1743, im Besitze der
Genossenschaft der Glaser. Glashändler und Glasschieiter in Wien. — " Jahrbuch. XVIII. 15798. — 'Jahrbuch. XVIII. 15805. — ö Jahrbuch. XVIII.
15809. — » Jahrbuch. XVIII. 15821. — « Jahrbuch. VII. 15474. — "Dr. Karl Uhlirz, Zur Geschichte der Uhren in Wien. Blätter des Vereines für
Landeskunde von Niederösterreich. 1891. S. 203.