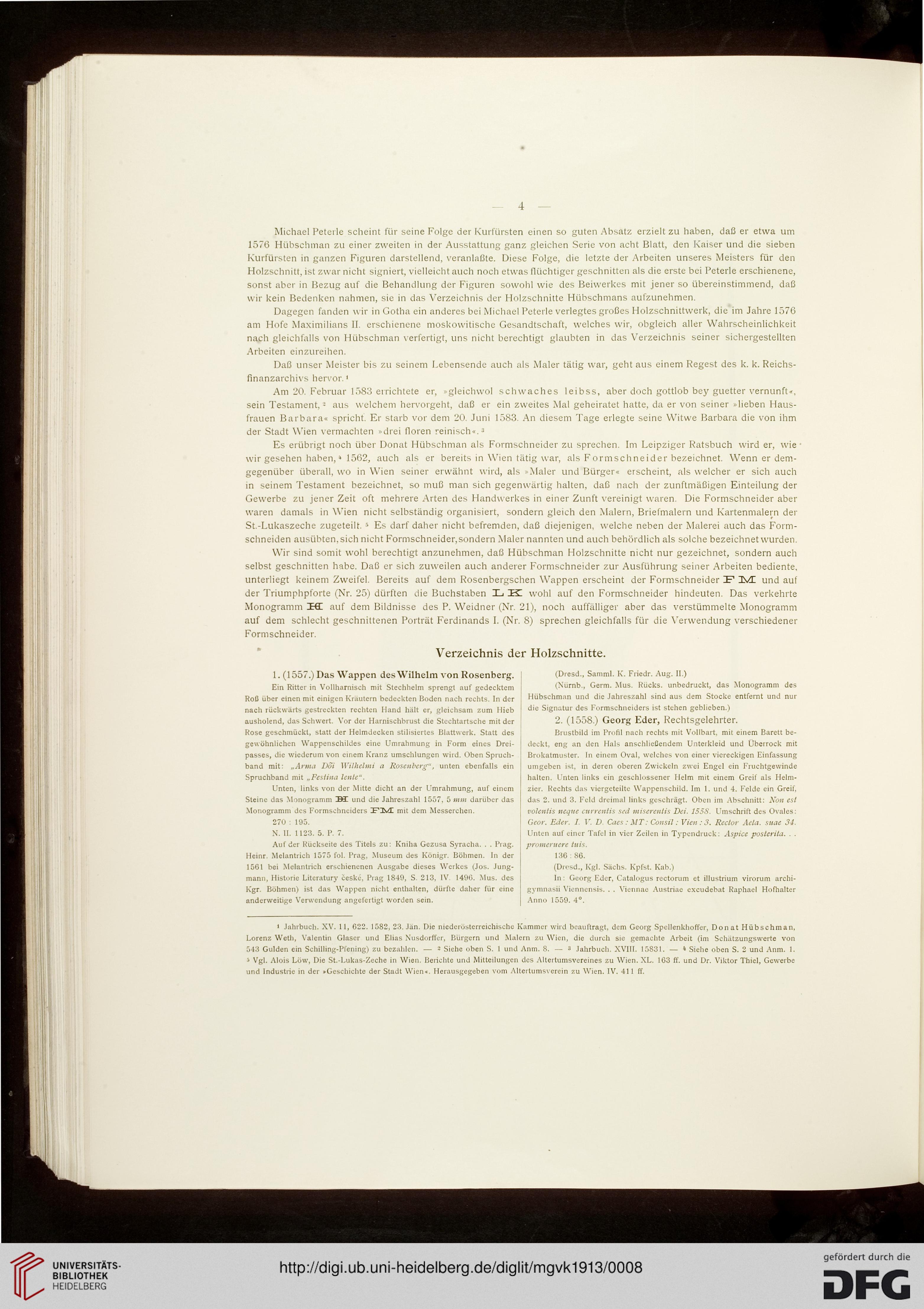Michael Peterle scheint für seine Folge der Kurfürsten einen so guten Absatz erzielt zu haben, daß er etwa um
1576 Hübschman zu einer zweiten in der Ausstattung ganz gleichen Serie von acht Blatt, den Kaiser und die sieben
Kurfürsten in ganzen Figuren darstellend, veranlaßte. Diese Folge, die letzte der Arbeiten unseres Meisters für den
Holzschnitt, ist zwar nicht signiert, vielleicht auch noch etwas flüchtiger geschnitten als die erste bei Peterle erschienene,
sonst aber in Bezug auf die Behandlung der Figuren sowohl wie des Beiwerkes mit jener so übereinstimmend, daß
wir kein Bedenken nahmen, sie in das Verzeichnis der Holzschnitte Hübschmans aufzunehmen.
Dagegen fanden wir in Gotha ein anderes bei Michael Peterle verlegtes großes Holzschnittwerk, die im Jahre 1576
am Hofe Maximilians II. erschienene moskowitische Gesandtschaft, welches wir, obgleich aller Wahrscheinlichkeit
nach gleichfalls von Hübschman verfertigt, uns nicht berechtigt glaubten in das Verzeichnis seiner sichergestellten
Arbeiten einzureihen.
Daß unser Meister bis zu seinem Lebensende auch als Maler tätig war, geht aus einem Regest des k. k. Reichs-
finanzarchivs hervor.1
Am 20. Februar 1583 errichtete er, »gleichwol schwaches leibss, aber doch gottlob bey guetter Vernunft«,
sein Testament,2 aus welchem hervorgeht, daß er ein zweites Mal geheiratet hatte, da er von seiner »lieben Haus-
frauen Barbara« spricht. Er starb vor dem 20. Juni 1583. An diesem Tage erlegte seine Witwe Barbara die von ihm
der Stadt Wien vermachten »drei floren reinisch«.3
Es erübrigt noch über Donat Hübschman als Formschneider zu sprechen. Im Leipziger Ratsbuch wird er, wie
wir gesehen haben, * 1562, auch als er bereits in Wien tätig war, als Formschneider bezeichnet. Wenn er dem-
gegenüber überall, wo in Wien seiner erwähnt wird, als »Maler und Bürger« erscheint, als welcher er sich auch
in seinem Testament bezeichnet, so muß man sich gegenwärtig halten, daß nach der zunftmäßigen Einteilung der
Gewerbe zu jener Zeit oft mehrere Arten des Handwerkes in einer Zunft vereinigt waren. Die Formschneider aber
waren damals in Wien nicht selbständig organisiert, sondern gleich den Malern, Briefmalern und Kartenmalern der
St.-Lukaszeche zugeteilt. ■'• Es darf daher nicht befremden, daß diejenigen, welche neben der Malerei auch das Form-
schneiden ausübten, sich nicht Formschneider,sondern Maler nannten und auch behördlich als solche bezeichnet wurden.
Wir sind somit wohl berechtigt anzunehmen, daß Hübschman Holzschnitte nicht nur gezeichnet, sondern auch
selbst geschnitten habe. Daß er sich zuweilen auch anderer Formschneider zur Ausführung seiner Arbeiten bediente,
unterliegt keinem Zweifel. Bereits auf dem Rosenbergschen Wappen erscheint der Formschneider !P ÜVL" und auf
der Triumphpforte (Nr. 25) dürften die Buchstaben L ZK wohl auf den Formschneider hindeuten. Das verkehrte
Monogramm ZKE auf dem Bildnisse des P. Weidner (Nr. 21), noch auffälliger aber das verstümmelte Monogramm
auf dem schlecht geschnittenen Porträt Ferdinands I. (Nr. 8) sprechen gleichfalls für die Verwendung verschiedener
Formschneider.
Verzeichnis der Holzschnitte.
1. (1557.) Das Wappen des Wilhelm von Rosenberg.
Ein Ritter in Volihamisch mit Stechhelm sprengt auf gedecktem
Roß über einen mit einigen Krautern bedeckten Boden nach rechts. In der
nach rückwärts gestreckten rechten Hand hält er, gleichsam zum Hieb
ausholend, das Schwert. Vor der Harnischbrust die Stcchtartsche mit der
Rose geschmückt, statt der Helmdecken stilisiertes Blattwerk. Statt des
gewöhnlichen Wappenschildes eine Umrahmung in Form eines Drei-
passes, die wiederum von einem Kranz umschlungen wird. Oben Spruch-
band mit: „Artna Doi Wilhelmi a Rosenberg", unten ebenfalls ein
Spruchband mit „Festina laue".
Unten, links von der Mitte dicht an der Umrahmung, auf einem
Steine das Monogramm "SSI und die Jahreszahl 1557, 5 mm darüber das
Monogramm des Formschneiders Fl^/L mit dem Messerchen.
270 : 195.
N. IL 1123. 5. P. 7.
Auf der Rückseite des Titels zu: Kniha Gezusa Syracha. . . Piag.
Heinr. Melantiich 1575 fol. Frag, Museum des Königr. Böhmen. In der
1561 bei Melantrich erschienenen Ausgabe dieses Werkes (Jos. Jung-
mann, Historie Literatury ceske, Prag 1849, S. 213, IV. 149G. Mus. des
Kgr. Böhmen) ist das Wappen nicht enthalten, dürfte daher für eine
anderweitige Verwendung angefertigt worden sein.
(Dresd., Samml. K. Friedr. Aug. II.)
(NÜrnb., Germ. Mus. Rucks, unbedruckt, das Monogramm des
Hübschman und die Jahreszahl sind aus dem Stocke entfernt und nur
die Signatur des Formschneiders ist stehen geblieben.)
2. (1558.) Georg Eder, Rechtsgelehrter.
Brustbild im Profil nach rechts mit Vollbart, mit einem Barett be-
deckt, eng an den Hals anschließendem Unterkleid und Überrock mit
Brokatmuster. In einem Oval, welches von einer viereckigen Einfassung
umgeben ist, in deren oberen Zwickeln zwei Engel ein Fruchtgewinde
halten. Unten links ein geschlossener Helm mit einem Greif als Helm-
zier. Rechts das viergeteilte Wappenschild. Im 1. und 4. Felde ein Greif,
das 2. und 3. Feld dreimal links geschrägt. Oben im Abschnitt: Non est
volcntis neque ciirrentis sed miserentis Dei. 155S, Umschrift des Ovales:
Geor. Eder. I. I*. D Caes : A1T: Consil :Vien ; 3. Reclor Acta, sitae 34.
Unten auf einer Tafel in vier Zeilen in Typendruck: Aspice posterita. . .
promeniert tuis.
136 : 86.
(Drcsd., Kgl. Sachs. Kpfst. Kab.)
In: Georg Eder, Catalogus rectorum et illustrium virorum archi-
gymnasii Viennensis. . . Viennae Austriae exeudebat Raphael Hofhalter
Anno 1559. 4°.
i Jahrbuch. XV. 11, 622. 1582, 23. Jan. Die niederdsterreichische Kammer wird beauftragt, dem Georg Spcllenkhoffer, Donat Hübschman,
Lorenz Weth, Valentin Glaser und Elias Nusdorffer, Bürgern und Malern zu Wien, die durch sie gemachte Arbeit (im Schätzungswerte von
543 Gulden ein Schilling-Pfening) zu bezahlen. — ~ Siehe oben S. 1 und Anm. 8. — 3 Jahrbuch. XVIII. 15831. — * Siehe oben S. 2 und Anm. 1.
-"' Vgl. Alois Low, Die St.-Lukas-Zeche in Wien. Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereines zu Wien. XL. 163 ff. und Dr. Viktor Thiel, Gewerbe
und Industrie in der »Geschichte der Stadt Wiens. Herausgegeben vom Altertumsverein zu Wien. IV. 411 ff.
1576 Hübschman zu einer zweiten in der Ausstattung ganz gleichen Serie von acht Blatt, den Kaiser und die sieben
Kurfürsten in ganzen Figuren darstellend, veranlaßte. Diese Folge, die letzte der Arbeiten unseres Meisters für den
Holzschnitt, ist zwar nicht signiert, vielleicht auch noch etwas flüchtiger geschnitten als die erste bei Peterle erschienene,
sonst aber in Bezug auf die Behandlung der Figuren sowohl wie des Beiwerkes mit jener so übereinstimmend, daß
wir kein Bedenken nahmen, sie in das Verzeichnis der Holzschnitte Hübschmans aufzunehmen.
Dagegen fanden wir in Gotha ein anderes bei Michael Peterle verlegtes großes Holzschnittwerk, die im Jahre 1576
am Hofe Maximilians II. erschienene moskowitische Gesandtschaft, welches wir, obgleich aller Wahrscheinlichkeit
nach gleichfalls von Hübschman verfertigt, uns nicht berechtigt glaubten in das Verzeichnis seiner sichergestellten
Arbeiten einzureihen.
Daß unser Meister bis zu seinem Lebensende auch als Maler tätig war, geht aus einem Regest des k. k. Reichs-
finanzarchivs hervor.1
Am 20. Februar 1583 errichtete er, »gleichwol schwaches leibss, aber doch gottlob bey guetter Vernunft«,
sein Testament,2 aus welchem hervorgeht, daß er ein zweites Mal geheiratet hatte, da er von seiner »lieben Haus-
frauen Barbara« spricht. Er starb vor dem 20. Juni 1583. An diesem Tage erlegte seine Witwe Barbara die von ihm
der Stadt Wien vermachten »drei floren reinisch«.3
Es erübrigt noch über Donat Hübschman als Formschneider zu sprechen. Im Leipziger Ratsbuch wird er, wie
wir gesehen haben, * 1562, auch als er bereits in Wien tätig war, als Formschneider bezeichnet. Wenn er dem-
gegenüber überall, wo in Wien seiner erwähnt wird, als »Maler und Bürger« erscheint, als welcher er sich auch
in seinem Testament bezeichnet, so muß man sich gegenwärtig halten, daß nach der zunftmäßigen Einteilung der
Gewerbe zu jener Zeit oft mehrere Arten des Handwerkes in einer Zunft vereinigt waren. Die Formschneider aber
waren damals in Wien nicht selbständig organisiert, sondern gleich den Malern, Briefmalern und Kartenmalern der
St.-Lukaszeche zugeteilt. ■'• Es darf daher nicht befremden, daß diejenigen, welche neben der Malerei auch das Form-
schneiden ausübten, sich nicht Formschneider,sondern Maler nannten und auch behördlich als solche bezeichnet wurden.
Wir sind somit wohl berechtigt anzunehmen, daß Hübschman Holzschnitte nicht nur gezeichnet, sondern auch
selbst geschnitten habe. Daß er sich zuweilen auch anderer Formschneider zur Ausführung seiner Arbeiten bediente,
unterliegt keinem Zweifel. Bereits auf dem Rosenbergschen Wappen erscheint der Formschneider !P ÜVL" und auf
der Triumphpforte (Nr. 25) dürften die Buchstaben L ZK wohl auf den Formschneider hindeuten. Das verkehrte
Monogramm ZKE auf dem Bildnisse des P. Weidner (Nr. 21), noch auffälliger aber das verstümmelte Monogramm
auf dem schlecht geschnittenen Porträt Ferdinands I. (Nr. 8) sprechen gleichfalls für die Verwendung verschiedener
Formschneider.
Verzeichnis der Holzschnitte.
1. (1557.) Das Wappen des Wilhelm von Rosenberg.
Ein Ritter in Volihamisch mit Stechhelm sprengt auf gedecktem
Roß über einen mit einigen Krautern bedeckten Boden nach rechts. In der
nach rückwärts gestreckten rechten Hand hält er, gleichsam zum Hieb
ausholend, das Schwert. Vor der Harnischbrust die Stcchtartsche mit der
Rose geschmückt, statt der Helmdecken stilisiertes Blattwerk. Statt des
gewöhnlichen Wappenschildes eine Umrahmung in Form eines Drei-
passes, die wiederum von einem Kranz umschlungen wird. Oben Spruch-
band mit: „Artna Doi Wilhelmi a Rosenberg", unten ebenfalls ein
Spruchband mit „Festina laue".
Unten, links von der Mitte dicht an der Umrahmung, auf einem
Steine das Monogramm "SSI und die Jahreszahl 1557, 5 mm darüber das
Monogramm des Formschneiders Fl^/L mit dem Messerchen.
270 : 195.
N. IL 1123. 5. P. 7.
Auf der Rückseite des Titels zu: Kniha Gezusa Syracha. . . Piag.
Heinr. Melantiich 1575 fol. Frag, Museum des Königr. Böhmen. In der
1561 bei Melantrich erschienenen Ausgabe dieses Werkes (Jos. Jung-
mann, Historie Literatury ceske, Prag 1849, S. 213, IV. 149G. Mus. des
Kgr. Böhmen) ist das Wappen nicht enthalten, dürfte daher für eine
anderweitige Verwendung angefertigt worden sein.
(Dresd., Samml. K. Friedr. Aug. II.)
(NÜrnb., Germ. Mus. Rucks, unbedruckt, das Monogramm des
Hübschman und die Jahreszahl sind aus dem Stocke entfernt und nur
die Signatur des Formschneiders ist stehen geblieben.)
2. (1558.) Georg Eder, Rechtsgelehrter.
Brustbild im Profil nach rechts mit Vollbart, mit einem Barett be-
deckt, eng an den Hals anschließendem Unterkleid und Überrock mit
Brokatmuster. In einem Oval, welches von einer viereckigen Einfassung
umgeben ist, in deren oberen Zwickeln zwei Engel ein Fruchtgewinde
halten. Unten links ein geschlossener Helm mit einem Greif als Helm-
zier. Rechts das viergeteilte Wappenschild. Im 1. und 4. Felde ein Greif,
das 2. und 3. Feld dreimal links geschrägt. Oben im Abschnitt: Non est
volcntis neque ciirrentis sed miserentis Dei. 155S, Umschrift des Ovales:
Geor. Eder. I. I*. D Caes : A1T: Consil :Vien ; 3. Reclor Acta, sitae 34.
Unten auf einer Tafel in vier Zeilen in Typendruck: Aspice posterita. . .
promeniert tuis.
136 : 86.
(Drcsd., Kgl. Sachs. Kpfst. Kab.)
In: Georg Eder, Catalogus rectorum et illustrium virorum archi-
gymnasii Viennensis. . . Viennae Austriae exeudebat Raphael Hofhalter
Anno 1559. 4°.
i Jahrbuch. XV. 11, 622. 1582, 23. Jan. Die niederdsterreichische Kammer wird beauftragt, dem Georg Spcllenkhoffer, Donat Hübschman,
Lorenz Weth, Valentin Glaser und Elias Nusdorffer, Bürgern und Malern zu Wien, die durch sie gemachte Arbeit (im Schätzungswerte von
543 Gulden ein Schilling-Pfening) zu bezahlen. — ~ Siehe oben S. 1 und Anm. 8. — 3 Jahrbuch. XVIII. 15831. — * Siehe oben S. 2 und Anm. 1.
-"' Vgl. Alois Low, Die St.-Lukas-Zeche in Wien. Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereines zu Wien. XL. 163 ff. und Dr. Viktor Thiel, Gewerbe
und Industrie in der »Geschichte der Stadt Wiens. Herausgegeben vom Altertumsverein zu Wien. IV. 411 ff.