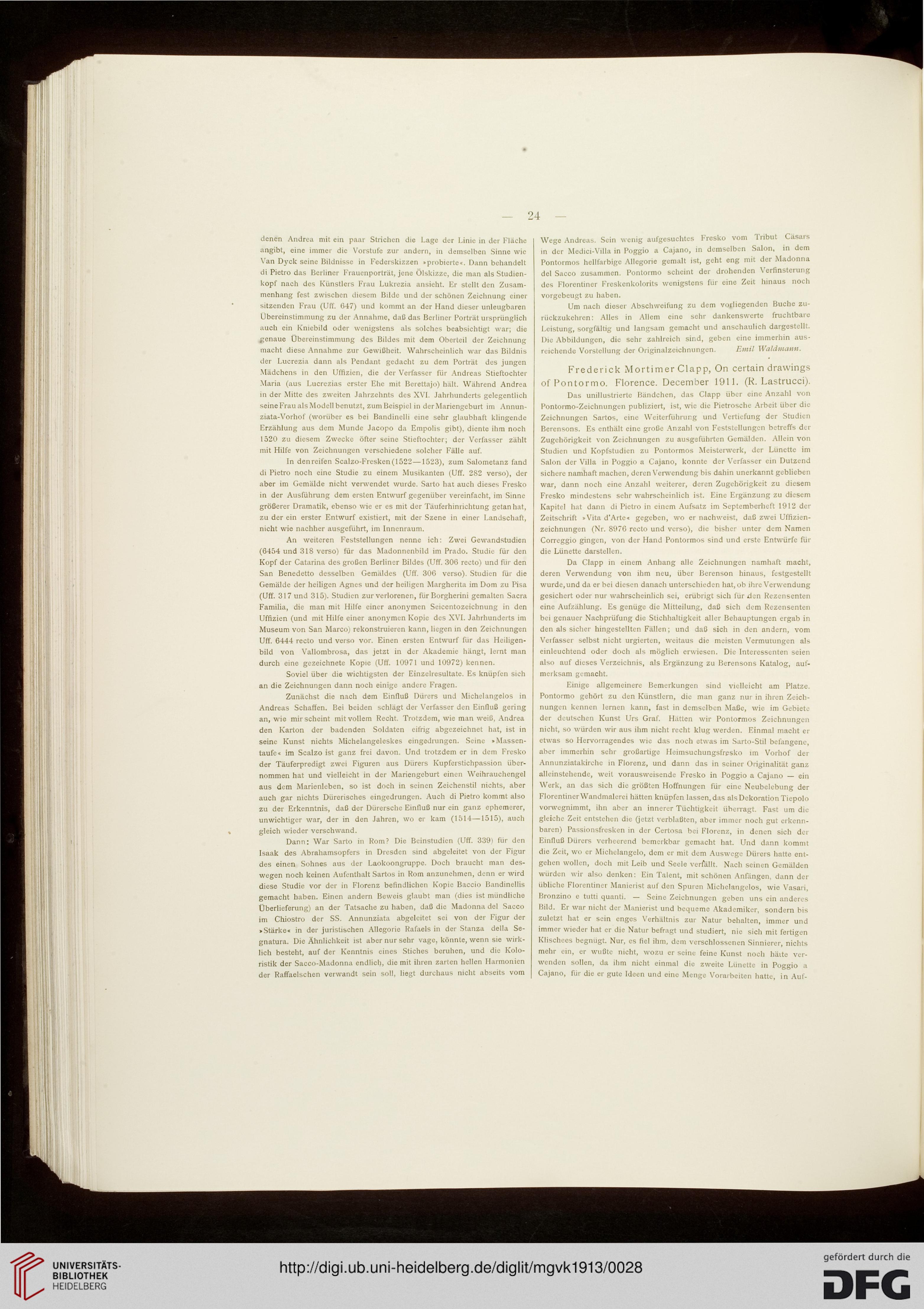24
denen Andrea mit ein paar Strichen die Lage der Linie in dei Mache
angibt, eine immer die Vorstufe zur andern, in demselben Sinne wie
Van Dyck seine Bildnisse in Federskizzen »probierte«. Dann behandelt
di Pietro das Berliner Frauenporträt, jene Ölskizzc, die man als Studien-
kopf nach des Künstlers Frau Lukrezia ansieht. Er stellt den Zusam-
menhang fest zwischen diesem Bilde und der schönen Zeichnung einer
sitzenden Frau (Uff. (347) und kommt an der Hand dieser unleugbaren
Übereinstimmung zu der Annahme, daß das Berliner Porträt ursprunglich
auch ein Kniebild oder wenigstens als solches beabsichtigt war; die
genaue Übereinstimmung des Bildes mit dem Oberteil der Zeichnung
macht diese Annahme zur Gewißheit. Wahrscheinlich war das Bildnis
der Lucrezia dann als Pendant gedacht zu dem Porträt des jungen
Mädchens in den Uffizien, die der Verfasser für Andreas Stieftochter
Maria (aus Lucrezias erster Ehe mit Berettajo) halt. Während Andrea
in der Mitte des zweiten Jahrzehnts des XVI. Jahrhunderts gelegentlich
seine Frau als Modell benutzt, zum Beispiel m der Mariengeburt im Annun-
ziata-Vorhof (worüber es bei Bnndinelli eine sehr glaubhaft klingende
Erzählung aus dem Munde Jacopo da Empolis gibt), diente ihm noch
1520 zu diesem Zwecke Öfter seine Stieftochter; der Verfasser zählt
mit Hilfe von Zeichnungen verschiedene solcher Fälle auf.
In denreifen Scalzo-Fresken(1522—1523), zum Salometanz fand
di Pietro noch eine Studie zu einem Musikanten (Uff. 282 verso), der
aber im Gemälde nicht verwendet wurde. Sarto hat auch dieses Fresko
in der Ausführung dem ersten Entwurf gegenüber vereinfacht, im Sinne
größerer Dramatik, ebenso wie er es mit der Täuferhinrichtung getan hat,
zu der ein erster Entwurf existiert, mit der Szene in einer Landschaft,
nicht wie nachher ausgeführt, im Innenraum.
An weiteren Feststellungen nenne ich: Zwei Gewandstudien
(6454 und 318 verso) für das Madonnenbild im Prado. Studie für den
Kopf der Catarina des großen Berliner Bildes (Uff. 306 reeto) und für den
San Benedetto desselben Gemäldes (Uff. 306 verso). Studien für die
Gemälde der heiligen Agnes und der heiligen Margherita im Dom zu Pisa
(Uff. 317 und 315). Studien zur verlorenen, für Borgherini gemalten Sacra
Familia, die man mit Hilfe einer anonymen Seicentozeichnung in den
Uffizien (und mit Hilfe einer anonymen Kopie des XVI. Jahrhunderts im
Museum von San Marco) rekonstruieren kann, liegen in den Zeichnungen
Uff. 6444 recto und verso vor. Einen ersten Entwurf für das Heiligen-
bild von Vallombrosa, das jetzt in der Akademie hängt, lernt man
durch eine gezeichnete Kopie (Uff. 10971 und 10972) kennen.
Soviel über die wichtigsten der Einzelresultate. Es knüpfen sich
an die Zeichnungen dann noch einige andere Fragen.
Zunächst die nach dem Einfluß Dürers und Michelangelos in
Andreas Schaffen. Bei beiden schlägt der Verfasser den Einfluß gering
an, wie mir scheint mit vollem Recht. Trotzdem, wie man weiß. Andrea
den Karton der badenden Soldaten eifrig abgezeichnet hat, ist in
seine Kunst nichts Michelangeleskes eingedrungen. Seine »Massen-
taufe« im Scalzo ist ganz frei davon. Und trotzdem er in dem Fresko
der Täuferpredigt zwei Figuren aus Dürers Kupferstichpassion über-
nommen hat und vielleicht in der Mariengeburt einen Weihrauchengel
aus dem Marienleben, so ist doch in seinen Zeichenstil nichts, aber
auch gar nichts Dürerisches eingedrungen. Auch di Pietro kommt also
zu der Erkenntnis, daß der Dürersche Einfluß nur ein ganz ephemerer,
unwichtiger war, der in den Jahren, wo er kam (1514—1515), auch
gleich wieder verschwand.
Dann: War Sarto in Rom? Die Beinstudien (Uff. 339) für den
Isaak des Abrahamsopfers in Dresden sind abgeleitet von der Figur
des einen Sohnes aus der Laokoongruppe. Doch braucht man des-
wegen noch keinen Aufenthalt Sartos in Rom anzunehmen, denn er wird
diese Studie vor der in Florenz befindlichen Kopie Baccio Bandinellis
gemacht haben. Einen andern Beweis glaubt man (dies ist mündliche
Überlieferung) an der Tatsache zu haben, daß die Madonna del Sacco
im Chiostro der SS. Annunziata abgeleitet sei von der Figur der
»Stärke« in der juristischen Allegorie Rafaels in der Stanza della Se-
gnatura. Die Ähnlichkeit ist aber nur sehr vage, könnte, wenn sie wirk-
lich besteht, auf der Kenntnis eines Stiches beruhen, und die Kolo-
ristik der Sacco-Madonna endlich, die mit ihren zarten hellen Harmonien
der Raffaelschen verwandt sein soll, liegt durchaus nicht abseits vom
Wege Andreas. Sein wenig aufgesuchtes Fresko vom Tribut Cäsars
in der Medici-Villa in Poggio a Cajano, in demselben Salon, in dem
Pontormos hellfarbige Allegone gemalt ist, geht eng mit der Madonna
del Sacco zusammen. Pontormo scheint der drohenden Verfinsterung
des Florentiner Freskenkolorits wenigstens für eine Zeit hinaus noch
vorgebeugt zu haben.
Um nach dieser Abschweifung zu dem vorliegenden Buche zu-
rückzukehren: Alles in Allem eine sehr dankenswerte fruchtbare
Leistung, sorgfältig und langsam gemacht und anschaulich dargestellt.
Die Abbildungen, die sehr zahlreich sind, geben eine immerhin aus-
reichende Vorstellung der Originalzeichnungen. Emil Waldmann.
Frederick Mortimer Clapp, On certain drawings
of Pontormo. Florence. December 1911. (K. Lastrucci).
Das unillustrierte Bändchen, das Clapp über eine Anzahl von
Pontormo-Zeichnungen publiziert, ist, wie die Pietrosche Arbeit über die
Zeichnungen Sartos, eine Weiterführung und Vertiefung der Studien
Berensons. Es enthält eine große Anzahl von Feststellungen betreffs der
Zugehörigkeit von Zeichnungen zu ausgeführten Gemälden. Aliein von
Studien und Kopfstudien zu Pontormos Meisterwerk, der Lünctte im
Salon der Villa in Poggio a Cajano, konnte der Verfasser ein Dutzend
sichere namhaft machen, deren Verwendung bis dahin unerkannt geblieben
war, dann noch eine Anzahl weiterer, deren Zugehörigkeit zu diesem
Fresko mindestens sehr wahrscheinlich ist. Eine Ergänzung zu diesem
Kapitel hat dann di Pietro in einem Aufsatz im Septemberheft 1912 der
Zeitschrift »Vita d'Arte« gegeben, wo er nachweist, daß zwei Uffizien-
zeichnungen (Nr. 8976 recto und verso), die bisher unter dem Namen
Correggio gingen, von der Hand Pontormos sind und erste Entwürfe für
die Lünette darstellen.
Da Clapp in einem Anhang alle Zeichnungen namhaft macht,
deren Verwendung von ihm neu, über Berenson hinaus, festgestellt
wurde, und da er bei diesen danach unterschieden hat, ob ihre Verwendung
gesichert oder nur wahrscheinlich sei, erübrigt sich für den Rezensenten
eine Aufzählung. Es genüge die Mitteilung, daß sich dem Rezensenten
bei genauer Nachprüfung die Stichhaltigkeit aller Behauptungen ergab in
den als sicher hingestellten Fällen; und daß sich in den andern, vom
Verfasser selbst nicht urgierten, weitaus die meisten Vermutungen als
einleuchtend oder doch als möglich erwiesen. Die Interessenten seien
also auf dieses Verzeichnis, als Ergänzung zu Berensons Katalog, auf-
merksam gemacht.
Einige allgemeinere Bemerkungen sind vielleicht am Platze.
Pontormo gehört zu den Künstlern, die man ganz nur in ihren Zeich-
nungen kennen lernen kann, fast in demselben Maße, wie im Gebiete
der deutschen Kunst Urs Graf. Hatten wir Pontormos Zeichnungen
nicht, so würden wir aus ihm nicht recht klug werden. Einmal macht er
etwas so Hervorragendes wie das noch etwas im Sarto-Stil befangene,
aber immerhin sehr großartige Heimsuchungsfresko im Vorhof der
Annunziatakirche in Florenz, und dann das in seiner Originalität ganz
alleinstehende, weit vorausweisende Fresko in Poggio a Cajano — ein
Werk, an das sich die größten Hoffnungen für eine Neubelebung der
Florentiner Wandmalerei hätten knüpfen lassen, das als Dekoration Tiepolo
vorwegnimmt, ihn aber an innerer Tüchtigkeit überragt. Fast um die
gleiche Zeit entstehen die (jetzt verblaßten, aber immer noch gut ei kenn-
baren) Passionsfresken in der Certosa bei Florenz, in denen sich der
Einfluß Dürers verheerend bemerkbar gemacht hat. Und dann kommt
die Zeit, wo er Michelangelo, dem er mit dem Auswege Dürers hatte ent-
gehen wollen, doch mit Leib und Seele verfallt. Nach seinen Gemälden
würden wir also denken: Ein Talent, mit schönen Anfängen, dann dei
übliche Florentiner Manierist auf den Spuren Michelangelos, wie Vasan,
Bronzino e tutti quanti. — Seine Zeichnungen geben uns ein anderes
Bild. Er war nicht der Manierist und bequeme Akademiker, sondern bis
zuletzt hat er sein enges Verhältnis zur Natur behalten, immer und
immer wieder hat er die Natur befragt und studiert, nie sich mit fertigen
Klischees begnügt. Nur, es fiel ihm, dem verschlossenen Sinnierer, nichts
mehr ein, er wußte nicht, wozu er seine feine Kunst noch halte ver-
wenden sollen, da ihm nicht einmal die zweite Lünette in Poggio a
Cajano, für die er gute Ideen und eine Menge Vorarbeiten hatte, in Auf-
denen Andrea mit ein paar Strichen die Lage der Linie in dei Mache
angibt, eine immer die Vorstufe zur andern, in demselben Sinne wie
Van Dyck seine Bildnisse in Federskizzen »probierte«. Dann behandelt
di Pietro das Berliner Frauenporträt, jene Ölskizzc, die man als Studien-
kopf nach des Künstlers Frau Lukrezia ansieht. Er stellt den Zusam-
menhang fest zwischen diesem Bilde und der schönen Zeichnung einer
sitzenden Frau (Uff. (347) und kommt an der Hand dieser unleugbaren
Übereinstimmung zu der Annahme, daß das Berliner Porträt ursprunglich
auch ein Kniebild oder wenigstens als solches beabsichtigt war; die
genaue Übereinstimmung des Bildes mit dem Oberteil der Zeichnung
macht diese Annahme zur Gewißheit. Wahrscheinlich war das Bildnis
der Lucrezia dann als Pendant gedacht zu dem Porträt des jungen
Mädchens in den Uffizien, die der Verfasser für Andreas Stieftochter
Maria (aus Lucrezias erster Ehe mit Berettajo) halt. Während Andrea
in der Mitte des zweiten Jahrzehnts des XVI. Jahrhunderts gelegentlich
seine Frau als Modell benutzt, zum Beispiel m der Mariengeburt im Annun-
ziata-Vorhof (worüber es bei Bnndinelli eine sehr glaubhaft klingende
Erzählung aus dem Munde Jacopo da Empolis gibt), diente ihm noch
1520 zu diesem Zwecke Öfter seine Stieftochter; der Verfasser zählt
mit Hilfe von Zeichnungen verschiedene solcher Fälle auf.
In denreifen Scalzo-Fresken(1522—1523), zum Salometanz fand
di Pietro noch eine Studie zu einem Musikanten (Uff. 282 verso), der
aber im Gemälde nicht verwendet wurde. Sarto hat auch dieses Fresko
in der Ausführung dem ersten Entwurf gegenüber vereinfacht, im Sinne
größerer Dramatik, ebenso wie er es mit der Täuferhinrichtung getan hat,
zu der ein erster Entwurf existiert, mit der Szene in einer Landschaft,
nicht wie nachher ausgeführt, im Innenraum.
An weiteren Feststellungen nenne ich: Zwei Gewandstudien
(6454 und 318 verso) für das Madonnenbild im Prado. Studie für den
Kopf der Catarina des großen Berliner Bildes (Uff. 306 reeto) und für den
San Benedetto desselben Gemäldes (Uff. 306 verso). Studien für die
Gemälde der heiligen Agnes und der heiligen Margherita im Dom zu Pisa
(Uff. 317 und 315). Studien zur verlorenen, für Borgherini gemalten Sacra
Familia, die man mit Hilfe einer anonymen Seicentozeichnung in den
Uffizien (und mit Hilfe einer anonymen Kopie des XVI. Jahrhunderts im
Museum von San Marco) rekonstruieren kann, liegen in den Zeichnungen
Uff. 6444 recto und verso vor. Einen ersten Entwurf für das Heiligen-
bild von Vallombrosa, das jetzt in der Akademie hängt, lernt man
durch eine gezeichnete Kopie (Uff. 10971 und 10972) kennen.
Soviel über die wichtigsten der Einzelresultate. Es knüpfen sich
an die Zeichnungen dann noch einige andere Fragen.
Zunächst die nach dem Einfluß Dürers und Michelangelos in
Andreas Schaffen. Bei beiden schlägt der Verfasser den Einfluß gering
an, wie mir scheint mit vollem Recht. Trotzdem, wie man weiß. Andrea
den Karton der badenden Soldaten eifrig abgezeichnet hat, ist in
seine Kunst nichts Michelangeleskes eingedrungen. Seine »Massen-
taufe« im Scalzo ist ganz frei davon. Und trotzdem er in dem Fresko
der Täuferpredigt zwei Figuren aus Dürers Kupferstichpassion über-
nommen hat und vielleicht in der Mariengeburt einen Weihrauchengel
aus dem Marienleben, so ist doch in seinen Zeichenstil nichts, aber
auch gar nichts Dürerisches eingedrungen. Auch di Pietro kommt also
zu der Erkenntnis, daß der Dürersche Einfluß nur ein ganz ephemerer,
unwichtiger war, der in den Jahren, wo er kam (1514—1515), auch
gleich wieder verschwand.
Dann: War Sarto in Rom? Die Beinstudien (Uff. 339) für den
Isaak des Abrahamsopfers in Dresden sind abgeleitet von der Figur
des einen Sohnes aus der Laokoongruppe. Doch braucht man des-
wegen noch keinen Aufenthalt Sartos in Rom anzunehmen, denn er wird
diese Studie vor der in Florenz befindlichen Kopie Baccio Bandinellis
gemacht haben. Einen andern Beweis glaubt man (dies ist mündliche
Überlieferung) an der Tatsache zu haben, daß die Madonna del Sacco
im Chiostro der SS. Annunziata abgeleitet sei von der Figur der
»Stärke« in der juristischen Allegorie Rafaels in der Stanza della Se-
gnatura. Die Ähnlichkeit ist aber nur sehr vage, könnte, wenn sie wirk-
lich besteht, auf der Kenntnis eines Stiches beruhen, und die Kolo-
ristik der Sacco-Madonna endlich, die mit ihren zarten hellen Harmonien
der Raffaelschen verwandt sein soll, liegt durchaus nicht abseits vom
Wege Andreas. Sein wenig aufgesuchtes Fresko vom Tribut Cäsars
in der Medici-Villa in Poggio a Cajano, in demselben Salon, in dem
Pontormos hellfarbige Allegone gemalt ist, geht eng mit der Madonna
del Sacco zusammen. Pontormo scheint der drohenden Verfinsterung
des Florentiner Freskenkolorits wenigstens für eine Zeit hinaus noch
vorgebeugt zu haben.
Um nach dieser Abschweifung zu dem vorliegenden Buche zu-
rückzukehren: Alles in Allem eine sehr dankenswerte fruchtbare
Leistung, sorgfältig und langsam gemacht und anschaulich dargestellt.
Die Abbildungen, die sehr zahlreich sind, geben eine immerhin aus-
reichende Vorstellung der Originalzeichnungen. Emil Waldmann.
Frederick Mortimer Clapp, On certain drawings
of Pontormo. Florence. December 1911. (K. Lastrucci).
Das unillustrierte Bändchen, das Clapp über eine Anzahl von
Pontormo-Zeichnungen publiziert, ist, wie die Pietrosche Arbeit über die
Zeichnungen Sartos, eine Weiterführung und Vertiefung der Studien
Berensons. Es enthält eine große Anzahl von Feststellungen betreffs der
Zugehörigkeit von Zeichnungen zu ausgeführten Gemälden. Aliein von
Studien und Kopfstudien zu Pontormos Meisterwerk, der Lünctte im
Salon der Villa in Poggio a Cajano, konnte der Verfasser ein Dutzend
sichere namhaft machen, deren Verwendung bis dahin unerkannt geblieben
war, dann noch eine Anzahl weiterer, deren Zugehörigkeit zu diesem
Fresko mindestens sehr wahrscheinlich ist. Eine Ergänzung zu diesem
Kapitel hat dann di Pietro in einem Aufsatz im Septemberheft 1912 der
Zeitschrift »Vita d'Arte« gegeben, wo er nachweist, daß zwei Uffizien-
zeichnungen (Nr. 8976 recto und verso), die bisher unter dem Namen
Correggio gingen, von der Hand Pontormos sind und erste Entwürfe für
die Lünette darstellen.
Da Clapp in einem Anhang alle Zeichnungen namhaft macht,
deren Verwendung von ihm neu, über Berenson hinaus, festgestellt
wurde, und da er bei diesen danach unterschieden hat, ob ihre Verwendung
gesichert oder nur wahrscheinlich sei, erübrigt sich für den Rezensenten
eine Aufzählung. Es genüge die Mitteilung, daß sich dem Rezensenten
bei genauer Nachprüfung die Stichhaltigkeit aller Behauptungen ergab in
den als sicher hingestellten Fällen; und daß sich in den andern, vom
Verfasser selbst nicht urgierten, weitaus die meisten Vermutungen als
einleuchtend oder doch als möglich erwiesen. Die Interessenten seien
also auf dieses Verzeichnis, als Ergänzung zu Berensons Katalog, auf-
merksam gemacht.
Einige allgemeinere Bemerkungen sind vielleicht am Platze.
Pontormo gehört zu den Künstlern, die man ganz nur in ihren Zeich-
nungen kennen lernen kann, fast in demselben Maße, wie im Gebiete
der deutschen Kunst Urs Graf. Hatten wir Pontormos Zeichnungen
nicht, so würden wir aus ihm nicht recht klug werden. Einmal macht er
etwas so Hervorragendes wie das noch etwas im Sarto-Stil befangene,
aber immerhin sehr großartige Heimsuchungsfresko im Vorhof der
Annunziatakirche in Florenz, und dann das in seiner Originalität ganz
alleinstehende, weit vorausweisende Fresko in Poggio a Cajano — ein
Werk, an das sich die größten Hoffnungen für eine Neubelebung der
Florentiner Wandmalerei hätten knüpfen lassen, das als Dekoration Tiepolo
vorwegnimmt, ihn aber an innerer Tüchtigkeit überragt. Fast um die
gleiche Zeit entstehen die (jetzt verblaßten, aber immer noch gut ei kenn-
baren) Passionsfresken in der Certosa bei Florenz, in denen sich der
Einfluß Dürers verheerend bemerkbar gemacht hat. Und dann kommt
die Zeit, wo er Michelangelo, dem er mit dem Auswege Dürers hatte ent-
gehen wollen, doch mit Leib und Seele verfallt. Nach seinen Gemälden
würden wir also denken: Ein Talent, mit schönen Anfängen, dann dei
übliche Florentiner Manierist auf den Spuren Michelangelos, wie Vasan,
Bronzino e tutti quanti. — Seine Zeichnungen geben uns ein anderes
Bild. Er war nicht der Manierist und bequeme Akademiker, sondern bis
zuletzt hat er sein enges Verhältnis zur Natur behalten, immer und
immer wieder hat er die Natur befragt und studiert, nie sich mit fertigen
Klischees begnügt. Nur, es fiel ihm, dem verschlossenen Sinnierer, nichts
mehr ein, er wußte nicht, wozu er seine feine Kunst noch halte ver-
wenden sollen, da ihm nicht einmal die zweite Lünette in Poggio a
Cajano, für die er gute Ideen und eine Menge Vorarbeiten hatte, in Auf-