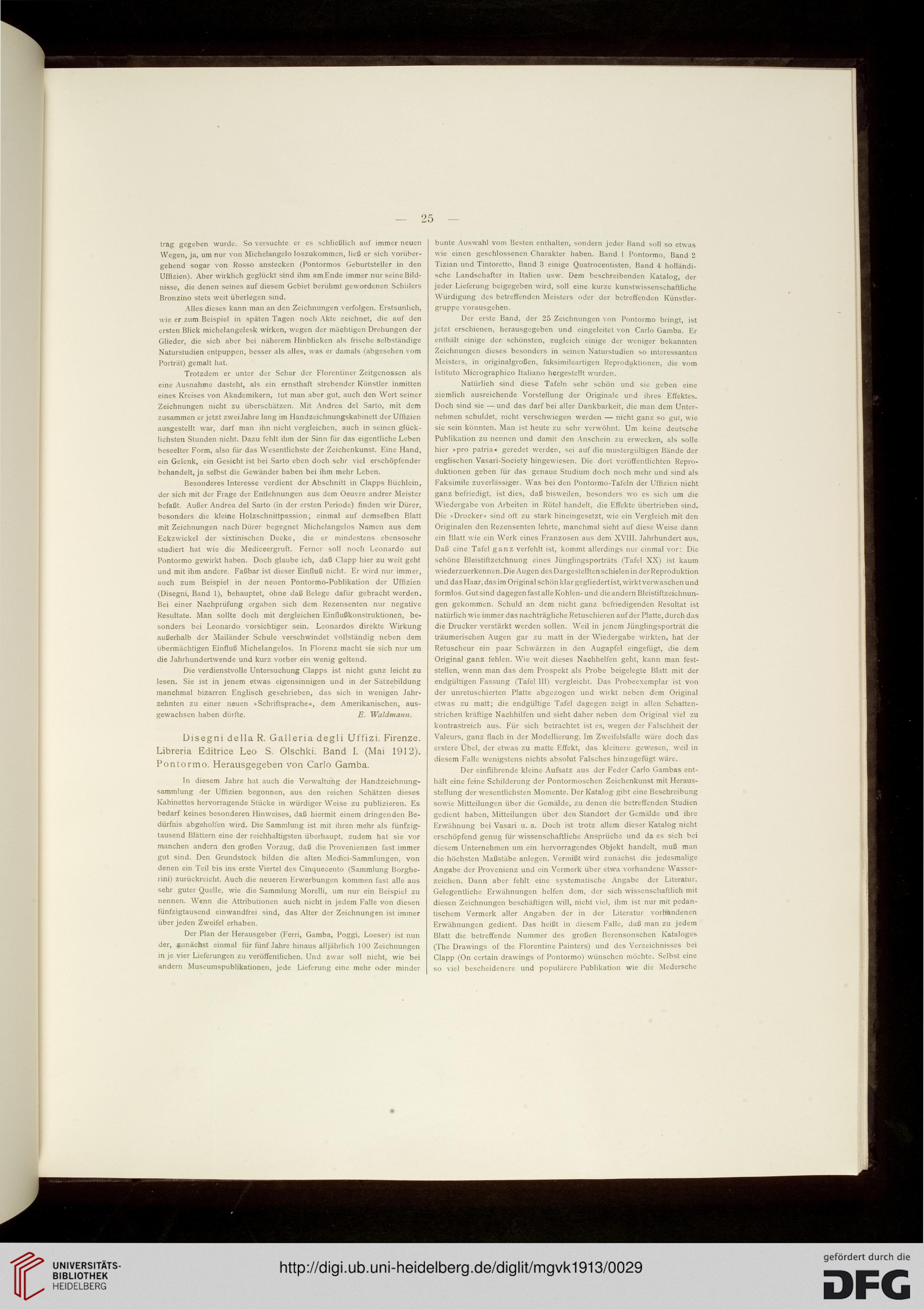25
trag gegeben wurde. So versuchte er es schließlich auf immer neuen
Wegen, ja, um nur von Michelangelo loszukommen, ließ er sich vorüber-
gehend sogar von Rosso anstecken (Pontormos Geburtstellcr in den
Uffizien). Aber wirklich gegluckt sind ihm am Ende immer nur seine Bild-
nisse, die denen seines auf diesem Gebiet berühmt gewordenen Schillers
Bronzino stets weit überlegen sind.
Alles dieses kann man an den Zeichnungen verfolgen. Erstaunlich,
wie er zum Beispiel in späten Tagen noch Akte zeichnet, die auf den
ersten Blick michelangelesk wirken, wegen der mächtigen Drehungen der
Glieder, die sich aber bei näherem Hinblicken als frische selbständige
Naturstudien entpuppen, besser als alles, was er damals (abgesehen vom
Porträt) gemalt hat.
Trotzdem er unter der Schar der Florentiner Zeitgenossen als
eine Ausnahme dasteht, als ein ernsthaft strebender Künstler inmitten
eines Kreises von Akademikern, tut man aber gut, auch den Wert seiner
Zeichnungen nicht zu überschätzen. Mit Andrea del Sarto, mit dem
zusammen er jetzt zwei Jahre lang im Handzeichnungskabinett der Uffizien
ausgestellt war, darf man ihn nicht vergleichen, auch in seinen glück-
lichsten Stunden nicht. Dazu fehlt ihm der Sinn für das eigentliche Leben
beseelter Form, also für das Wesentlichste der Zeichenkunst. Eine Hand,
ein Gelenk, ein Gesicht ist bei Sarto eben doch sehr viel erschöpfender
behandelt, ja selbst die Gewänder haben bei ihm mehr Leben.
Besonderes Interesse verdient der Abschnitt in Clapps Büchlein,
der sich mit der Frage der Entlehnungen aus dem Oeuvre andrer Meister
befaßt. Außer Andrea del Sarto (in der ersten Periode) finden wir Dürer,
besonders die kleine Holzschnittpassion, einmal auf demselben Blatt
mit Zeichnungen nach Dürer begegnet Michelangelos Namen aus dem
Eckzwickel der sixtinischen Decke, die er mindestens ebensosehr
studiert hat wie die Mediceergruft. Ferner soll noch Leonardo auf
Pontormo gewirkt haben. Doch glaube ich, daß Clapp hier zu weit geht
und mit ihm andere. Faßbar ist dieser Einfluß nicht. Er wird nur immer,
auch zum Beispiel in der neuen Pontormo-Publikation der Uffizien
i,Disegni, Band 1), behauptet, ohne daß Belege dafür gebracht werden.
Bei einer Nachptufung ergaben sich dem Rezensenten nur negative
Resultate. Man sollte doch mit dergleichen Einflußkonstruktionen, be-
sonders bei Leonaido vorsichtiger sein. Leonardos direkte Wirkung
außerhalb der Mailänder Schule verschwindet vollständig neben dem
übermächtigen Einfluß Michelangelos. In Florenz macht sie sich nur um
die Jahrhundertwende und kurz vorher ein wenig geltend.
Die verdienstvolle Untersuchung Clapps ist nicht ganz leicht zu
lesen. Sie ist in jenem etwas eigensinnigen und in der Salzebildung
manchmal bizarren Englisch geschrieben, das sich in wenigen Jahr-
zehnten zu einer neuen Schriftsprache«, dem Amerikanischen, aus-
gewachsen haben durfte. E. Waldmann.
Disegni della R. Galleria degli Uffizi. Firenze.
Libreria Editrice Leo S. Olschki. Band I. (Mai 1912).
Pontormo. Herausgegeben von Carlo Gamba.
In diesem Jahre hat auch die Verwaltung der Handzcichnung-
sammlung der Uffizien begonnen, aus den reichen Schätzen dieses
Kabinettes hervorragende Stücke in würdiger Weise zu publizieren. Es
bedarf keines besonderen Hinweises, daß hiermit einem dringenden Be-
dürfnis abgeholfen wird. Die Sammlung ist mit ihren mehr als fünfzig-
tausend Blättern eine der reichhaltigsten überhaupt, zudem hat sie vor
manchen andern den großen Vorzug, daß die Provenienzen fast immer
gut sind. Den Grundstock bilden die alten Medici-Sammlungen, von
denen ein Teil bis ins erste Viertel des Cinquecento (Sammlung Borghe-
nnn zurückreicht. Auch die neueren Erwerbungen kommen fast alle aus
sehr guter Quelle, wie die Sammlung Morelli, um nur ein Beispiel zu
nennen. Wenn die Attributionen auch nicht in jedem Falle von diesen
lünfzigtausend einwandfrei sind, das Alter der Zeichnungen ist immer
über jeden Zweifel erhaben.
Der Plan der Herausgeber (Ferri, Gamba, Poggi, Loeser) ist nun
der, zunächst einmal für fünf Jahre hinaus alljährlich 100 Zeichnungen
in je vier Lieferungen zu veröffentlichen. Und zwar soll nicht, wie bei
andern Museumspublikationen, jede Lieferung eine mehr oder minder
bunte Auswahl vom Besten enthalten, sondern jeder Hand soll so etwas
wie einen geschlossenen Charakter haben. Band 1 Pontormo, Band 2
Tizian und Tintorctto, Band 3 einige Quatrocentisten, Band 4 holländi-
sche Landschafter in Italien usw. Dem beschreibenden Katalog, der
jeder Lieferung beigegeben wird, soll eine kurze kunstwissenschaftliche
Würdigung des betreffenden Meisters oder der betreffenden Kunstler-
gruppe vorausgehen.
Der erste Band, der 25 Zeichnungen von Pontormo bringt, ist
jetzt erschienen, herausgegeben und eingeleitet von Carlo Gamba. Er
enthalt einige der schönsten, zugleich einige der weniger bekannten
Zeichnungen dieses besonders in seinen Naturstudien so interessanten
Meisters, in Originalgrößen, faksimileartigen Reproduktionen, die vom
Istituto Micrographico Itahano hergestellt wurden.
Natürlich sind diese Tafeln sehr schön und sie geben eine
ziemlich ausreichende Vorstellung der Originale und ihres Effektes.
Doch sind sie —und das darf bei aller Dankbarkeit, die man dem Unter-
nehmen schuldet, nicht verschwiegen werden — nicht ganz so gut, wie
sie sein könnten. Man ist heute zu sehr verwöhnt. Um keine deutsche
Publikation zu nennen und damit den Anschein zu erwecken, als solle
hier »pro patriae geredet weiden, sei auf die mustergültigen Bände der
englischen Vasari-Society hingewiesen. Die dort veröffentlichten Repro-
duktionen geben für das genaue Studium doch noch mehr und sind als
Faksimile zuverlässiger. Was bei den Pontormo-Tafeln der Uffizien nicht
ganz befriedigt, ist dies, daß bisweilen, besonders wo es sich um die
Wiedergabe von Arbeiten in Rötel handeil, die Effekte übertrieben sind.
Die >Drucker* sind oft zu stark hineingesetzt, wie ein Vergleich mit den
Originalen den Rezensenten lehrte, manchmal sieht auf diese Weise dann
ein Blatt wie ein Werk eines Franzosen aus dem XVIII. Jahrhundert aus.
Daß eine Tafel ganz verfehlt ist, kommt allerdings nur einmal vor: Die
schöne Bleistiftzeichnung eines Jünglingsporträts (Tafel XX) ist kaum
wiederzuerkennen. Die Augen des Dargestellten schielen in der Reproduktion
und das Haar, das im Original schön klar gegliedert ist, wirkt verwaschen und
formlos. Gut sind dagegen fast alle Kohlen-und die andern Bleistiftzeichnun-
gen gekommen. Schuld an dem nicht ganz befriedigenden Resultat ist
natürlich wie immer das nachträgliche Retuschieren auf der Platte, durch das
die Drucker verstärkt werden sollen. Weil in jenem Jünglingsporträt die
träumerischen Augen gar zu matt in der Wiedergabe wirkten, hat der
Retuscheur ein paar Schwärzen in den Augapfel eingefügt, die dem
Original ganz fehlen. Wie weit dieses Nachhelfen geht, kann man fest-
stellen, wenn man das dem Prospekt als Probe beigelegte Blatt mit der
endgültigen Fassung (Tafel III) vergleicht. Das Probeexemplar ist von
der unretuschierten Platte abgezogen und wirkt neben dem Original
etwas zu matt; die endgültige Tafel dagegen zeigt in allen Schatten-
Strichen kraftige Nachhilfen und sieht daher neben dem Original viel zu
kontrastreich aus. Für sich betrachtet ist es, wegen der Falschheit der
Valeurs, ganz flach in der Modellierung. Im Zweifclsfalle wäre doch das
erstere Übel, der etwas zu matte Effekt, das kleinere gewesen, weil in
diesem Falle wenigstens nichts absolut Falsches hinzugefügt wrare.
Der einführende kleine Aufsatz aus der Feder Carlo Gambas ent-
hält eine feine Schilderung der Pontormoschen Zeichenkunst mit Heraus-
stellung der wesentlichsten Momente. Der Katalog gibt eine Beschreibung
sowie Mitteilungen über die Gemälde, zu denen die betreffenden Studien
gedient haben, Mitteilungen über den Standort der Gemälde und ihre
Erwähnung bei Vasari u. a. Doch ist trotz allem dieser Katalog nicht
erschöpfend genug für wissenschaftliche Ansprüche und da es sich bei
diesem Unternehmen um ein hervorragendes Objekt handelt, muß man
die höchsten Maßstabe anlegen. Vermißt wird zunächst die jedesmalige
Angabe der Provenienz und ein Vermerk über etwa vorhandene Wasser-
zeichen. Dann aber fehlt eine systematische Angabe der Literatur.
Gelegentliche Erwähnungen helfen dem, der sich wissenschaftlich mit
diesen Zeichnungen beschäftigen will, nicht viel, ihm ist nur mit pedan-
tischem Vermerk aller Angaben der in der Literatur vorhandenen
Erwähnungen gedient. Das heißt in diesem Falle, daß man zu jedem
Blatt die betreffende Nummer des großen Berensonschen Kataloges
(The Drawings of the Florentine Painters) und des Verzeichnisses bei
Clapp (On certain drawings of Pontormo) wünschen möchte. Selbst eine
so viel bescheidenere und populärere Publikation wie die Medersche
trag gegeben wurde. So versuchte er es schließlich auf immer neuen
Wegen, ja, um nur von Michelangelo loszukommen, ließ er sich vorüber-
gehend sogar von Rosso anstecken (Pontormos Geburtstellcr in den
Uffizien). Aber wirklich gegluckt sind ihm am Ende immer nur seine Bild-
nisse, die denen seines auf diesem Gebiet berühmt gewordenen Schillers
Bronzino stets weit überlegen sind.
Alles dieses kann man an den Zeichnungen verfolgen. Erstaunlich,
wie er zum Beispiel in späten Tagen noch Akte zeichnet, die auf den
ersten Blick michelangelesk wirken, wegen der mächtigen Drehungen der
Glieder, die sich aber bei näherem Hinblicken als frische selbständige
Naturstudien entpuppen, besser als alles, was er damals (abgesehen vom
Porträt) gemalt hat.
Trotzdem er unter der Schar der Florentiner Zeitgenossen als
eine Ausnahme dasteht, als ein ernsthaft strebender Künstler inmitten
eines Kreises von Akademikern, tut man aber gut, auch den Wert seiner
Zeichnungen nicht zu überschätzen. Mit Andrea del Sarto, mit dem
zusammen er jetzt zwei Jahre lang im Handzeichnungskabinett der Uffizien
ausgestellt war, darf man ihn nicht vergleichen, auch in seinen glück-
lichsten Stunden nicht. Dazu fehlt ihm der Sinn für das eigentliche Leben
beseelter Form, also für das Wesentlichste der Zeichenkunst. Eine Hand,
ein Gelenk, ein Gesicht ist bei Sarto eben doch sehr viel erschöpfender
behandelt, ja selbst die Gewänder haben bei ihm mehr Leben.
Besonderes Interesse verdient der Abschnitt in Clapps Büchlein,
der sich mit der Frage der Entlehnungen aus dem Oeuvre andrer Meister
befaßt. Außer Andrea del Sarto (in der ersten Periode) finden wir Dürer,
besonders die kleine Holzschnittpassion, einmal auf demselben Blatt
mit Zeichnungen nach Dürer begegnet Michelangelos Namen aus dem
Eckzwickel der sixtinischen Decke, die er mindestens ebensosehr
studiert hat wie die Mediceergruft. Ferner soll noch Leonardo auf
Pontormo gewirkt haben. Doch glaube ich, daß Clapp hier zu weit geht
und mit ihm andere. Faßbar ist dieser Einfluß nicht. Er wird nur immer,
auch zum Beispiel in der neuen Pontormo-Publikation der Uffizien
i,Disegni, Band 1), behauptet, ohne daß Belege dafür gebracht werden.
Bei einer Nachptufung ergaben sich dem Rezensenten nur negative
Resultate. Man sollte doch mit dergleichen Einflußkonstruktionen, be-
sonders bei Leonaido vorsichtiger sein. Leonardos direkte Wirkung
außerhalb der Mailänder Schule verschwindet vollständig neben dem
übermächtigen Einfluß Michelangelos. In Florenz macht sie sich nur um
die Jahrhundertwende und kurz vorher ein wenig geltend.
Die verdienstvolle Untersuchung Clapps ist nicht ganz leicht zu
lesen. Sie ist in jenem etwas eigensinnigen und in der Salzebildung
manchmal bizarren Englisch geschrieben, das sich in wenigen Jahr-
zehnten zu einer neuen Schriftsprache«, dem Amerikanischen, aus-
gewachsen haben durfte. E. Waldmann.
Disegni della R. Galleria degli Uffizi. Firenze.
Libreria Editrice Leo S. Olschki. Band I. (Mai 1912).
Pontormo. Herausgegeben von Carlo Gamba.
In diesem Jahre hat auch die Verwaltung der Handzcichnung-
sammlung der Uffizien begonnen, aus den reichen Schätzen dieses
Kabinettes hervorragende Stücke in würdiger Weise zu publizieren. Es
bedarf keines besonderen Hinweises, daß hiermit einem dringenden Be-
dürfnis abgeholfen wird. Die Sammlung ist mit ihren mehr als fünfzig-
tausend Blättern eine der reichhaltigsten überhaupt, zudem hat sie vor
manchen andern den großen Vorzug, daß die Provenienzen fast immer
gut sind. Den Grundstock bilden die alten Medici-Sammlungen, von
denen ein Teil bis ins erste Viertel des Cinquecento (Sammlung Borghe-
nnn zurückreicht. Auch die neueren Erwerbungen kommen fast alle aus
sehr guter Quelle, wie die Sammlung Morelli, um nur ein Beispiel zu
nennen. Wenn die Attributionen auch nicht in jedem Falle von diesen
lünfzigtausend einwandfrei sind, das Alter der Zeichnungen ist immer
über jeden Zweifel erhaben.
Der Plan der Herausgeber (Ferri, Gamba, Poggi, Loeser) ist nun
der, zunächst einmal für fünf Jahre hinaus alljährlich 100 Zeichnungen
in je vier Lieferungen zu veröffentlichen. Und zwar soll nicht, wie bei
andern Museumspublikationen, jede Lieferung eine mehr oder minder
bunte Auswahl vom Besten enthalten, sondern jeder Hand soll so etwas
wie einen geschlossenen Charakter haben. Band 1 Pontormo, Band 2
Tizian und Tintorctto, Band 3 einige Quatrocentisten, Band 4 holländi-
sche Landschafter in Italien usw. Dem beschreibenden Katalog, der
jeder Lieferung beigegeben wird, soll eine kurze kunstwissenschaftliche
Würdigung des betreffenden Meisters oder der betreffenden Kunstler-
gruppe vorausgehen.
Der erste Band, der 25 Zeichnungen von Pontormo bringt, ist
jetzt erschienen, herausgegeben und eingeleitet von Carlo Gamba. Er
enthalt einige der schönsten, zugleich einige der weniger bekannten
Zeichnungen dieses besonders in seinen Naturstudien so interessanten
Meisters, in Originalgrößen, faksimileartigen Reproduktionen, die vom
Istituto Micrographico Itahano hergestellt wurden.
Natürlich sind diese Tafeln sehr schön und sie geben eine
ziemlich ausreichende Vorstellung der Originale und ihres Effektes.
Doch sind sie —und das darf bei aller Dankbarkeit, die man dem Unter-
nehmen schuldet, nicht verschwiegen werden — nicht ganz so gut, wie
sie sein könnten. Man ist heute zu sehr verwöhnt. Um keine deutsche
Publikation zu nennen und damit den Anschein zu erwecken, als solle
hier »pro patriae geredet weiden, sei auf die mustergültigen Bände der
englischen Vasari-Society hingewiesen. Die dort veröffentlichten Repro-
duktionen geben für das genaue Studium doch noch mehr und sind als
Faksimile zuverlässiger. Was bei den Pontormo-Tafeln der Uffizien nicht
ganz befriedigt, ist dies, daß bisweilen, besonders wo es sich um die
Wiedergabe von Arbeiten in Rötel handeil, die Effekte übertrieben sind.
Die >Drucker* sind oft zu stark hineingesetzt, wie ein Vergleich mit den
Originalen den Rezensenten lehrte, manchmal sieht auf diese Weise dann
ein Blatt wie ein Werk eines Franzosen aus dem XVIII. Jahrhundert aus.
Daß eine Tafel ganz verfehlt ist, kommt allerdings nur einmal vor: Die
schöne Bleistiftzeichnung eines Jünglingsporträts (Tafel XX) ist kaum
wiederzuerkennen. Die Augen des Dargestellten schielen in der Reproduktion
und das Haar, das im Original schön klar gegliedert ist, wirkt verwaschen und
formlos. Gut sind dagegen fast alle Kohlen-und die andern Bleistiftzeichnun-
gen gekommen. Schuld an dem nicht ganz befriedigenden Resultat ist
natürlich wie immer das nachträgliche Retuschieren auf der Platte, durch das
die Drucker verstärkt werden sollen. Weil in jenem Jünglingsporträt die
träumerischen Augen gar zu matt in der Wiedergabe wirkten, hat der
Retuscheur ein paar Schwärzen in den Augapfel eingefügt, die dem
Original ganz fehlen. Wie weit dieses Nachhelfen geht, kann man fest-
stellen, wenn man das dem Prospekt als Probe beigelegte Blatt mit der
endgültigen Fassung (Tafel III) vergleicht. Das Probeexemplar ist von
der unretuschierten Platte abgezogen und wirkt neben dem Original
etwas zu matt; die endgültige Tafel dagegen zeigt in allen Schatten-
Strichen kraftige Nachhilfen und sieht daher neben dem Original viel zu
kontrastreich aus. Für sich betrachtet ist es, wegen der Falschheit der
Valeurs, ganz flach in der Modellierung. Im Zweifclsfalle wäre doch das
erstere Übel, der etwas zu matte Effekt, das kleinere gewesen, weil in
diesem Falle wenigstens nichts absolut Falsches hinzugefügt wrare.
Der einführende kleine Aufsatz aus der Feder Carlo Gambas ent-
hält eine feine Schilderung der Pontormoschen Zeichenkunst mit Heraus-
stellung der wesentlichsten Momente. Der Katalog gibt eine Beschreibung
sowie Mitteilungen über die Gemälde, zu denen die betreffenden Studien
gedient haben, Mitteilungen über den Standort der Gemälde und ihre
Erwähnung bei Vasari u. a. Doch ist trotz allem dieser Katalog nicht
erschöpfend genug für wissenschaftliche Ansprüche und da es sich bei
diesem Unternehmen um ein hervorragendes Objekt handelt, muß man
die höchsten Maßstabe anlegen. Vermißt wird zunächst die jedesmalige
Angabe der Provenienz und ein Vermerk über etwa vorhandene Wasser-
zeichen. Dann aber fehlt eine systematische Angabe der Literatur.
Gelegentliche Erwähnungen helfen dem, der sich wissenschaftlich mit
diesen Zeichnungen beschäftigen will, nicht viel, ihm ist nur mit pedan-
tischem Vermerk aller Angaben der in der Literatur vorhandenen
Erwähnungen gedient. Das heißt in diesem Falle, daß man zu jedem
Blatt die betreffende Nummer des großen Berensonschen Kataloges
(The Drawings of the Florentine Painters) und des Verzeichnisses bei
Clapp (On certain drawings of Pontormo) wünschen möchte. Selbst eine
so viel bescheidenere und populärere Publikation wie die Medersche