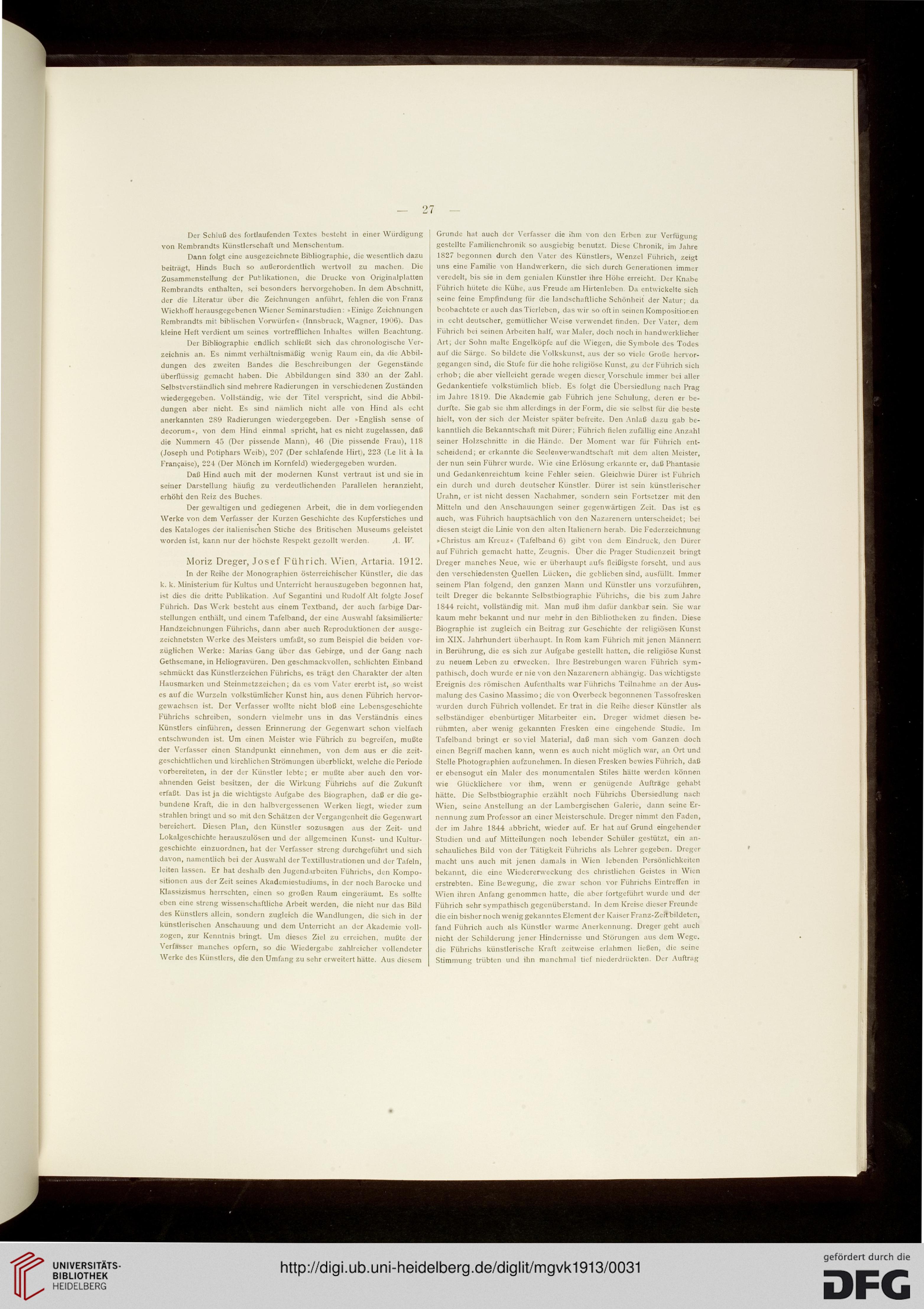— 27
Der Schluß des fortlaufenden Textes besteht in einer Würdigung
von Remhrandts Künstlerschaft und Menschentum.
Dann folgt eine ausgezeichnete Bibliographie, die wesentlich dazu
beitragt, Hinds Buch so außerordentlich wertvoll zu machen. Die
Zusammenstellung der Publikationen, die Drucke von Originalplatten
Rembrandts enthalten, sei besonders hervorgehoben. In dem Abschnitt,
der die Literatur über die Zeichnungen anfühlt, fehlen die von Franz
Wickhoff herausgegebenen Wiener Seminarstudien: »Einige Zeichnungen
Rembrandts mit biblischen Vorwürfen« (Innsbruck, Wagner, 1906). Das
kleine Heft verdient um seines vortrefflichen Inhaltes willen Beachtung.
Der Bibliographie endlich schließt sich das chronologische Ver-
zeichnis an. Es nimmt verhältnismäßig wenig Raum ein. da die Abbil-
dungen des zweiten Bandes die Beschreibungen der Gegenstände
überflussig gemacht haben. Die Abbildungen sind 330 an der Zahl.
Selbstverständlich sind mehrere Radierungen in verschiedenen Zuständen
wiedergegeben. Vollständig, wie der Titel verspricht, sind die Abbil-
dungen aber nicht. Es sind nämlich nicht alle von Hind als echt
anerkannten 289 Radierungen wiedergegeben. Der »English sense of
decorum«, von dem Hind einmal spricht, hat es nicht zugelassen, daß
die Nummern 45 (Der pissende Mann), 46 (Die pissende Frau), 118
(Joseph und Pctiphars Weib), 207 (Der schlafende Hirt), 223 (Le lit ä la
Francaise), 224 (Der Mönch im Kornfeld) wiedergegeben wurden.
Daß Hind auch mit der modernen Kunst vertraut ist und sie in
seiner Darstellung häufig zu verdeutlichenden Parallelen heranzieht,
erhöht den Reiz des Buches.
Der gewaltigen und gediegenen Arbeit, die in dem vorliegenden
Werke von dem Verfasser der Kurzen Geschichte des Kupferstiches und
des Kataloges der italienischen Stiche des Britischen Museums geleistet
worden ist, kann nur der höchste Respekt gezollt werden. A. W.
Moriz Dreger, Josef Führich. Wien, Artaria. 1912.
In der Reihe der Monographien österreichischer Künstler, die das
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht herauszugeben begonnen hat,
ist dies die dritte Publikation. Auf Segantini und Rudolf Alt folgte Josef
Führich. Das Werk besteht aus einem Textband, der auch farbige Dar-
stellungen enthält, und einem Tafelband, der eine Auswahl faksimilierter
Handzeichnungen Führichs, dann aber auch Reproduktionen der ausge-
zeichnetsten Werke des Meisters umfaßt, so zum Beispiel die beiden vor-
züglichen Werke: Marias Gang über das Gebirge, und der Gang nach
Gethsemane, in Heliogravüren. Den geschmackvollen, schlichten Einband
schmückt das Kunstlerzeichen Führichs, es trägt den Charakter der alten
Hausmarken und Steinmetzzeichen; da es vom Vater ererbt ist, so weist
es auf die Wurzeln volkstümlicher Kunst hin, aus denen Führich hervor-
gewachsen ist. Der Verfasser wollte nicht bloß eine Lebensgeschichte
Führichs schreiben, sondern vielmehr uns in das Verständnis eines
Künstlers einführen, dessen Erinnerung der Gegenwart schon vielfach
entschwunden ist. Um einen Meister wie Führich zu begreifen, mußte
der Verfasser einen Standpunkt einnehmen, von dem aus er die zeit-
geschichtlichen und kirchlichen Strömungen überblickt, welche die Periode
vorbereiteten, in der der Künstler lebte; er mußte aber auch den vor-
ahnenden Geist besitzen, der die Wirkung Führichs auf die Zukunft
erfaßt. Das ist ja die wichtigste Aufgabe des Biographen, daß er die ge-
bundene Kraft, die in den halb vergessenen Werken Hegt, wieder zum
strahlen bringt und so mit den Schätzen der Vergangenheit die Gegenwart
bereichert. Diesen Plan, den Kunstler sozusagen aus der Zeit- und
Lokalgeschichte herauszulösen und du allgemeinen Kunst- und Kultur-
geschichte einzuordnen, hat der Verfasser streng durchgeführt und sich
davon, namentlich bei der Auswahl der Textillustrationen und der Tafeln,
leiten lassen. Er hat deshalb den Jugendarbeiten Führichs, den Kompo-
sitionen aus der Zeit seines Akademiestudiums, in der noch Barocke und
Klassizismus herrschten, einen so großen Raum eingeräumt. Es sollte
eben eine streng wissenschaftliche Arbeit werden, die nicht nur das Bild
des Künstlers allein, sondern zugleich die Wandlungen, die sich in der
künstlerischen Anschauung und dem Unterricht an der Akademie voll-
zogen, zur Kenntnis bringt. Um dieses Ziel zu erreichen, mußte der
Verffcser manches opfern, so die Wiedergabi: zahlreicher vollendeter
Werke des Kunstlers, die den Umfang zu sehr erweitert hatte. Aus diesem
Grunde hat auch der Verfasser die ihm von den Erben zur Verfügung
gestellte Familienchronik so ausgiebig benutzt. Diese Chronik, im Jahre
1827 begonnen durch den Vater des Künstlers, Wenzel Führich, zeigt
uns eine Familie von Handwerkern, die sich durch Generationen immer
veredelt, bis sie in dem genialen Kunstler ihre Höhe erreicht. Der Knabe
Führich hütete die Kühe, aus Freude am Hirtenleben Da entwickelte sich
seine feine Empfindung für die landschaftliche Schönheit der Natur; da
beobachtete er auch dasTicrleben, das wir so oft in seinen Kompositionen
in echt deutscher, gemütlicher Weise verwendet finden. Der Vater, dem
Führich bei seinen Arbeiten half, war Maler, doch noch in handwerklicher
Art; der Sohn malte Engelköpfe auf die Wiegen, die Symbole des Todes
auf die Särge. So bildete die Volkskunst, aus der so viele Große hervor-
gegangen sind, die Stufe für die hohe religiöse Kunst, zu der Fuhrich sich
erhob; die aber vielleicht gerade wegen dieser Vorschule immer bei aller
Gedankentiefe volkstümlich blieb. Es folgt die Übersiedlung nach Prag
im Jahre 1819. Die Akademie gab Führich jene Schulung, deren er be-
durfte. Sie gab sie ihm allerdings in der Form, die sie selbst für die beste
hielt, von der sich der Meister später befreite. Den Anlaß dazu gab be-
kanntlich die Bekanntschaft mit Dürer; Fuhrich fielen zufällig eine Anzahl
seiner Holzschnitte in die Hände. Der Moment war für Führich ent-
scheidend; er erkannte die Seelenverwandtschaft mit dem alten Meister,
der nun sein Führer wurde. Wie eine Erlösung erkannte er, daß Phantasie
und Gedankenreichtum keine Fehler seien. Gleichwie Dürer ist Fuhrich
ein durch und durch deutscher Künstler. Durer Ist sein künstlerischer
Urahn, er ist nicht dessen Nachahmer, sondern sein Fortsetzer mit den
Mitteln und den Anschauungen seiner gegenwärtigen Zeit. Das ist es
auch, was Führich hauptsachlich von den Nazarenern unterscheidet; bei
diesen steigt die Linie von den alten Italienern herab. Die Federzeichnung
»Christus am Kreuz« (Tafelband 6) gibt von dem Eindruck, den Dürer
auf Führich gemacht hatte, Zeugnis. Über die Prager Studienzeit bringt
Dreger manches Neue, wie er überhaupt aufs fleißigste forscht, und aus
den verschiedensten Quellen Lücken, die geblieben sind, ausfüllt. Immer
seinem Plan folgend, den ganzen Mann und Künstler uns vorzuführen,
teilt Dreger die bekannte Selbstbiographie Führichs, die bis zum Jahre
1S44 reicht, vollständig mit. Man muß ihm dafür dankbar sein. Sie war
kaum mehr bekannt und nur mehr in den Bibliotheken zu finden. Diese
Biographie ist zugleich ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Kunst
im XIX. Jahrhundert überhaupt. In Rom kam Führich mit jenen Mannern
in Berührung, die es sich zur Aufgabe gestellt hatten, die religiöse Kunst
zu neuem Leben zu erwecken. Ihre Bestrebungen waren Führich sym-
pathisch, doch wurde er nie von den Nazarenern abhängig. Das wichtigste
Ereignis des römischen Aufenthalts war Fuhrichs Teilnahme an der Aus-
malung des Casino Massimo; die von Overbeck begonnenen Tassofresken
wurden durch Führich vollendet. Er trat in die Reihe dieser Künstler als
selbständiger ebenbürtiger Mitarbeiter ein. Dreger widmet diesen be-
rühmten, aber wenig gekannten Fresken eine eingehende Studie. Im
Tafelband bringt er soviel Material, daß man sich vom Ganzen doch
einen Begriff machen kann, wenn es auch nicht möglich war, an Ort und
Stelle Photographien aufzunehmen. In diesen Fresken bewies Führich, daß
er ebensogut ein Maler des monumentalen Stiles hätte werden können
wie Glucklichere vor ihm, wenn er genügende Aufträge gehabt
hätte. Die Selbstbiographie erzählt noch Führichs Übersiedlung nach
Wien, seine Anstellung an der Lambergischen Galeric, dann seine Er-
nennung zum Professor an einer Meisterschule. Dreger nimmt den Faden,
der im Jahre 1844 abbricht, wieder auf. Er hat auf Grund eingehender
Studien und auf Mitteilungen noch lebender Schüler gestützt, ein an-
schauliches Bild von der Tätigkeit Fuhrichs als Lehrer gegeben. Dreger
macht uns auch mit jenen damals in Wien lebenden Persönlichkeiten
bekannt, die eine Wiedererweckung des christlichen Geistes in Wien
erstrebten. Eine Bewegung, die zwar schon vor Fuhrichs Eintreffen in
Wien ihren Anfang genommen hatte, die aber fortgeführt wurde und der
Führich sehr sympathisch gegenüberstand. In dem Kreise dieser Freunde
die ein bisher noch wenig gekanntes Element der Kaiser Franz-Zeit bildeten,
fand Fuhrich auch als Künstler warme Anerkennung. Dreger geht auch
nicht der Schilderung jener Hindernisse und Störungen aus dem Wege,
die Führichs künstlerische Kraft zeitweise erlahmen ließen, die seine
Stimmung trübten und ihn manchmal tief niederdrückten. Der Auftrag
Der Schluß des fortlaufenden Textes besteht in einer Würdigung
von Remhrandts Künstlerschaft und Menschentum.
Dann folgt eine ausgezeichnete Bibliographie, die wesentlich dazu
beitragt, Hinds Buch so außerordentlich wertvoll zu machen. Die
Zusammenstellung der Publikationen, die Drucke von Originalplatten
Rembrandts enthalten, sei besonders hervorgehoben. In dem Abschnitt,
der die Literatur über die Zeichnungen anfühlt, fehlen die von Franz
Wickhoff herausgegebenen Wiener Seminarstudien: »Einige Zeichnungen
Rembrandts mit biblischen Vorwürfen« (Innsbruck, Wagner, 1906). Das
kleine Heft verdient um seines vortrefflichen Inhaltes willen Beachtung.
Der Bibliographie endlich schließt sich das chronologische Ver-
zeichnis an. Es nimmt verhältnismäßig wenig Raum ein. da die Abbil-
dungen des zweiten Bandes die Beschreibungen der Gegenstände
überflussig gemacht haben. Die Abbildungen sind 330 an der Zahl.
Selbstverständlich sind mehrere Radierungen in verschiedenen Zuständen
wiedergegeben. Vollständig, wie der Titel verspricht, sind die Abbil-
dungen aber nicht. Es sind nämlich nicht alle von Hind als echt
anerkannten 289 Radierungen wiedergegeben. Der »English sense of
decorum«, von dem Hind einmal spricht, hat es nicht zugelassen, daß
die Nummern 45 (Der pissende Mann), 46 (Die pissende Frau), 118
(Joseph und Pctiphars Weib), 207 (Der schlafende Hirt), 223 (Le lit ä la
Francaise), 224 (Der Mönch im Kornfeld) wiedergegeben wurden.
Daß Hind auch mit der modernen Kunst vertraut ist und sie in
seiner Darstellung häufig zu verdeutlichenden Parallelen heranzieht,
erhöht den Reiz des Buches.
Der gewaltigen und gediegenen Arbeit, die in dem vorliegenden
Werke von dem Verfasser der Kurzen Geschichte des Kupferstiches und
des Kataloges der italienischen Stiche des Britischen Museums geleistet
worden ist, kann nur der höchste Respekt gezollt werden. A. W.
Moriz Dreger, Josef Führich. Wien, Artaria. 1912.
In der Reihe der Monographien österreichischer Künstler, die das
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht herauszugeben begonnen hat,
ist dies die dritte Publikation. Auf Segantini und Rudolf Alt folgte Josef
Führich. Das Werk besteht aus einem Textband, der auch farbige Dar-
stellungen enthält, und einem Tafelband, der eine Auswahl faksimilierter
Handzeichnungen Führichs, dann aber auch Reproduktionen der ausge-
zeichnetsten Werke des Meisters umfaßt, so zum Beispiel die beiden vor-
züglichen Werke: Marias Gang über das Gebirge, und der Gang nach
Gethsemane, in Heliogravüren. Den geschmackvollen, schlichten Einband
schmückt das Kunstlerzeichen Führichs, es trägt den Charakter der alten
Hausmarken und Steinmetzzeichen; da es vom Vater ererbt ist, so weist
es auf die Wurzeln volkstümlicher Kunst hin, aus denen Führich hervor-
gewachsen ist. Der Verfasser wollte nicht bloß eine Lebensgeschichte
Führichs schreiben, sondern vielmehr uns in das Verständnis eines
Künstlers einführen, dessen Erinnerung der Gegenwart schon vielfach
entschwunden ist. Um einen Meister wie Führich zu begreifen, mußte
der Verfasser einen Standpunkt einnehmen, von dem aus er die zeit-
geschichtlichen und kirchlichen Strömungen überblickt, welche die Periode
vorbereiteten, in der der Künstler lebte; er mußte aber auch den vor-
ahnenden Geist besitzen, der die Wirkung Führichs auf die Zukunft
erfaßt. Das ist ja die wichtigste Aufgabe des Biographen, daß er die ge-
bundene Kraft, die in den halb vergessenen Werken Hegt, wieder zum
strahlen bringt und so mit den Schätzen der Vergangenheit die Gegenwart
bereichert. Diesen Plan, den Kunstler sozusagen aus der Zeit- und
Lokalgeschichte herauszulösen und du allgemeinen Kunst- und Kultur-
geschichte einzuordnen, hat der Verfasser streng durchgeführt und sich
davon, namentlich bei der Auswahl der Textillustrationen und der Tafeln,
leiten lassen. Er hat deshalb den Jugendarbeiten Führichs, den Kompo-
sitionen aus der Zeit seines Akademiestudiums, in der noch Barocke und
Klassizismus herrschten, einen so großen Raum eingeräumt. Es sollte
eben eine streng wissenschaftliche Arbeit werden, die nicht nur das Bild
des Künstlers allein, sondern zugleich die Wandlungen, die sich in der
künstlerischen Anschauung und dem Unterricht an der Akademie voll-
zogen, zur Kenntnis bringt. Um dieses Ziel zu erreichen, mußte der
Verffcser manches opfern, so die Wiedergabi: zahlreicher vollendeter
Werke des Kunstlers, die den Umfang zu sehr erweitert hatte. Aus diesem
Grunde hat auch der Verfasser die ihm von den Erben zur Verfügung
gestellte Familienchronik so ausgiebig benutzt. Diese Chronik, im Jahre
1827 begonnen durch den Vater des Künstlers, Wenzel Führich, zeigt
uns eine Familie von Handwerkern, die sich durch Generationen immer
veredelt, bis sie in dem genialen Kunstler ihre Höhe erreicht. Der Knabe
Führich hütete die Kühe, aus Freude am Hirtenleben Da entwickelte sich
seine feine Empfindung für die landschaftliche Schönheit der Natur; da
beobachtete er auch dasTicrleben, das wir so oft in seinen Kompositionen
in echt deutscher, gemütlicher Weise verwendet finden. Der Vater, dem
Führich bei seinen Arbeiten half, war Maler, doch noch in handwerklicher
Art; der Sohn malte Engelköpfe auf die Wiegen, die Symbole des Todes
auf die Särge. So bildete die Volkskunst, aus der so viele Große hervor-
gegangen sind, die Stufe für die hohe religiöse Kunst, zu der Fuhrich sich
erhob; die aber vielleicht gerade wegen dieser Vorschule immer bei aller
Gedankentiefe volkstümlich blieb. Es folgt die Übersiedlung nach Prag
im Jahre 1819. Die Akademie gab Führich jene Schulung, deren er be-
durfte. Sie gab sie ihm allerdings in der Form, die sie selbst für die beste
hielt, von der sich der Meister später befreite. Den Anlaß dazu gab be-
kanntlich die Bekanntschaft mit Dürer; Fuhrich fielen zufällig eine Anzahl
seiner Holzschnitte in die Hände. Der Moment war für Führich ent-
scheidend; er erkannte die Seelenverwandtschaft mit dem alten Meister,
der nun sein Führer wurde. Wie eine Erlösung erkannte er, daß Phantasie
und Gedankenreichtum keine Fehler seien. Gleichwie Dürer ist Fuhrich
ein durch und durch deutscher Künstler. Durer Ist sein künstlerischer
Urahn, er ist nicht dessen Nachahmer, sondern sein Fortsetzer mit den
Mitteln und den Anschauungen seiner gegenwärtigen Zeit. Das ist es
auch, was Führich hauptsachlich von den Nazarenern unterscheidet; bei
diesen steigt die Linie von den alten Italienern herab. Die Federzeichnung
»Christus am Kreuz« (Tafelband 6) gibt von dem Eindruck, den Dürer
auf Führich gemacht hatte, Zeugnis. Über die Prager Studienzeit bringt
Dreger manches Neue, wie er überhaupt aufs fleißigste forscht, und aus
den verschiedensten Quellen Lücken, die geblieben sind, ausfüllt. Immer
seinem Plan folgend, den ganzen Mann und Künstler uns vorzuführen,
teilt Dreger die bekannte Selbstbiographie Führichs, die bis zum Jahre
1S44 reicht, vollständig mit. Man muß ihm dafür dankbar sein. Sie war
kaum mehr bekannt und nur mehr in den Bibliotheken zu finden. Diese
Biographie ist zugleich ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Kunst
im XIX. Jahrhundert überhaupt. In Rom kam Führich mit jenen Mannern
in Berührung, die es sich zur Aufgabe gestellt hatten, die religiöse Kunst
zu neuem Leben zu erwecken. Ihre Bestrebungen waren Führich sym-
pathisch, doch wurde er nie von den Nazarenern abhängig. Das wichtigste
Ereignis des römischen Aufenthalts war Fuhrichs Teilnahme an der Aus-
malung des Casino Massimo; die von Overbeck begonnenen Tassofresken
wurden durch Führich vollendet. Er trat in die Reihe dieser Künstler als
selbständiger ebenbürtiger Mitarbeiter ein. Dreger widmet diesen be-
rühmten, aber wenig gekannten Fresken eine eingehende Studie. Im
Tafelband bringt er soviel Material, daß man sich vom Ganzen doch
einen Begriff machen kann, wenn es auch nicht möglich war, an Ort und
Stelle Photographien aufzunehmen. In diesen Fresken bewies Führich, daß
er ebensogut ein Maler des monumentalen Stiles hätte werden können
wie Glucklichere vor ihm, wenn er genügende Aufträge gehabt
hätte. Die Selbstbiographie erzählt noch Führichs Übersiedlung nach
Wien, seine Anstellung an der Lambergischen Galeric, dann seine Er-
nennung zum Professor an einer Meisterschule. Dreger nimmt den Faden,
der im Jahre 1844 abbricht, wieder auf. Er hat auf Grund eingehender
Studien und auf Mitteilungen noch lebender Schüler gestützt, ein an-
schauliches Bild von der Tätigkeit Fuhrichs als Lehrer gegeben. Dreger
macht uns auch mit jenen damals in Wien lebenden Persönlichkeiten
bekannt, die eine Wiedererweckung des christlichen Geistes in Wien
erstrebten. Eine Bewegung, die zwar schon vor Fuhrichs Eintreffen in
Wien ihren Anfang genommen hatte, die aber fortgeführt wurde und der
Führich sehr sympathisch gegenüberstand. In dem Kreise dieser Freunde
die ein bisher noch wenig gekanntes Element der Kaiser Franz-Zeit bildeten,
fand Fuhrich auch als Künstler warme Anerkennung. Dreger geht auch
nicht der Schilderung jener Hindernisse und Störungen aus dem Wege,
die Führichs künstlerische Kraft zeitweise erlahmen ließen, die seine
Stimmung trübten und ihn manchmal tief niederdrückten. Der Auftrag