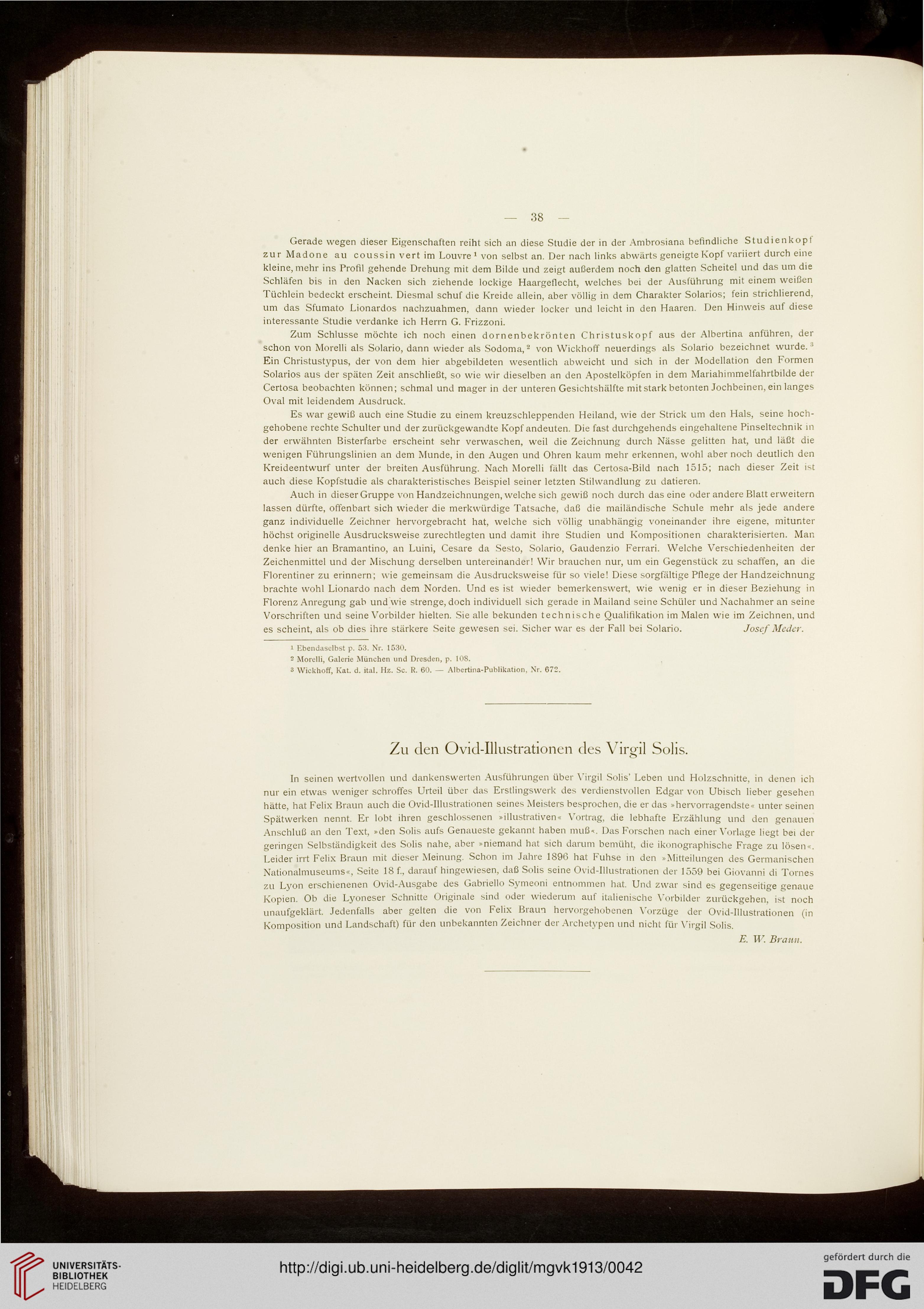— 38
Gerade wegen dieser Eigenschaften reiht sich an diese Studie der in der Ambrosiana befindliche Studienkopt
zur Madone au coussin vert im Louvre ' von selbst an. Der nach links abwärts geneigte Kopf variiert durch eine
kleine, mehr ins Profil gehende Drehung mit dem Bilde und zeigt außerdem noch den glatten Scheitel und das um die
Schläfen bis in den Nacken sich ziehende lockige Haargeflecht, welches bei der Ausführung mit einem weißen
Tüchlein bedeckt erscheint. Diesmal schuf die Kreide allein, aber völlig in dem Charakter Solarios; fein strichlierend,
um das Sfumato Lionardos nachzuahmen, dann wieder locker und leicht in den Haaren. Den Hinweis auf diese
interessante Studie verdanke ich Herrn G. Frizzoni.
Zum Schlüsse möchte ich noch einen dornenbekrönten Christuskopf aus der Albertina anführen, der
schon von Morelli als Solario, dann wieder als Sodoma,2 von Wickhoff neuerdings als Solario bezeichnet wurde.;1
Ein Christustypus, der von dem hier abgebildeten wesentlich abweicht und sich in der Modellation den Formen
Solarios aus der späten Zeit anschließt, so wie wir dieselben an den Apostelköpfen in dem Mariahimmelfahrtbilde der
Certosa beobachten können; schmal und mager in der unteren Gesichtshälfte mit stark betonten Jochbeinen, ein langes
Oval mit leidendem Ausdruck.
Es war gewiß auch eine Studie zu einem kreuzschleppenden Heiland, wie der Strick um den Hals, seine hoch-
gehobene rechte Schulter und der zurückgewandte Kopf andeuten. Die fast durchgehends eingehaltene Pinseltechnik in
der erwähnten Bisterfarbe erscheint sehr verwaschen, weil die Zeichnung durch Nässe gelitten hat, und läßt die
wenigen Führungslinien an dem Munde, in den Augen und Ohren kaum mehr erkennen, wohl aber noch deutlich den
Kreideentwurf unter der breiten Ausführung. Nach Morelli fällt das Certosa-Bild nach 1515; nach dieser Zeit i-*t
auch diese Kopfstudie als charakteristisches Beispiel seiner letzten Stilwandlung zu datieren.
Auch in dieser Gruppe von Handzeichnungen, welche sich gewiß noch durch das eine oder andere Blatt erweitern
lassen dürfte, offenbart sich wieder die merkwürdige Tatsache, daß die mailändische Schule mehr als jede andere
ganz individuelle Zeichner hervorgebracht hat, welche sich völlig unabhängig voneinander ihre eigene, mitunter
höchst originelle Ausdrucksweise zurechtlegten und damit ihre Studien und Kompositionen charakterisierten. Man
denke hier an Bramantino, an Luini, Cesare da Sesto, Solario, Gaudenzio Ferrari. Welche Verschiedenheiten der
Zeichenmittel und der Mischung derselben untereinander! Wir brauchen nur, um ein Gegenstück zu schaffen, an die
Florentiner zu erinnern; wie gemeinsam die Ausdrucksweise für so viele! Diese sorgfältige Pflege der Handzeichnung
brachte wohl Lionardo nach dem Norden. Und es ist wieder bemerkenswert, wie wenig er in dieser Beziehung in
Florenz Anregung gab und wie strenge, doch individuell sich gerade in Mailand seine Schüler und Nachahmer an seine
Vorschriften und seine Vorbilder hielten. Sie alle bekunden technische Qualifikation im Malen wie im Zeichnen, und
es scheint, als ob dies ihre stärkere Seite gewesen sei. Sicher war es der Fall bei Solario. Josef Meder.
i Ebendaselbst p. 53. Nr. 1530.
- Morelli, Galerie München und Dresden, p. 108.
3 Wickhoff, Kat. d. ital. Hz. Sc. R. 60. — Albertina-Publikation, Nr. 672.
Zu den Ovid-Ulustrationen des Virgil Solis.
In seinen wertvollen und dankenswerten Ausführungen über Virgil Solis' Leben und Holzschnitte, in denen ich
nur ein etwas weniger schroffes Urteil über das Erstlingswerk des verdienstvollen Edgar von Ubisch lieber gesehen
hätte, hat Felix Braun auch die Ovid-Illustrationen seines Meisters besprochen, die er das »hervorragendste« unter seinen
Spätwerken nennt. Er lobt ihren geschlossenen »illustrativen« Vortrag, die lebhafte Erzählung und den genauen
Anschluß an den Text, »den Solis aufs Genaueste gekannt haben muß-<. Das Forschen nach einer Vorlage liegt bei der
geringen Selbständigkeit des Solis nahe, aber »niemand hat sich darum bemüht, die ikonographische Frage zu lösen«.
Leider irrt Felix Braun mit dieser Meinung. Schon im Jahre 1S96 hat Fuhse in den »Mitteilungen des Germanischen
Nationalmuseums«, Seite 18 f., darauf hingewiesen, daß Solis seine Ovid-Illustrationen der 1559 bei Giovanni di Tornes
zu Lyon erschienenen Ovid-Ausgabe des Gabriello Symeoni entnommen hat. Und zwar sind es gegenseitige genaue
Kopien. Ob die Lyoneser Schnitte Originale sind oder wiederum auf italienische Vorbilder zurückgehen, ist noch
unaufgeklärt. Jedenfalls aber gelten die von Felix Braun hervorgehobenen Wirzüge der Ovid-Illustrationen (in
Komposition und Landschaft) für den unbekannten Zeichner der Archetypen und nicht für Virgil Solis.
E. W. Braun.
Gerade wegen dieser Eigenschaften reiht sich an diese Studie der in der Ambrosiana befindliche Studienkopt
zur Madone au coussin vert im Louvre ' von selbst an. Der nach links abwärts geneigte Kopf variiert durch eine
kleine, mehr ins Profil gehende Drehung mit dem Bilde und zeigt außerdem noch den glatten Scheitel und das um die
Schläfen bis in den Nacken sich ziehende lockige Haargeflecht, welches bei der Ausführung mit einem weißen
Tüchlein bedeckt erscheint. Diesmal schuf die Kreide allein, aber völlig in dem Charakter Solarios; fein strichlierend,
um das Sfumato Lionardos nachzuahmen, dann wieder locker und leicht in den Haaren. Den Hinweis auf diese
interessante Studie verdanke ich Herrn G. Frizzoni.
Zum Schlüsse möchte ich noch einen dornenbekrönten Christuskopf aus der Albertina anführen, der
schon von Morelli als Solario, dann wieder als Sodoma,2 von Wickhoff neuerdings als Solario bezeichnet wurde.;1
Ein Christustypus, der von dem hier abgebildeten wesentlich abweicht und sich in der Modellation den Formen
Solarios aus der späten Zeit anschließt, so wie wir dieselben an den Apostelköpfen in dem Mariahimmelfahrtbilde der
Certosa beobachten können; schmal und mager in der unteren Gesichtshälfte mit stark betonten Jochbeinen, ein langes
Oval mit leidendem Ausdruck.
Es war gewiß auch eine Studie zu einem kreuzschleppenden Heiland, wie der Strick um den Hals, seine hoch-
gehobene rechte Schulter und der zurückgewandte Kopf andeuten. Die fast durchgehends eingehaltene Pinseltechnik in
der erwähnten Bisterfarbe erscheint sehr verwaschen, weil die Zeichnung durch Nässe gelitten hat, und läßt die
wenigen Führungslinien an dem Munde, in den Augen und Ohren kaum mehr erkennen, wohl aber noch deutlich den
Kreideentwurf unter der breiten Ausführung. Nach Morelli fällt das Certosa-Bild nach 1515; nach dieser Zeit i-*t
auch diese Kopfstudie als charakteristisches Beispiel seiner letzten Stilwandlung zu datieren.
Auch in dieser Gruppe von Handzeichnungen, welche sich gewiß noch durch das eine oder andere Blatt erweitern
lassen dürfte, offenbart sich wieder die merkwürdige Tatsache, daß die mailändische Schule mehr als jede andere
ganz individuelle Zeichner hervorgebracht hat, welche sich völlig unabhängig voneinander ihre eigene, mitunter
höchst originelle Ausdrucksweise zurechtlegten und damit ihre Studien und Kompositionen charakterisierten. Man
denke hier an Bramantino, an Luini, Cesare da Sesto, Solario, Gaudenzio Ferrari. Welche Verschiedenheiten der
Zeichenmittel und der Mischung derselben untereinander! Wir brauchen nur, um ein Gegenstück zu schaffen, an die
Florentiner zu erinnern; wie gemeinsam die Ausdrucksweise für so viele! Diese sorgfältige Pflege der Handzeichnung
brachte wohl Lionardo nach dem Norden. Und es ist wieder bemerkenswert, wie wenig er in dieser Beziehung in
Florenz Anregung gab und wie strenge, doch individuell sich gerade in Mailand seine Schüler und Nachahmer an seine
Vorschriften und seine Vorbilder hielten. Sie alle bekunden technische Qualifikation im Malen wie im Zeichnen, und
es scheint, als ob dies ihre stärkere Seite gewesen sei. Sicher war es der Fall bei Solario. Josef Meder.
i Ebendaselbst p. 53. Nr. 1530.
- Morelli, Galerie München und Dresden, p. 108.
3 Wickhoff, Kat. d. ital. Hz. Sc. R. 60. — Albertina-Publikation, Nr. 672.
Zu den Ovid-Ulustrationen des Virgil Solis.
In seinen wertvollen und dankenswerten Ausführungen über Virgil Solis' Leben und Holzschnitte, in denen ich
nur ein etwas weniger schroffes Urteil über das Erstlingswerk des verdienstvollen Edgar von Ubisch lieber gesehen
hätte, hat Felix Braun auch die Ovid-Illustrationen seines Meisters besprochen, die er das »hervorragendste« unter seinen
Spätwerken nennt. Er lobt ihren geschlossenen »illustrativen« Vortrag, die lebhafte Erzählung und den genauen
Anschluß an den Text, »den Solis aufs Genaueste gekannt haben muß-<. Das Forschen nach einer Vorlage liegt bei der
geringen Selbständigkeit des Solis nahe, aber »niemand hat sich darum bemüht, die ikonographische Frage zu lösen«.
Leider irrt Felix Braun mit dieser Meinung. Schon im Jahre 1S96 hat Fuhse in den »Mitteilungen des Germanischen
Nationalmuseums«, Seite 18 f., darauf hingewiesen, daß Solis seine Ovid-Illustrationen der 1559 bei Giovanni di Tornes
zu Lyon erschienenen Ovid-Ausgabe des Gabriello Symeoni entnommen hat. Und zwar sind es gegenseitige genaue
Kopien. Ob die Lyoneser Schnitte Originale sind oder wiederum auf italienische Vorbilder zurückgehen, ist noch
unaufgeklärt. Jedenfalls aber gelten die von Felix Braun hervorgehobenen Wirzüge der Ovid-Illustrationen (in
Komposition und Landschaft) für den unbekannten Zeichner der Archetypen und nicht für Virgil Solis.
E. W. Braun.