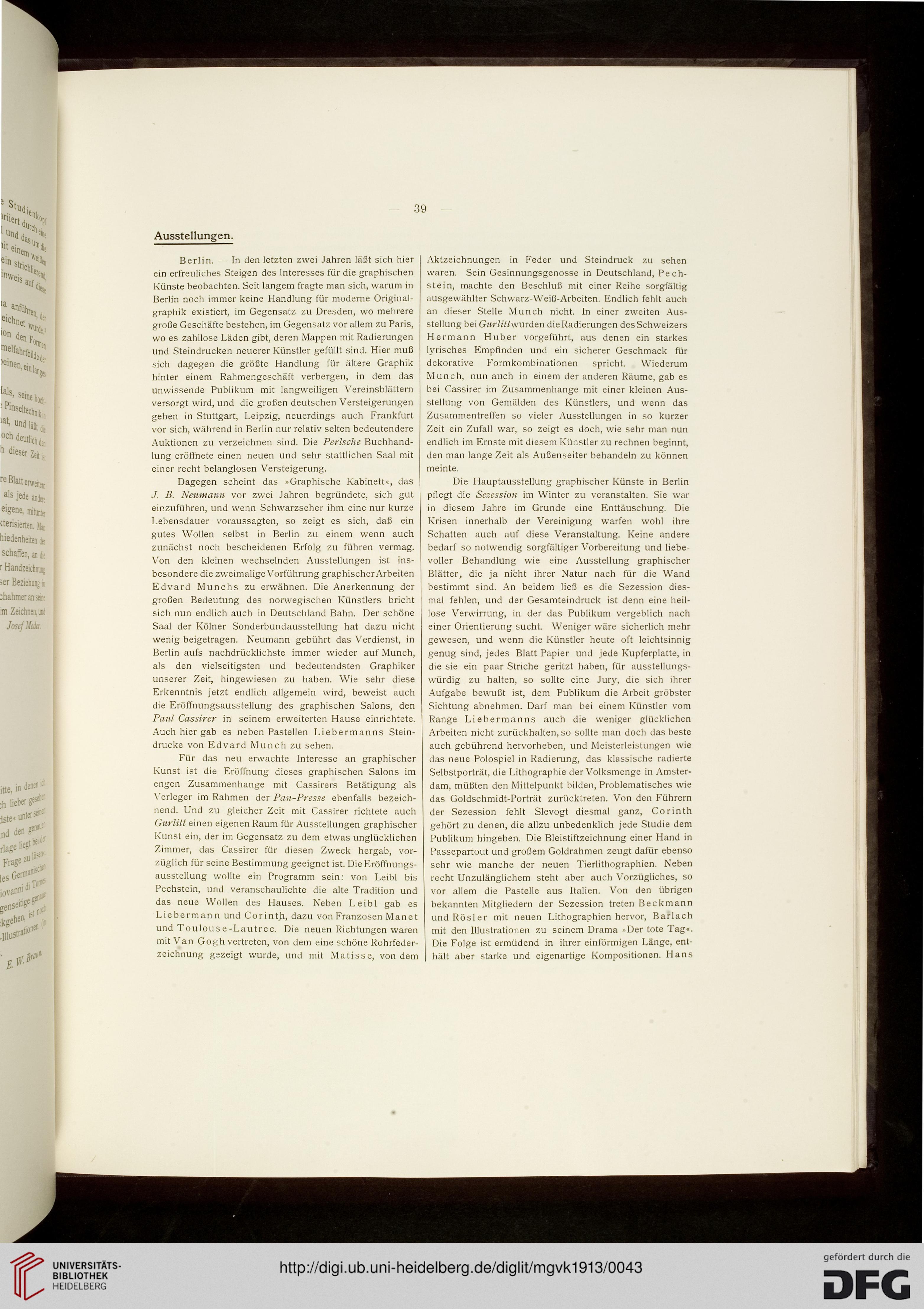"yp-/"r:. ■ ;.'jr'~<::> ..
■=>tUrf:
39
Ausstellungen.
Berlin. — In den letzten zwei Jahren läßt sich hier
ein erfreuliches Steigen des Interesses für die graphischen
Künste beobachten. Seit langem fragte man sich, warum in
Berlin noch immer keine Handlung für moderne Original-
graphik existiert, im Gegensatz zu Dresden, wo mehrere
große Geschäfte bestehen, im Gegensatz vor allem zu Paris,
wo es zahllose Läden gibt, deren Mappen mit Radierungen
und Steindrucken neuerer Künstler gefüllt sind. Hier muß
sich dagegen die größte Handlung für ältere Graphik
hinter einem Rahmengeschäft verbergen, in dem das
unwissende Publikum mit langweiligen Yereinsblättern
versorgt wird, und die großen deutschen Versteigerungen
gehen in Stuttgart, Leipzig, neuerdings auch Frankfurt
vor sich, während in Berlin nur relativ selten bedeutendere
Auktionen zu verzeichnen sind. Die Perlsclie Buchhand-
lung eröffnete einen neuen und sehr stattlichen Saal mit
einer recht belanglosen Versteigerung.
Dagegen scheint das »Graphische Kabinett«, das
J. B. Neumann vor zwei Jahren begründete, sich gut
einzuführen, und wenn Schwarzseher ihm eine nur kurze
Lebensdauer voraussagten, so zeigt es sich, daß ein
gutes Wollen selbst in Berlin zu einem wenn auch
zunächst noch bescheidenen Erfolg zu führen vermag.
Von den kleinen wechselnden Ausstellungen ist ins-
besondere die zweimalige Vorführung graphischer Arbeiten
Edvard Munchs zu erwähnen. Die Anerkennung der
großen Bedeutung des norwegischen Künstlers bricht
sich nun endlich auch in Deutschland Bahn. Der schöne
Saal der Kölner Sonderbundausstellung hat dazu nicht
wenig beigetragen. Neumann gebührt das Verdienst, in
Berlin aufs nachdrücklichste immer wieder auf Munch,
als den vielseitigsten und bedeutendsten Graphiker
unserer Zeit, hingewiesen zu haben. Wie sehr diese
Erkenntnis jetzt endlich allgemein wird, beweist auch
die Eröffnungsausstellung des graphischen Salons, den
Paul Cassirer in seinem erweiterten Hause einrichtete.
Auch hier gab es neben Pastellen Liebermanns Stein-
drucke von Edvard Munch zu sehen.
Für das neu erwachte Interesse an graphischer
Kunst ist die Eröffnung dieses graphischen Salons im
engen Zusammenhange mit Cassirers Betätigung als
Verleger im Rahmen der Pan-Presse ebenfalls bezeich-
nend. Und zu gleicher Zeit mit Cassirer richtete auch
Gurlitt einen eigenen Raum für Ausstellungen graphischer
Kunst ein, der im Gegensatz zu dem etwas unglücklichen
Zimmer, das Cassirer für diesen Zweck hergab, vor-
züglich für seine Bestimmung geeignet ist. Die Eröffnungs-
ausstellung wollte ein Programm sein: von Leibl bis
Pechstein, und veranschaulichte die alte Tradition und
das neue Wollen des Hauses. Neben Leibl gab es
Liebermann und Corinth, dazu von Franzosen Manet
und Toulouse-Lautrec. Die neuen Richtungen waren
mit Van Gogh vertreten, von dem eine schöne Rohrfeder-
zeichnung gezeigt wurde, und mit Matisse, von dem
Aktzeichnungen in Feder und Steindruck zu sehen
waren. Sein Gesinnungsgenosse in Deutschland, Pech-
stein, machte den Beschluß mit einer Reihe sorgfältig
ausgewählter Schwarz-Weiß-Arbeiten. Endlich fehlt auch
an dieser Stelle Munch nicht. In einer zweiten Aus-
stellung bei Gurlittwurden die Radierungen des Schweizers
Hermann Huber vorgeführt, aus denen ein starkes
lyrisches Empfinden und ein sicherer Geschmack für
dekorative Formkombinationen spricht. Wiederum
Munch, nun auch in einem der anderen Räume, gab es
bei Cassirer im Zusammenhange mit einer kleinen Aus-
stellung von Gemälden des Künstlers, und wenn das
Zusammentreffen so vieler Ausstellungen in so kurzer
Zeit ein Zufall war, so zeigt es doch, wie sehr man nun
endlich im Ernste mit diesem Künstler zu rechnen beginnt,
den man lange Zeit als Außenseiter behandeln zu können
meinte.
Die Hauptausstellung graphischer Künste in Berlin
pflegt die Sezession im Winter zu veranstalten. Sie war
in diesem Jahre im Grunde eine Enttäuschung. Die
Krisen innerhalb der Vereinigung warfen wohl ihre
Schatten auch auf diese Veranstaltung. Keine andere
bedarf so notwendig sorgfältiger Vorbereitung und liebe-
voller Behandlung wie eine Ausstellung graphischer
Blätter, die ja nicht ihrer Natur nach für die Wand
bestimmt sind. An beidem ließ es die Sezession dies-
mal fehlen, und der Gesamteindruck ist denn eine heil-
lose Verwirrung, in der das Publikum vergeblich nach
einer Orientierung sucht. Weniger wäre sicherlich mehr
gewesen, und wenn die Künstler heute oft leichtsinnig
genug sind, jedes Blatt Papier und jede Kupferplatte, in
die sie ein paar Striche geritzt haben, für ausstellungs-
würdig zu halten, so sollte eine Jury, die sich ihrer
Aufgabe bewußt ist, dem Publikum die Arbeit gröbster
Sichtung abnehmen. Darf man bei einem Künstler vom
Range Liebermanns auch die weniger glücklichen
Arbeiten nicht zurückhalten, so sollte man doch das beste
auch gebührend hervorheben, und Meisterleistungen wie
das neue Polospiel in Radierung, das klassische radierte
Selbstporträt, die Lithographie der Volksmenge in Amster-
dam, müßten den Mittelpunkt bilden, Problematisches wie
das Goldschmidt-Porträt zurücktreten. Von den Führern
der Sezession fehlt Slevogt diesmal ganz, Corinth
gehört zu denen, die allzu unbedenklich jede Studie dem
Publikum hingeben. Die Bleistiftzeichnung einer Hand in
Passepartout und großem Goldrahmen zeugt dafür ebenso
sehr wie manche der neuen Tierlithographien. Neben
recht Unzulänglichem steht aber auch Vorzügliches, so
vor allem die Pastelle aus Italien. Von den übrigen
bekannten Mitgliedern der Sezession treten Beckmann
undRösler mit neuen Lithographien hervor, Barlach
mit den Illustrationen zu seinem Drama »Der tote Tag«.
Die Folge ist ermüdend in ihrer einförmigen Länge, ent-
hält aber starke und eigenartige Kompositionen. Hans
■=>tUrf:
39
Ausstellungen.
Berlin. — In den letzten zwei Jahren läßt sich hier
ein erfreuliches Steigen des Interesses für die graphischen
Künste beobachten. Seit langem fragte man sich, warum in
Berlin noch immer keine Handlung für moderne Original-
graphik existiert, im Gegensatz zu Dresden, wo mehrere
große Geschäfte bestehen, im Gegensatz vor allem zu Paris,
wo es zahllose Läden gibt, deren Mappen mit Radierungen
und Steindrucken neuerer Künstler gefüllt sind. Hier muß
sich dagegen die größte Handlung für ältere Graphik
hinter einem Rahmengeschäft verbergen, in dem das
unwissende Publikum mit langweiligen Yereinsblättern
versorgt wird, und die großen deutschen Versteigerungen
gehen in Stuttgart, Leipzig, neuerdings auch Frankfurt
vor sich, während in Berlin nur relativ selten bedeutendere
Auktionen zu verzeichnen sind. Die Perlsclie Buchhand-
lung eröffnete einen neuen und sehr stattlichen Saal mit
einer recht belanglosen Versteigerung.
Dagegen scheint das »Graphische Kabinett«, das
J. B. Neumann vor zwei Jahren begründete, sich gut
einzuführen, und wenn Schwarzseher ihm eine nur kurze
Lebensdauer voraussagten, so zeigt es sich, daß ein
gutes Wollen selbst in Berlin zu einem wenn auch
zunächst noch bescheidenen Erfolg zu führen vermag.
Von den kleinen wechselnden Ausstellungen ist ins-
besondere die zweimalige Vorführung graphischer Arbeiten
Edvard Munchs zu erwähnen. Die Anerkennung der
großen Bedeutung des norwegischen Künstlers bricht
sich nun endlich auch in Deutschland Bahn. Der schöne
Saal der Kölner Sonderbundausstellung hat dazu nicht
wenig beigetragen. Neumann gebührt das Verdienst, in
Berlin aufs nachdrücklichste immer wieder auf Munch,
als den vielseitigsten und bedeutendsten Graphiker
unserer Zeit, hingewiesen zu haben. Wie sehr diese
Erkenntnis jetzt endlich allgemein wird, beweist auch
die Eröffnungsausstellung des graphischen Salons, den
Paul Cassirer in seinem erweiterten Hause einrichtete.
Auch hier gab es neben Pastellen Liebermanns Stein-
drucke von Edvard Munch zu sehen.
Für das neu erwachte Interesse an graphischer
Kunst ist die Eröffnung dieses graphischen Salons im
engen Zusammenhange mit Cassirers Betätigung als
Verleger im Rahmen der Pan-Presse ebenfalls bezeich-
nend. Und zu gleicher Zeit mit Cassirer richtete auch
Gurlitt einen eigenen Raum für Ausstellungen graphischer
Kunst ein, der im Gegensatz zu dem etwas unglücklichen
Zimmer, das Cassirer für diesen Zweck hergab, vor-
züglich für seine Bestimmung geeignet ist. Die Eröffnungs-
ausstellung wollte ein Programm sein: von Leibl bis
Pechstein, und veranschaulichte die alte Tradition und
das neue Wollen des Hauses. Neben Leibl gab es
Liebermann und Corinth, dazu von Franzosen Manet
und Toulouse-Lautrec. Die neuen Richtungen waren
mit Van Gogh vertreten, von dem eine schöne Rohrfeder-
zeichnung gezeigt wurde, und mit Matisse, von dem
Aktzeichnungen in Feder und Steindruck zu sehen
waren. Sein Gesinnungsgenosse in Deutschland, Pech-
stein, machte den Beschluß mit einer Reihe sorgfältig
ausgewählter Schwarz-Weiß-Arbeiten. Endlich fehlt auch
an dieser Stelle Munch nicht. In einer zweiten Aus-
stellung bei Gurlittwurden die Radierungen des Schweizers
Hermann Huber vorgeführt, aus denen ein starkes
lyrisches Empfinden und ein sicherer Geschmack für
dekorative Formkombinationen spricht. Wiederum
Munch, nun auch in einem der anderen Räume, gab es
bei Cassirer im Zusammenhange mit einer kleinen Aus-
stellung von Gemälden des Künstlers, und wenn das
Zusammentreffen so vieler Ausstellungen in so kurzer
Zeit ein Zufall war, so zeigt es doch, wie sehr man nun
endlich im Ernste mit diesem Künstler zu rechnen beginnt,
den man lange Zeit als Außenseiter behandeln zu können
meinte.
Die Hauptausstellung graphischer Künste in Berlin
pflegt die Sezession im Winter zu veranstalten. Sie war
in diesem Jahre im Grunde eine Enttäuschung. Die
Krisen innerhalb der Vereinigung warfen wohl ihre
Schatten auch auf diese Veranstaltung. Keine andere
bedarf so notwendig sorgfältiger Vorbereitung und liebe-
voller Behandlung wie eine Ausstellung graphischer
Blätter, die ja nicht ihrer Natur nach für die Wand
bestimmt sind. An beidem ließ es die Sezession dies-
mal fehlen, und der Gesamteindruck ist denn eine heil-
lose Verwirrung, in der das Publikum vergeblich nach
einer Orientierung sucht. Weniger wäre sicherlich mehr
gewesen, und wenn die Künstler heute oft leichtsinnig
genug sind, jedes Blatt Papier und jede Kupferplatte, in
die sie ein paar Striche geritzt haben, für ausstellungs-
würdig zu halten, so sollte eine Jury, die sich ihrer
Aufgabe bewußt ist, dem Publikum die Arbeit gröbster
Sichtung abnehmen. Darf man bei einem Künstler vom
Range Liebermanns auch die weniger glücklichen
Arbeiten nicht zurückhalten, so sollte man doch das beste
auch gebührend hervorheben, und Meisterleistungen wie
das neue Polospiel in Radierung, das klassische radierte
Selbstporträt, die Lithographie der Volksmenge in Amster-
dam, müßten den Mittelpunkt bilden, Problematisches wie
das Goldschmidt-Porträt zurücktreten. Von den Führern
der Sezession fehlt Slevogt diesmal ganz, Corinth
gehört zu denen, die allzu unbedenklich jede Studie dem
Publikum hingeben. Die Bleistiftzeichnung einer Hand in
Passepartout und großem Goldrahmen zeugt dafür ebenso
sehr wie manche der neuen Tierlithographien. Neben
recht Unzulänglichem steht aber auch Vorzügliches, so
vor allem die Pastelle aus Italien. Von den übrigen
bekannten Mitgliedern der Sezession treten Beckmann
undRösler mit neuen Lithographien hervor, Barlach
mit den Illustrationen zu seinem Drama »Der tote Tag«.
Die Folge ist ermüdend in ihrer einförmigen Länge, ent-
hält aber starke und eigenartige Kompositionen. Hans