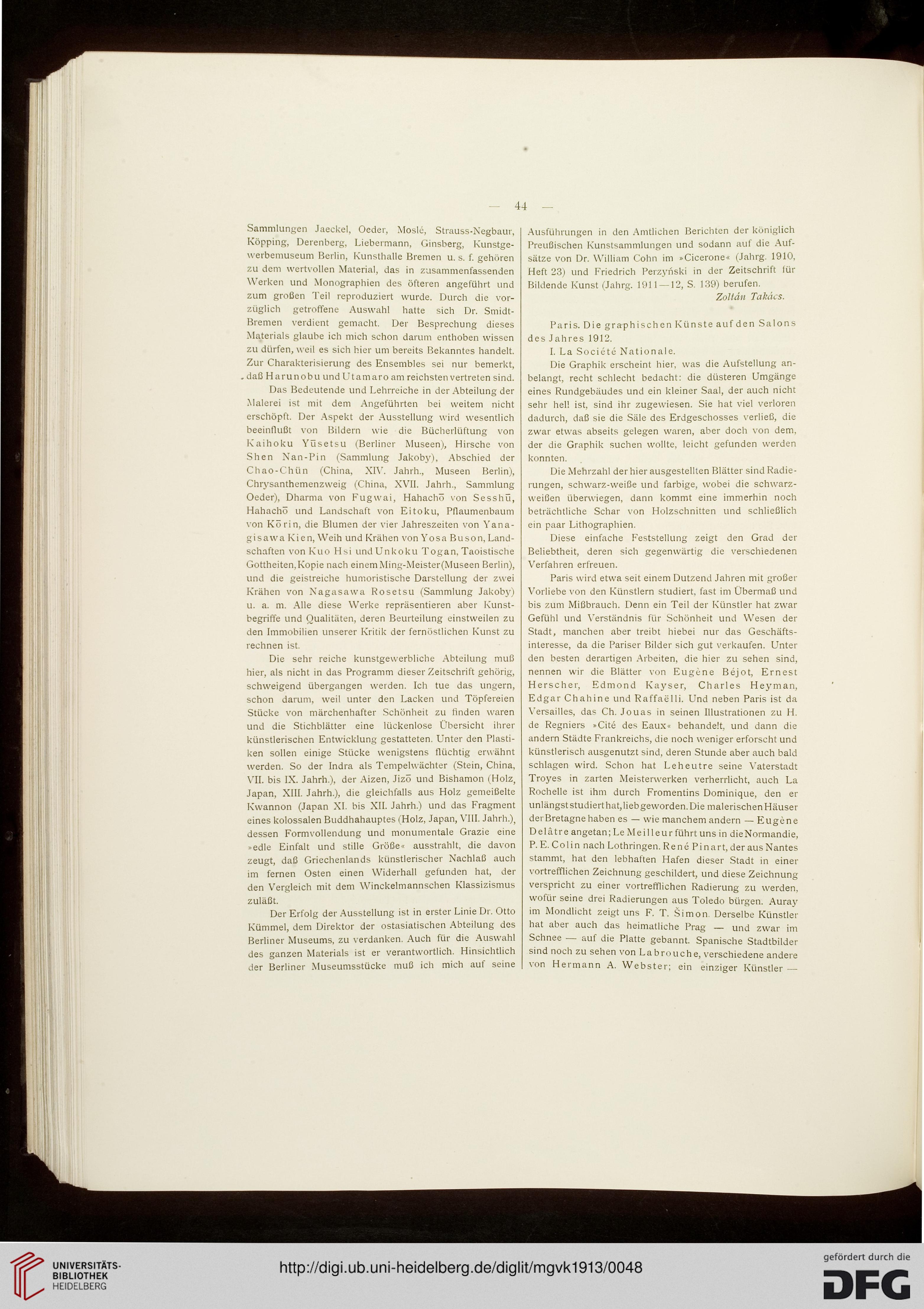44
Sammlungen Jaeckel, Oeder, Mosle, Strauss-Negbaur,
Köpping, Derenberg, Liebermann, Ginsberg, Kunstge-
werbemuseum Berlin, Kunsthalle Bremen u. s. f. gehören
zu dem wertvollen Material, das in zusammenfassenden
Werken und Monographien des öfteren angeführt und
zum großen Teil reproduziert wurde. Durch die vor-
züglich getroffene Auswahl hatte sich Dr. Smidt-
Bremen verdient gemacht. Der Besprechung dieses
Materials glaube ich mich schon darum enthoben wissen
zu dürfen, weil es sich hier um bereits Bekanntes handelt.
Zur Charakterisierung des Ensembles sei nur bemerkt,
. daß Harun obu undUtamaroam reichsten vertreten sind.
Das Bedeutende und Lehrreiche in der Abteilung der
Malerei ist mit dem Angeführten bei weitem nicht
erschöpft. Der Aspekt der Ausstellung wird wesentlich
beeinflußt von Bildern wie die Bücherlüftung von
Kaihoku Yüsetsu (Berliner Museen), Hirsche von
Shen Nan-Pin (Sammlung Jakoby), Abschied der
Chao-Chün (China, XIV. Jahrb.., Museen Berlin),
Chrysanthemenzweig (China, XVII. Jahrh., Sammlung
Oeder), Dharma von Fugwai, Hahachö von Sesshü,
Hahachö und Landschaft von Eitoku, Pflaumenbaum
von Körin, die Blumen der vier Jahreszeiten von Yana-
gisawa Kien, Weih und Krähen von Yosa Buson, Land-
schaften von Kuo Hsi und Unkoku Togan, Taoistische
Gottheiten,Kopie nach einem Ming-Meister(Museen Berlin),
und die geistreiche humoristische Darstellung der zwei
Krähen von Nagasawa Rosetsu (Sammlung Jakoby)
u. a. m. Alle diese Werke repräsentieren aber Kunst-
begriffe und Qualitäten, deren Beurteilung einstweilen zu
den Immobilien unserer Kritik der fernöstlichen Kunst zu
rechnen ist.
Die sehr reiche kunstgewerbliche Abteilung muß
hier, als nicht in das Programm dieser Zeitschrift gehörig,
schweigend übergangen werden. Ich tue das ungern,
schon darum, weil unter den Lacken und Töpfereien
Stücke von märchenhafter Schönheit zu finden waren
und die Stichblätter eine lückenlose Übersicht ihrer
künstlerischen Entwicklung gestatteten. Unter den Plasti-
ken sollen einige Stücke wenigstens flüchtig erwähnt
werden. So der Indra als Tempelwächter (Stein, China,
VII. bis IX. Jahrh.), der Aizen, Jizö und Bishamon (Holz,
Japan, XIII. Jahrh.), die gleichfalls aus Holz gemeißelte
Kwannon (Japan XI. bis XII. Jahrh.) und das Fragment
eines kolossalen Buddhahauptes (Holz, Japan, VIII. Jahrh.),
dessen Formvollendung und monumentale Grazie eine
»edle Einfalt und stille Größe« ausstrahlt, die davon
zeugt, daß Griechenlands künstlerischer Nachlaß auch
im fernen Osten einen Widerhall gefunden hat, der
den Vergleich mit dem Winckelmannschen Klassizismus
zuläßt.
Der Erfolg der Ausstellung ist in erster Linie Dr. Otto
Kümmel, dem Direktor der ostasiatischen Abteilung des
Berliner Museums, zu verdanken. Auch für die Auswahl
des ganzen Materials ist er verantwortlich. Hinsichtlich
der Berliner Museumsstücke muß ich mich auf seine
Ausführungen in den Amtlichen Berichten der königlich
Preußischen Kunstsammlungen und sodann auf die Auf-
sätze von Dr. William Cohn im »Cicerone« (Jahrg. 1910,
Heft 23) und Friedrich Perzynski in der Zeitschrift für
Bildende Kunst (Jahrg. 1911 — 12, S. 139) berufen.
Zoltdn Taliäcs.
Paris. Die graphischen Künste auf den Salons
des Jahres 1912.
I. La Societe Nationale.
Die Graphik erscheint hier, was die Aufstellung an-
belangt, recht schlecht bedacht: die düsteren Umgänge
eines Rundgebäudes und ein kleiner Saal, der auch nicht
sehr hell ist, sind ihr zugewiesen. Sie hat viel verloren
dadurch, daß sie die Säle des Erdgeschosses verließ, die
zwar etwas abseits gelegen waren, aber doch von dem,
der die Graphik suchen wollte, leicht gefunden werden
konnten.
Die Mehrzahl der hier ausgestellten Blätter sind Radie-
rungen, schwarz-weiße und farbige, wobei die schwarz-
weißen überwiegen, dann kommt eine immerhin noch
beträchtliche Schar von Holzschnitten und schließlich
ein paar Lithographien.
Diese einfache Feststellung zeigt den Grad der
Beliebtheit, deren sich gegenwärtig die verschiedenen
Verfahren erfreuen.
Paris wird etwa seit einem Dutzend Jahren mit großer
Vorliebe von den Künstlern studiert, fast im Übermaß und
bis zum Mißbrauch. Denn ein Teil der Künstler hat zwar
Gefühl und Verständnis für Schönheit und Wesen der
Stadt, manchen aber treibt hiebei nur das Geschäfts-
interesse, da die Pariser Bilder sich gut verkaufen. Unter
den besten derartigen Arbeiten, die hier zu sehen sind,
nennen wir die Blätter von Eugene Bejot, Ernest
Herscher, Edmond Kayser, Charles Heyman,
Edgar Chahine und Raffaelli. Und neben Paris ist da
Versailles, das Ch. Jouas in seinen Illustrationen zu H.
de Regniers »Cite des Eaux« behandelt, und dann die
andern Städte Frankreichs, die noch weniger erforscht und
künstlerisch ausgenutzt sind, deren Stunde aber auch bald
schlagen wird. Schon hat Leheutre seine Vaterstadt
Troyes in zarten Meisterwerken verherrlicht, auch La
Rochelle ist ihm durch Fromentins Dominique, den er
unlängst studierthat,liebgeworden.DiemalerischenHäuser
derBretagne haben es — wie manchem andern — Eugene
Delätre angetan; LeMeilleur führt uns in dieNormandie,
P.E. Colin nach Lothringen. Rene P in art, der aus Nantes
stammt, hat den lebhaften Hafen dieser Stadt in einer
vortrefflichen Zeichnung geschildert, und diese Zeichnung
verspricht zu einer vortrefflichen Radierung zu werden,
wofür seine drei Radierungen aus Toledo bürgen. Auray
im Mondlicht zeigt uns F. T. Simon. Derselbe Künstler
hat aber auch das heimatliche Prag — und zwar im
Schnee — auf die Platte gebannt. Spanische Stadtbilder
sind noch zu sehen von Labrouche, verschiedene andere
von Hermann A. Webster; ein einziger Künstler —
Sammlungen Jaeckel, Oeder, Mosle, Strauss-Negbaur,
Köpping, Derenberg, Liebermann, Ginsberg, Kunstge-
werbemuseum Berlin, Kunsthalle Bremen u. s. f. gehören
zu dem wertvollen Material, das in zusammenfassenden
Werken und Monographien des öfteren angeführt und
zum großen Teil reproduziert wurde. Durch die vor-
züglich getroffene Auswahl hatte sich Dr. Smidt-
Bremen verdient gemacht. Der Besprechung dieses
Materials glaube ich mich schon darum enthoben wissen
zu dürfen, weil es sich hier um bereits Bekanntes handelt.
Zur Charakterisierung des Ensembles sei nur bemerkt,
. daß Harun obu undUtamaroam reichsten vertreten sind.
Das Bedeutende und Lehrreiche in der Abteilung der
Malerei ist mit dem Angeführten bei weitem nicht
erschöpft. Der Aspekt der Ausstellung wird wesentlich
beeinflußt von Bildern wie die Bücherlüftung von
Kaihoku Yüsetsu (Berliner Museen), Hirsche von
Shen Nan-Pin (Sammlung Jakoby), Abschied der
Chao-Chün (China, XIV. Jahrb.., Museen Berlin),
Chrysanthemenzweig (China, XVII. Jahrh., Sammlung
Oeder), Dharma von Fugwai, Hahachö von Sesshü,
Hahachö und Landschaft von Eitoku, Pflaumenbaum
von Körin, die Blumen der vier Jahreszeiten von Yana-
gisawa Kien, Weih und Krähen von Yosa Buson, Land-
schaften von Kuo Hsi und Unkoku Togan, Taoistische
Gottheiten,Kopie nach einem Ming-Meister(Museen Berlin),
und die geistreiche humoristische Darstellung der zwei
Krähen von Nagasawa Rosetsu (Sammlung Jakoby)
u. a. m. Alle diese Werke repräsentieren aber Kunst-
begriffe und Qualitäten, deren Beurteilung einstweilen zu
den Immobilien unserer Kritik der fernöstlichen Kunst zu
rechnen ist.
Die sehr reiche kunstgewerbliche Abteilung muß
hier, als nicht in das Programm dieser Zeitschrift gehörig,
schweigend übergangen werden. Ich tue das ungern,
schon darum, weil unter den Lacken und Töpfereien
Stücke von märchenhafter Schönheit zu finden waren
und die Stichblätter eine lückenlose Übersicht ihrer
künstlerischen Entwicklung gestatteten. Unter den Plasti-
ken sollen einige Stücke wenigstens flüchtig erwähnt
werden. So der Indra als Tempelwächter (Stein, China,
VII. bis IX. Jahrh.), der Aizen, Jizö und Bishamon (Holz,
Japan, XIII. Jahrh.), die gleichfalls aus Holz gemeißelte
Kwannon (Japan XI. bis XII. Jahrh.) und das Fragment
eines kolossalen Buddhahauptes (Holz, Japan, VIII. Jahrh.),
dessen Formvollendung und monumentale Grazie eine
»edle Einfalt und stille Größe« ausstrahlt, die davon
zeugt, daß Griechenlands künstlerischer Nachlaß auch
im fernen Osten einen Widerhall gefunden hat, der
den Vergleich mit dem Winckelmannschen Klassizismus
zuläßt.
Der Erfolg der Ausstellung ist in erster Linie Dr. Otto
Kümmel, dem Direktor der ostasiatischen Abteilung des
Berliner Museums, zu verdanken. Auch für die Auswahl
des ganzen Materials ist er verantwortlich. Hinsichtlich
der Berliner Museumsstücke muß ich mich auf seine
Ausführungen in den Amtlichen Berichten der königlich
Preußischen Kunstsammlungen und sodann auf die Auf-
sätze von Dr. William Cohn im »Cicerone« (Jahrg. 1910,
Heft 23) und Friedrich Perzynski in der Zeitschrift für
Bildende Kunst (Jahrg. 1911 — 12, S. 139) berufen.
Zoltdn Taliäcs.
Paris. Die graphischen Künste auf den Salons
des Jahres 1912.
I. La Societe Nationale.
Die Graphik erscheint hier, was die Aufstellung an-
belangt, recht schlecht bedacht: die düsteren Umgänge
eines Rundgebäudes und ein kleiner Saal, der auch nicht
sehr hell ist, sind ihr zugewiesen. Sie hat viel verloren
dadurch, daß sie die Säle des Erdgeschosses verließ, die
zwar etwas abseits gelegen waren, aber doch von dem,
der die Graphik suchen wollte, leicht gefunden werden
konnten.
Die Mehrzahl der hier ausgestellten Blätter sind Radie-
rungen, schwarz-weiße und farbige, wobei die schwarz-
weißen überwiegen, dann kommt eine immerhin noch
beträchtliche Schar von Holzschnitten und schließlich
ein paar Lithographien.
Diese einfache Feststellung zeigt den Grad der
Beliebtheit, deren sich gegenwärtig die verschiedenen
Verfahren erfreuen.
Paris wird etwa seit einem Dutzend Jahren mit großer
Vorliebe von den Künstlern studiert, fast im Übermaß und
bis zum Mißbrauch. Denn ein Teil der Künstler hat zwar
Gefühl und Verständnis für Schönheit und Wesen der
Stadt, manchen aber treibt hiebei nur das Geschäfts-
interesse, da die Pariser Bilder sich gut verkaufen. Unter
den besten derartigen Arbeiten, die hier zu sehen sind,
nennen wir die Blätter von Eugene Bejot, Ernest
Herscher, Edmond Kayser, Charles Heyman,
Edgar Chahine und Raffaelli. Und neben Paris ist da
Versailles, das Ch. Jouas in seinen Illustrationen zu H.
de Regniers »Cite des Eaux« behandelt, und dann die
andern Städte Frankreichs, die noch weniger erforscht und
künstlerisch ausgenutzt sind, deren Stunde aber auch bald
schlagen wird. Schon hat Leheutre seine Vaterstadt
Troyes in zarten Meisterwerken verherrlicht, auch La
Rochelle ist ihm durch Fromentins Dominique, den er
unlängst studierthat,liebgeworden.DiemalerischenHäuser
derBretagne haben es — wie manchem andern — Eugene
Delätre angetan; LeMeilleur führt uns in dieNormandie,
P.E. Colin nach Lothringen. Rene P in art, der aus Nantes
stammt, hat den lebhaften Hafen dieser Stadt in einer
vortrefflichen Zeichnung geschildert, und diese Zeichnung
verspricht zu einer vortrefflichen Radierung zu werden,
wofür seine drei Radierungen aus Toledo bürgen. Auray
im Mondlicht zeigt uns F. T. Simon. Derselbe Künstler
hat aber auch das heimatliche Prag — und zwar im
Schnee — auf die Platte gebannt. Spanische Stadtbilder
sind noch zu sehen von Labrouche, verschiedene andere
von Hermann A. Webster; ein einziger Künstler —