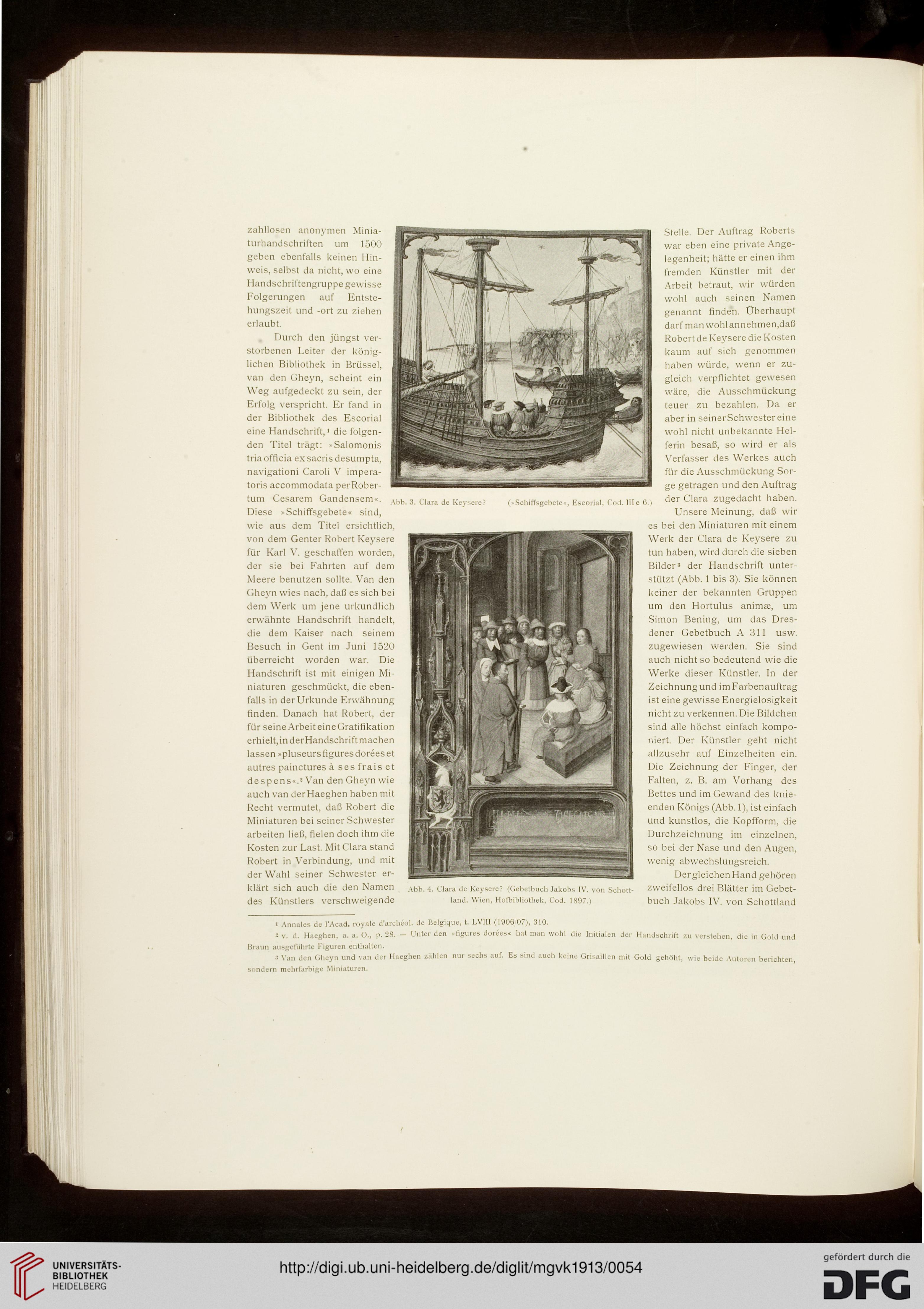zahllosen anonymen Minia-
turhandschriften um 1500
geben ebenfalls keinen Hin-
weis, selbst da nicht, wo eine
Handschriftengruppe gewisse
Folgerungen auf Entste-
hungszeit und -ort zu ziehen
erlaubt.
Durch den jüngst ver-
storbenen Leiter der könig-
lichen Bibliothek in Brüssel,
van den Gheyn, scheint ein
Weg aufgedeckt zu sein, der
Erfolg verspricht. Er fand in
der Bibliothek des Escorial
eine Handschrift,' die folgen-
den Titel trägt: »Salomonis
triaofficia exsacrisdesumpta,
navigationi Caroli V impera-
toris aecommodata perRobei -
tum Cesarem Gandensem«.
Diese »Schiffsgebete« sind,
wie aus dem Titel ersichtlich,
von dem Genter Robert Keysere
für Karl V. geschaffen worden,
der sie bei Fahrten auf dem
Meere benutzen sollte. Van den
Gheyn wies nach, daß es sich bei
dem Werk um jene urkundlich
erwähnte Handschrift handelt,
die dem Kaiser nach seinem
Besuch in Gent im Juni 1520
überreicht worden war. Die
Handschrift ist mit einigen Mi-
niaturen geschmückt, die eben-
falls in der Urkunde Erwähnung
finden. Danach hat Robert, der
für seine Arbeit eine Gratifikation
erhielt, in derHandschrift machen
lassen »pluseursfiguresdoreeset
autres painetures ä ses frais et
despens«.2 Van den Gheyn wie
auch van derHaeghen haben mit
Recht vermutet, daß Robert die
Miniaturen bei seiner Schwester
arbeiten ließ, fielen doch ihm die
Kosten zur Last. Mit Clara stand
Robert in Verbindung, und mit
der Wahl seiner Schwester er-
klärt sich auch die den Namen
des Künstlers verschweigende
\bh. 3. Clara de Keysei
(»Schiffsgebete , Escorial, Cod. III e 6
. Clara de Keysere? (Gebetbuch Jakobs
land. Wien, Hofbibliothek, Cod. 18
Stelle. Der Auftrag Roberts
war eben eine private Ange-
legenheit; hätte er einen ihm
fremden Künstler mit der
Arbeit betraut, wir würden
wohl auch seinen Namen
genannt finden. Überhaupt
darf man wohl annehmen,daß
Robert de Keysere die Kosten
kaum auf sich genommen
haben würde, wenn er zu-
gleich verpflichtet gewesen
wäre, die Ausschmückung
teuer zu bezahlen. Da er
aber in seinerSchwestereine
wohl nicht unbekannte Hel-
ferin besaß, so wird er als
Verfasser des Werkes auch
für die Ausschmückung Sor-
ge getragen und den Auftrag
der Clara zugedacht haben.
Unsere Meinung, daß wir
es bei den Miniaturen mit einem
Werk der Clara de Keysere zu
tun haben, wird durch die sieben
Bilder3 der Handschrift unter-
stützt (Abb. 1 bis 3). Sie können
keiner der bekannten Gruppen
um den Hortulus anima;, um
Simon Bening, um das Dres-
dener Gebetbuch A 311 usw.
zugewiesen werden. Sie sind
auch nicht so bedeutend wie die
Werke dieser Künstler. In der
Zeichnung und im Farbenauftrag
ist eine gewisse Energielosigkeit
nicht zu verkennen. Die Bildchen
sind alle höchst einfach kompo-
niert. Der Künstler geht nicht
allzusehr auf Einzelheiten ein.
Die Zeichnung der Finger, der
Falten, z. B. am Vorhang des
Bettes und im Gewand des knie-
enden Königs (Abb. 1). ist einfach
und kunstlos, die Kopfform, die
Durchzeichnung im einzelnen,
so bei der Nase und den Augen,
wenig abwechslungsreich.
DergleichenHand gehören
zweifellos drei Blätter im Gebet-
buch Jakobs IV. von Schottland
i Annales de l'Acad. royale d'arcbeol. de Belgique, t. LVIII (1906/07), 310.
- v. d. Haeghen, a. a. 0„ p. 28. - Unter den »flgures dorees« hat man wohl che Initialen der Handschrift zu verstehen, die in Gold und
Braun ausgeführte Figuren enthalten.
= Van den Gheyn und van der Haeghen zahlen nur sechs auf. Es sind auch keine Grisaillen mit Gold gehöht, wie beide Autoren berichten,
sondern mehrfarbige Minialuren.
turhandschriften um 1500
geben ebenfalls keinen Hin-
weis, selbst da nicht, wo eine
Handschriftengruppe gewisse
Folgerungen auf Entste-
hungszeit und -ort zu ziehen
erlaubt.
Durch den jüngst ver-
storbenen Leiter der könig-
lichen Bibliothek in Brüssel,
van den Gheyn, scheint ein
Weg aufgedeckt zu sein, der
Erfolg verspricht. Er fand in
der Bibliothek des Escorial
eine Handschrift,' die folgen-
den Titel trägt: »Salomonis
triaofficia exsacrisdesumpta,
navigationi Caroli V impera-
toris aecommodata perRobei -
tum Cesarem Gandensem«.
Diese »Schiffsgebete« sind,
wie aus dem Titel ersichtlich,
von dem Genter Robert Keysere
für Karl V. geschaffen worden,
der sie bei Fahrten auf dem
Meere benutzen sollte. Van den
Gheyn wies nach, daß es sich bei
dem Werk um jene urkundlich
erwähnte Handschrift handelt,
die dem Kaiser nach seinem
Besuch in Gent im Juni 1520
überreicht worden war. Die
Handschrift ist mit einigen Mi-
niaturen geschmückt, die eben-
falls in der Urkunde Erwähnung
finden. Danach hat Robert, der
für seine Arbeit eine Gratifikation
erhielt, in derHandschrift machen
lassen »pluseursfiguresdoreeset
autres painetures ä ses frais et
despens«.2 Van den Gheyn wie
auch van derHaeghen haben mit
Recht vermutet, daß Robert die
Miniaturen bei seiner Schwester
arbeiten ließ, fielen doch ihm die
Kosten zur Last. Mit Clara stand
Robert in Verbindung, und mit
der Wahl seiner Schwester er-
klärt sich auch die den Namen
des Künstlers verschweigende
\bh. 3. Clara de Keysei
(»Schiffsgebete , Escorial, Cod. III e 6
. Clara de Keysere? (Gebetbuch Jakobs
land. Wien, Hofbibliothek, Cod. 18
Stelle. Der Auftrag Roberts
war eben eine private Ange-
legenheit; hätte er einen ihm
fremden Künstler mit der
Arbeit betraut, wir würden
wohl auch seinen Namen
genannt finden. Überhaupt
darf man wohl annehmen,daß
Robert de Keysere die Kosten
kaum auf sich genommen
haben würde, wenn er zu-
gleich verpflichtet gewesen
wäre, die Ausschmückung
teuer zu bezahlen. Da er
aber in seinerSchwestereine
wohl nicht unbekannte Hel-
ferin besaß, so wird er als
Verfasser des Werkes auch
für die Ausschmückung Sor-
ge getragen und den Auftrag
der Clara zugedacht haben.
Unsere Meinung, daß wir
es bei den Miniaturen mit einem
Werk der Clara de Keysere zu
tun haben, wird durch die sieben
Bilder3 der Handschrift unter-
stützt (Abb. 1 bis 3). Sie können
keiner der bekannten Gruppen
um den Hortulus anima;, um
Simon Bening, um das Dres-
dener Gebetbuch A 311 usw.
zugewiesen werden. Sie sind
auch nicht so bedeutend wie die
Werke dieser Künstler. In der
Zeichnung und im Farbenauftrag
ist eine gewisse Energielosigkeit
nicht zu verkennen. Die Bildchen
sind alle höchst einfach kompo-
niert. Der Künstler geht nicht
allzusehr auf Einzelheiten ein.
Die Zeichnung der Finger, der
Falten, z. B. am Vorhang des
Bettes und im Gewand des knie-
enden Königs (Abb. 1). ist einfach
und kunstlos, die Kopfform, die
Durchzeichnung im einzelnen,
so bei der Nase und den Augen,
wenig abwechslungsreich.
DergleichenHand gehören
zweifellos drei Blätter im Gebet-
buch Jakobs IV. von Schottland
i Annales de l'Acad. royale d'arcbeol. de Belgique, t. LVIII (1906/07), 310.
- v. d. Haeghen, a. a. 0„ p. 28. - Unter den »flgures dorees« hat man wohl che Initialen der Handschrift zu verstehen, die in Gold und
Braun ausgeführte Figuren enthalten.
= Van den Gheyn und van der Haeghen zahlen nur sechs auf. Es sind auch keine Grisaillen mit Gold gehöht, wie beide Autoren berichten,
sondern mehrfarbige Minialuren.