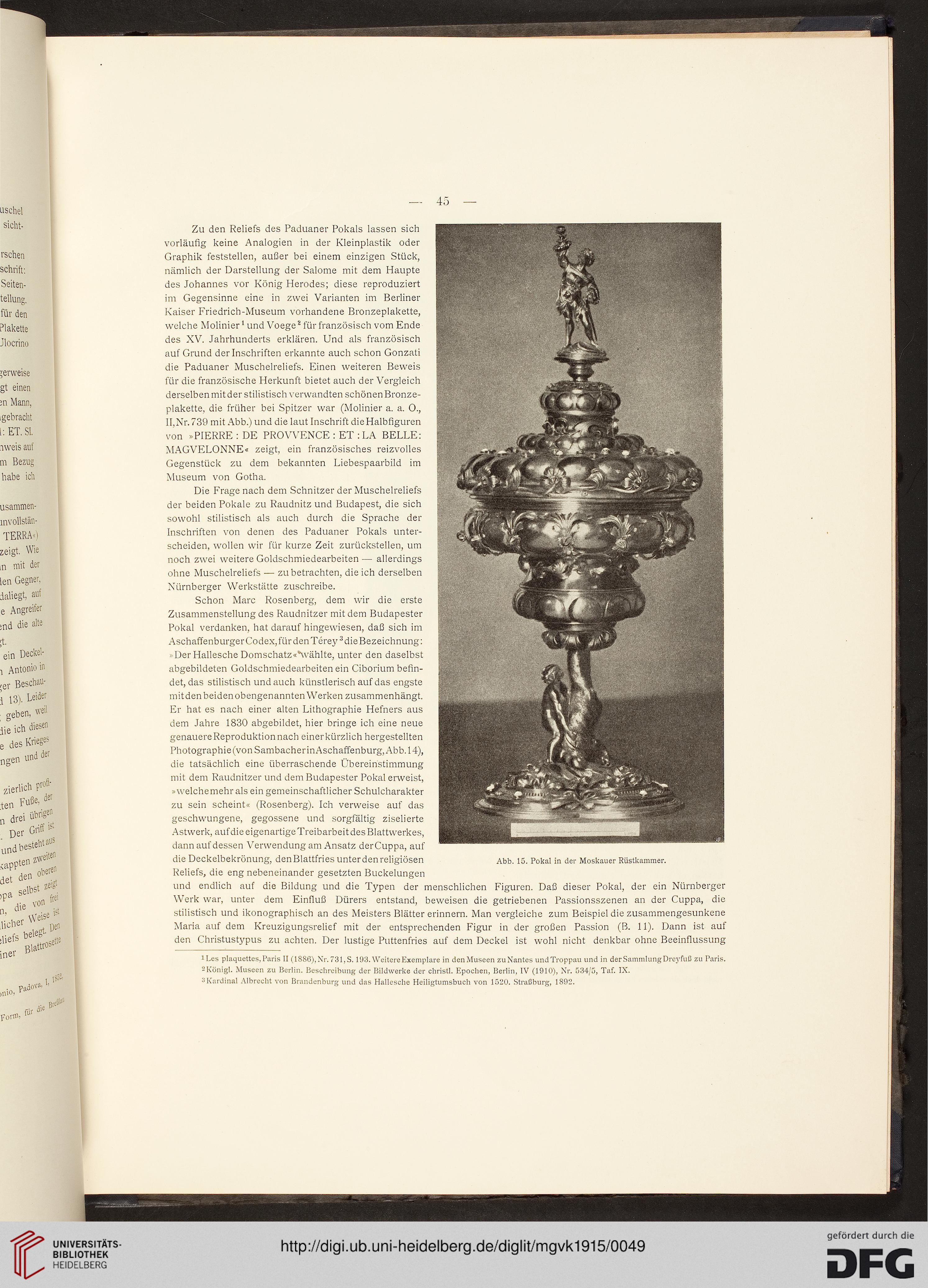Zu den Reliefs des Paduaner Pokals lassen sich
vorläufig keine Analogien in der Kleinplastik oder
Graphik feststellen, außer bei einem einzigen Stück,
nämlich der Darstellung der Salome mit dem Haupte
des Johannes vor König Herodes; diese reproduziert
im Gegensinne eine in zwei Varianten im Berliner
Kaiser Friedrich-Museum vorhandene Bronzeplakette,
welche Molinier1 und Voege2 für französisch vom Ende
des XV. Jahrhunderts erklären. Und als französisch
auf Grund der Inschriften erkannte auch schon Gonzati
die Paduaner Muschelreliefs. Einen weiteren Beweis
für die französische Herkunft bietet auch der Vergleich
derselben mit der stilistisch verwandten schönen Bronze-
plakette, die früher bei Spitzer war (Molinier a. a. 0.,
II,Nr. 739 mit Abb.) und die laut Inschrift die Halbfiguren
von »PIERRE : DE PROVVENCE : ET : LA BELLE:
MAGVELONNE« zeigt, ein französisches reizvolles
Gegenstück zu dem bekannten Liebespaarbild im
Museum von Gotha.
Die Frage nach dem Schnitzer der Muschelreliefs
der beiden Pokale zu Raudnitz und Budapest, die sich
sowohl stilistisch als auch durch die Sprache der
Inschriften von denen des Paduaner Pokals unter-
scheiden, wollen wir für kurze Zeit zurückstellen, um
noch zwei weitere Goldschmiedearbeiten — allerdings
ohne Muschelreliefs — zu betrachten, die ich derselben
Nürnberger Werkstätte zuschreibe.
Schon Marc Rosenberg, dem wir die erste
Zusammenstellung des Raudnitzer mit dem Budapester
Pokal verdanken, hat darauf hingewiesen, daß sich im
Aschaffenburger Codex, für den Terey3 die Bezeichnung:
»Der Hallesche Domschatz«*wählte, unter den daselbst
abgebildeten Goldschmiedearbeitenein Ciboriumbefin-
det, das stilistisch und auch künstlerisch auf das engste
mit den beiden obengenannten Werken zusammenhängt.
Er hat es nach einer alten Lithographie Hefners aus
dem Jahre 1830 abgebildet, hier bringe ich eine neue
genauere Reproduktion nach einerkürzlich hergestellten
Photographie (von Sambacher in Aschaffenburg, Abb. 14),
die tatsächlich eine überraschende Übereinstimmung
mit dem Raudnitzer und dem Budapester Pokal erweist,
»welche mehr als ein gemeinschaftlicher Schulcharakter
zu sein scheint« (Rosenberg). Ich verweise auf das
geschwungene, gegossene und sorgfältig ziselierte
Astwerk, auf die eigenartige Treibarbeit des Blattwerkes,
dann auf dessen Verwendung am Ansatz derCuppa, auf
die Deckelbekrönung, denBlattfries unterdenreligiösen
Reliefs, die eng nebeneinander gesetzten Buckelungen
und endlich auf die Bildung und die Typen der menschlichen Figuren. Daß dieser Pokal, der ein Nürnberger
Werk war, unter dem Einfluß Dürers entstand, beweisen die getriebenen Passionsszenen an der Cuppa, die
stilistisch und ikonographisch an des Meisters Blätter erinnern. Man vergleiche zum Beispiel die zusammengesunkene
Maria auf dem Kreuzigungsrelief mit der entsprechenden Figur in der großen Passion (B. 11). Dann ist auf
den Christustypus zu achten. Der lustige Puttenfries auf dem Deckel ist wohl nicht denkbar ohne Beeinflussung
Pß
Abb. 15. Pokal in der Moskauer Rüstkammer.
iLes plaquettes, Paris II (1886), Xr. 731, S. 193. Weitere Exemplare in denMuseen zuNantes undTroppau und in der Sammlung Dreyfuß zu Paris.
SKönigl. Museen zu Berlin. Beschreibung der Bildwerke der cliristl. Epochen, Berlin, IV (1910), Nr. 534/5, Taf. IX.
3 Kardinal Albrecht von Brandenburg und das Hallesche Heiligtumsbuch von 1520. Straßburg, 1892.
vorläufig keine Analogien in der Kleinplastik oder
Graphik feststellen, außer bei einem einzigen Stück,
nämlich der Darstellung der Salome mit dem Haupte
des Johannes vor König Herodes; diese reproduziert
im Gegensinne eine in zwei Varianten im Berliner
Kaiser Friedrich-Museum vorhandene Bronzeplakette,
welche Molinier1 und Voege2 für französisch vom Ende
des XV. Jahrhunderts erklären. Und als französisch
auf Grund der Inschriften erkannte auch schon Gonzati
die Paduaner Muschelreliefs. Einen weiteren Beweis
für die französische Herkunft bietet auch der Vergleich
derselben mit der stilistisch verwandten schönen Bronze-
plakette, die früher bei Spitzer war (Molinier a. a. 0.,
II,Nr. 739 mit Abb.) und die laut Inschrift die Halbfiguren
von »PIERRE : DE PROVVENCE : ET : LA BELLE:
MAGVELONNE« zeigt, ein französisches reizvolles
Gegenstück zu dem bekannten Liebespaarbild im
Museum von Gotha.
Die Frage nach dem Schnitzer der Muschelreliefs
der beiden Pokale zu Raudnitz und Budapest, die sich
sowohl stilistisch als auch durch die Sprache der
Inschriften von denen des Paduaner Pokals unter-
scheiden, wollen wir für kurze Zeit zurückstellen, um
noch zwei weitere Goldschmiedearbeiten — allerdings
ohne Muschelreliefs — zu betrachten, die ich derselben
Nürnberger Werkstätte zuschreibe.
Schon Marc Rosenberg, dem wir die erste
Zusammenstellung des Raudnitzer mit dem Budapester
Pokal verdanken, hat darauf hingewiesen, daß sich im
Aschaffenburger Codex, für den Terey3 die Bezeichnung:
»Der Hallesche Domschatz«*wählte, unter den daselbst
abgebildeten Goldschmiedearbeitenein Ciboriumbefin-
det, das stilistisch und auch künstlerisch auf das engste
mit den beiden obengenannten Werken zusammenhängt.
Er hat es nach einer alten Lithographie Hefners aus
dem Jahre 1830 abgebildet, hier bringe ich eine neue
genauere Reproduktion nach einerkürzlich hergestellten
Photographie (von Sambacher in Aschaffenburg, Abb. 14),
die tatsächlich eine überraschende Übereinstimmung
mit dem Raudnitzer und dem Budapester Pokal erweist,
»welche mehr als ein gemeinschaftlicher Schulcharakter
zu sein scheint« (Rosenberg). Ich verweise auf das
geschwungene, gegossene und sorgfältig ziselierte
Astwerk, auf die eigenartige Treibarbeit des Blattwerkes,
dann auf dessen Verwendung am Ansatz derCuppa, auf
die Deckelbekrönung, denBlattfries unterdenreligiösen
Reliefs, die eng nebeneinander gesetzten Buckelungen
und endlich auf die Bildung und die Typen der menschlichen Figuren. Daß dieser Pokal, der ein Nürnberger
Werk war, unter dem Einfluß Dürers entstand, beweisen die getriebenen Passionsszenen an der Cuppa, die
stilistisch und ikonographisch an des Meisters Blätter erinnern. Man vergleiche zum Beispiel die zusammengesunkene
Maria auf dem Kreuzigungsrelief mit der entsprechenden Figur in der großen Passion (B. 11). Dann ist auf
den Christustypus zu achten. Der lustige Puttenfries auf dem Deckel ist wohl nicht denkbar ohne Beeinflussung
Pß
Abb. 15. Pokal in der Moskauer Rüstkammer.
iLes plaquettes, Paris II (1886), Xr. 731, S. 193. Weitere Exemplare in denMuseen zuNantes undTroppau und in der Sammlung Dreyfuß zu Paris.
SKönigl. Museen zu Berlin. Beschreibung der Bildwerke der cliristl. Epochen, Berlin, IV (1910), Nr. 534/5, Taf. IX.
3 Kardinal Albrecht von Brandenburg und das Hallesche Heiligtumsbuch von 1520. Straßburg, 1892.