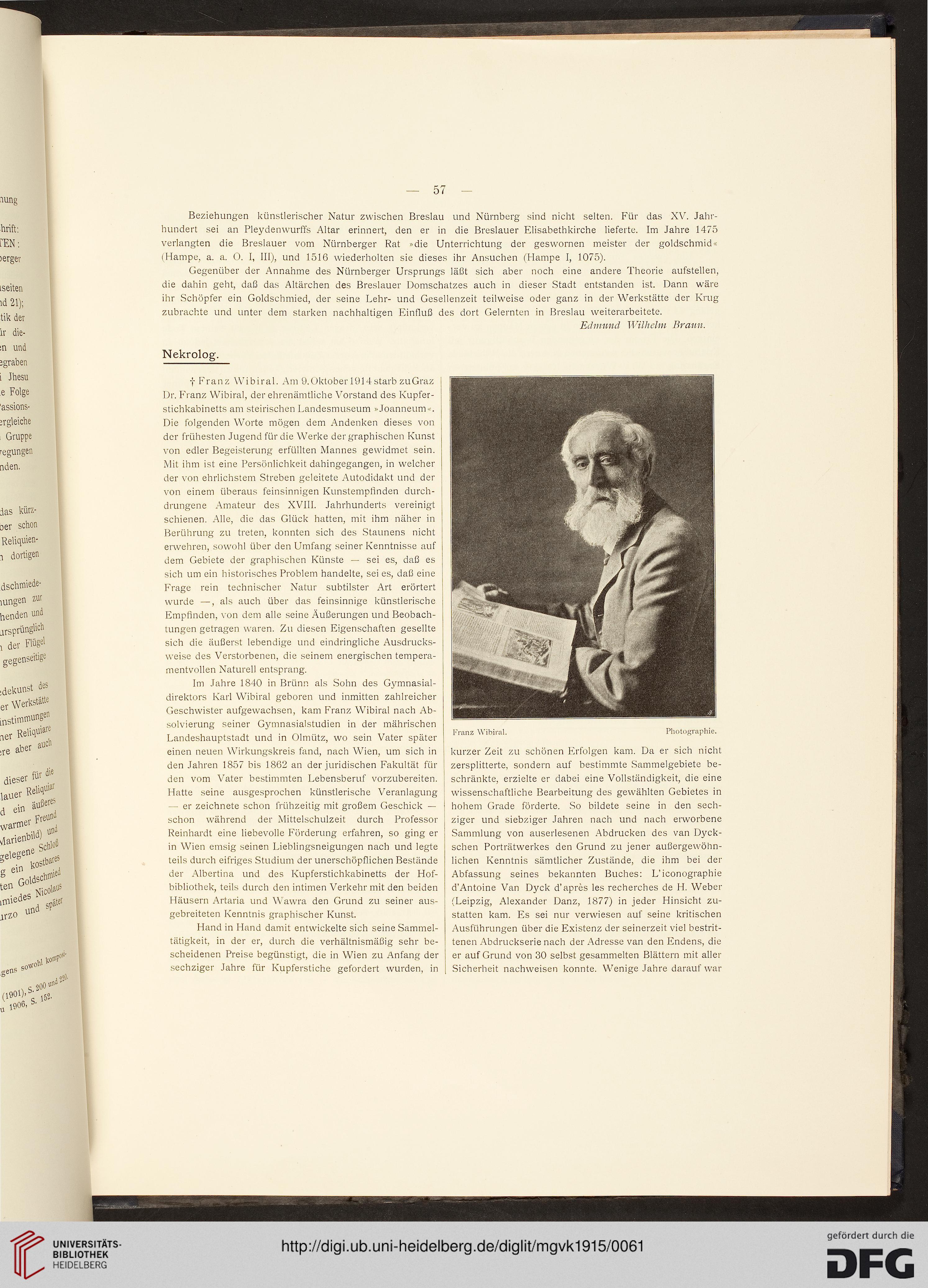Beziehungen künstlerischer Natur zwischen Breslau und Nürnberg sind nicht selten. Für das XV. Jahr-
hundert sei an Pleydenwurffs Altar erinnert, den er in die Breslauer Elisabethkirche lieferte. Im Jahre 1475
verlangten die Breslauer vom Nürnberger Rat »die Unterrichtung der geswornen meister der goldschmid«
(Hampe, a. a. O. I, III), und 1516 wiederholten sie dieses ihr Ansuchen (Hampe I, 1075).
Gegenüber der Annahme des Nürnberger Ursprungs läßt sich aber noch eine andere Theorie aufstellen,
die dahin geht, daß das Altärchen des Breslauer Domschatzes auch in dieser Stadt entstanden ist. Dann wäre
ihr Schöpfer ein Goldschmied, der seine Lehr- und Gesellenzeit teilweise oder ganz in der Werkstätte der Krug
zubrachte und unter dem starken nachhaltigen Einfluß des dort Gelernten in Breslau weiterarbeitete.
Edmund Wilhelm Braun.
Nekrolog.
-|- Franz Wibiral. Am 9. Oktober 1914 starb zuGraz
Dr. Franz Wibiral, der ehrenämtliche Vorstand des Kupfer-
stichkabinetts am steirischen Landesmuseum »Joanneum«.
Die folgenden Worte mögen dem Andenken dieses von
der frühesten Jugend für die Werke der graphischen Kunst
von edler Begeisterung erfüllten Mannes gewidmet sein.
Mit ihm ist eine Persönlichkeit dahingegangen, in welcher
der von ehrlichstem Streben geleitete Autodidakt und der
von einem überaus feinsinnigen Kunstempfinden durch-
drungene Amateur des XVIII. Jahrhunderts vereinigt
schienen. Alle, die das Glück hatten, mit ihm näher in
Berührung zu treten, konnten sich des Staunens nicht
erwehren, sowohl über den Umfang seiner Kenntnisse auf
dem Gebiete der graphischen Künste — sei es, daß es
sich um ein historisches Problem handelte, sei es, daß eine
Frage rein technischer Natur subtilster Art erörtert
wurde —, als auch über das feinsinnige künstlerische
Empfinden, von dem alle seine Äußerungen und Beobach-
tungen getragen waren. Zu diesen Eigenschaften gesellte
sich die äußerst lebendige und eindringliche Ausdrucks-
weise des Verstorbenen, die seinem energischen tempera-
mentvollen Naturell entsprang.
Im Jahre 1840 in Brünn als Sohn des Gymnasial-
direktors Karl Wibiral geboren und inmitten zahlreicher
Geschwister aufgewachsen, kam FYanz Wibiral nach Ab-
solvierung seiner Gymnasialstudien in der mährischen
Landeshauptstadt und in Olmütz, wo sein Vater später
einen neuen Wirkungskreis fand, nach Wien, um sich in
den Jahren 1857 bis 1862 an der juridischen Fakultät für
den vom Vater bestimmten Lebensberuf vorzubereiten.
Hatte seine ausgesprochen künstlerische Veranlagung
— er zeichnete schon frühzeitig mit großem Geschick —
schon während der Mittelschulzeit durch Professor
Reinhardt eine liebevolle Förderung erfahren, so ging er
in Wien emsig seinen Lieblingsneigungen nach und legte
teils durch eifriges Studium der unerschöpflichen Bestände
der Albertina und des Kupferstichkabinetts der Hof-
bibliothek, teils durch den intimen Verkehr mit den beiden
Häusern Artaria und Wawra den Grund zu seiner aus-
gebreiteten Kenntnis graphischer Kunst.
Hand in Hand damit entwickelte sich seine Sammel-
tätigkeit, in der er, durch die verhältnismäßig sehr be-
scheidenen Preise begünstigt, die in Wien zu Anfang der
sechziger Jahre für Kupferstiche gefordert wurden, in
Franz Wibiral. Photographie.
kurzer Zeit zu schönen Erfolgen kam. Da er sich nicht
zersplitterte, sondern auf bestimmte Sammelgebiete be-
schränkte, erzielte er dabei eine Vollständigkeit, die eine
wissenschaftliche Bearbeitung des gewählten Gebietes in
hohem Grade förderte. So bildete seine in den sech-
ziger und siebziger Jahren nach und nach erworbene
Sammlung von auserlesenen Abdrucken des van Dyck-
schen Porträtwerkes den Grund zu jener außergewöhn-
lichen Kenntnis sämtlicher Zustände, die ihm bei der
Abfassung seines bekannten Buches: L'iconographie
d'Antoine Van Dyck d'apres les recherches de H. Weber
(Leipzig, Alexander Danz, 1877) in jeder Hinsicht zu-
statten kam. Es sei nur verwiesen auf seine kritischen
Ausführungen über die Existenz der seinerzeit viel bestrit-
tenen Abdruckserie nach der Adresse van den Endens, die
er auf Grund von 30 selbst gesammelten Blättern mit aller
Sicherheit nachweisen konnte. Wenige Jahre darauf war
hundert sei an Pleydenwurffs Altar erinnert, den er in die Breslauer Elisabethkirche lieferte. Im Jahre 1475
verlangten die Breslauer vom Nürnberger Rat »die Unterrichtung der geswornen meister der goldschmid«
(Hampe, a. a. O. I, III), und 1516 wiederholten sie dieses ihr Ansuchen (Hampe I, 1075).
Gegenüber der Annahme des Nürnberger Ursprungs läßt sich aber noch eine andere Theorie aufstellen,
die dahin geht, daß das Altärchen des Breslauer Domschatzes auch in dieser Stadt entstanden ist. Dann wäre
ihr Schöpfer ein Goldschmied, der seine Lehr- und Gesellenzeit teilweise oder ganz in der Werkstätte der Krug
zubrachte und unter dem starken nachhaltigen Einfluß des dort Gelernten in Breslau weiterarbeitete.
Edmund Wilhelm Braun.
Nekrolog.
-|- Franz Wibiral. Am 9. Oktober 1914 starb zuGraz
Dr. Franz Wibiral, der ehrenämtliche Vorstand des Kupfer-
stichkabinetts am steirischen Landesmuseum »Joanneum«.
Die folgenden Worte mögen dem Andenken dieses von
der frühesten Jugend für die Werke der graphischen Kunst
von edler Begeisterung erfüllten Mannes gewidmet sein.
Mit ihm ist eine Persönlichkeit dahingegangen, in welcher
der von ehrlichstem Streben geleitete Autodidakt und der
von einem überaus feinsinnigen Kunstempfinden durch-
drungene Amateur des XVIII. Jahrhunderts vereinigt
schienen. Alle, die das Glück hatten, mit ihm näher in
Berührung zu treten, konnten sich des Staunens nicht
erwehren, sowohl über den Umfang seiner Kenntnisse auf
dem Gebiete der graphischen Künste — sei es, daß es
sich um ein historisches Problem handelte, sei es, daß eine
Frage rein technischer Natur subtilster Art erörtert
wurde —, als auch über das feinsinnige künstlerische
Empfinden, von dem alle seine Äußerungen und Beobach-
tungen getragen waren. Zu diesen Eigenschaften gesellte
sich die äußerst lebendige und eindringliche Ausdrucks-
weise des Verstorbenen, die seinem energischen tempera-
mentvollen Naturell entsprang.
Im Jahre 1840 in Brünn als Sohn des Gymnasial-
direktors Karl Wibiral geboren und inmitten zahlreicher
Geschwister aufgewachsen, kam FYanz Wibiral nach Ab-
solvierung seiner Gymnasialstudien in der mährischen
Landeshauptstadt und in Olmütz, wo sein Vater später
einen neuen Wirkungskreis fand, nach Wien, um sich in
den Jahren 1857 bis 1862 an der juridischen Fakultät für
den vom Vater bestimmten Lebensberuf vorzubereiten.
Hatte seine ausgesprochen künstlerische Veranlagung
— er zeichnete schon frühzeitig mit großem Geschick —
schon während der Mittelschulzeit durch Professor
Reinhardt eine liebevolle Förderung erfahren, so ging er
in Wien emsig seinen Lieblingsneigungen nach und legte
teils durch eifriges Studium der unerschöpflichen Bestände
der Albertina und des Kupferstichkabinetts der Hof-
bibliothek, teils durch den intimen Verkehr mit den beiden
Häusern Artaria und Wawra den Grund zu seiner aus-
gebreiteten Kenntnis graphischer Kunst.
Hand in Hand damit entwickelte sich seine Sammel-
tätigkeit, in der er, durch die verhältnismäßig sehr be-
scheidenen Preise begünstigt, die in Wien zu Anfang der
sechziger Jahre für Kupferstiche gefordert wurden, in
Franz Wibiral. Photographie.
kurzer Zeit zu schönen Erfolgen kam. Da er sich nicht
zersplitterte, sondern auf bestimmte Sammelgebiete be-
schränkte, erzielte er dabei eine Vollständigkeit, die eine
wissenschaftliche Bearbeitung des gewählten Gebietes in
hohem Grade förderte. So bildete seine in den sech-
ziger und siebziger Jahren nach und nach erworbene
Sammlung von auserlesenen Abdrucken des van Dyck-
schen Porträtwerkes den Grund zu jener außergewöhn-
lichen Kenntnis sämtlicher Zustände, die ihm bei der
Abfassung seines bekannten Buches: L'iconographie
d'Antoine Van Dyck d'apres les recherches de H. Weber
(Leipzig, Alexander Danz, 1877) in jeder Hinsicht zu-
statten kam. Es sei nur verwiesen auf seine kritischen
Ausführungen über die Existenz der seinerzeit viel bestrit-
tenen Abdruckserie nach der Adresse van den Endens, die
er auf Grund von 30 selbst gesammelten Blättern mit aller
Sicherheit nachweisen konnte. Wenige Jahre darauf war