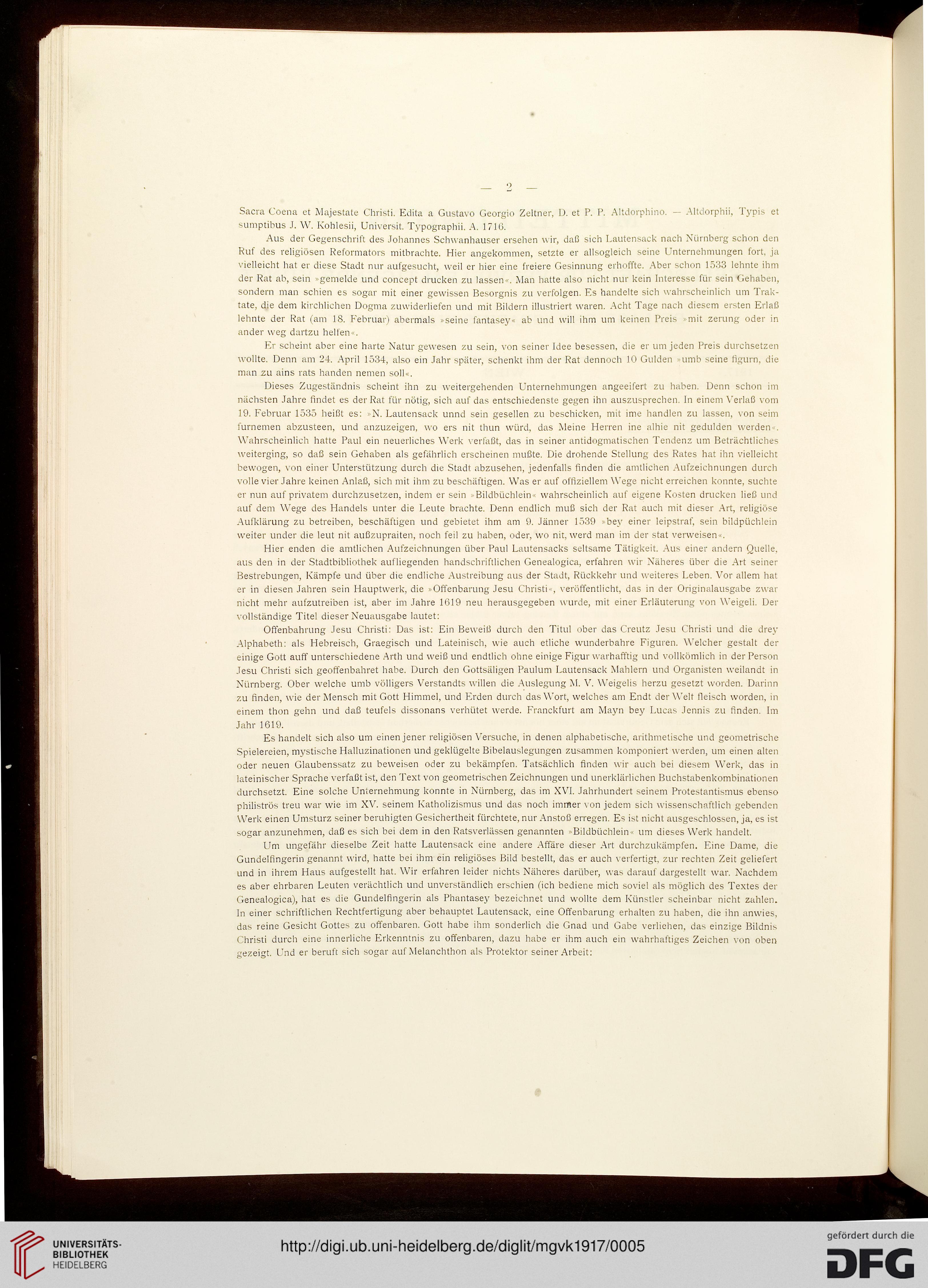Sacra Coena et Majestate Christi. Edita a Gustavo Georgio Zeltner, D. et P. P. Altdorphino. — Altdorphii, Typis et
sumptibus J. W. Kohlesii, Universit. Typographii. A. 1716.
Aus der Gegenschrift des Johannes Schwanhauser ersehen wir, daß sich Lautensack nach Nürnberg schon den
Ruf des religiösen Reformators mitbrachte. Hier angekommen, setzte er allsogleich seine Unternehmungen fort, ja
vielleicht hat er diese Stadt nur aufgesucht, weil er hier eine freiere Gesinnung erhoffte. Aber schon 1533 lehnte ihm
der Rat ab, sein »gemeide und concept drucken zu lassen». Man hatte also nicht nur kein Interesse für sein Gehaben,
sondern man schien es sogar mit einer gewissen Besorgnis zu verfolgen. Es handelte sich wahrscheinlich um Trak-
tate, die dem kirchlichen Dogma zuwiderliefen und mit Bildern illustriert waren. Acht Tage nach diesem ersten Erlaß
lehnte der Rat (am 18. Februar) abermals »seine fantasey« ab und will ihm um keinen Preis »mit zerung oder in
ander weg dartzu helfen«.
Er scheint aber eine harte Natur gewesen zu sein, von seiner Idee besessen, die er um jeden Preis durchsetzen
wollte. Denn am 24. April 1534, also ein Jahr später, schenkt ihm der Rat dennoch 10 Gulden umb seine flgum, die
man zu ains rats handen nemen soll«.
Dieses Zugeständnis scheint ihn zu weitergehenden Unternehmungen angeeifert zu haben. Denn schon im
nächsten Jahre findet es der Rat für nötig, sich auf das entschiedenste gegen ihn auszusprechen. In einem Verlaß vom
19. Februar 1535 heißt es: »N. Lautensack unnd sein gesellen zu beschicken, mit ime handien zu lassen, von seim
furnemen abzusteen, und anzuzeigen, wo ers nit thun würd, das Meine Herren ine alhie nit gedulden werden-.
Wahrscheinlich hatte Paul ein neuerliches Werk verfaßt, das in seiner antidogmatischen Tendenz um Beträchtliches
weiterging, so daß sein Gehaben als gefährlich erscheinen mußte. Die drohende Stellung des Rates hat ihn vielleicht
bewogen, von einer Unterstützung durch die Stadt abzusehen, jedenfalls finden die amtlichen Aufzeichnungen durch
volle vier Jahre keinen Anlaß, sich mit ihm zu beschäftigen. Was er auf offiziellem Wege nicht erreichen konnte, suchte
er nun auf privatem durchzusetzen, indem er sein »Bildbüchlein« wahrscheinlich auf eigene Kosten drucken ließ und
auf dem Wege des Handels unter die Leute brachte. Denn endlich muß sich der Rat auch mit dieser Art, religiöse
Aufklärung zu betreiben, beschäftigen und gebietet ihm am 9. Jänner 1539 »bey einer leipstraf, sein bildpüchlein
weiter under die leut nit außzupraiten, noch feil zu haben, oder, wo nit, werd man im der stat verweisen«.
Hier enden die amtlichen Aufzeichnungen über Paul Lautensacks seltsame Tätigkeit. Aus einer andern Quelle,
aus den in der Stadtbibliothek aufliegenden handschriftlichen Genealogica, erfahren wir Näheres über die Art seiner
Bestrebungen, Kämpfe und über die endliche Austreibung aus der Stadt, Rückkehr und weiteres Leben. Vor allem hat
er in diesen Jahren sein Hauptwerk, die »Offenbarung Jesu Christi», veröffentlicht, das in der Originalausgabe zwar
nicht mehr aufzutreiben ist, aber im Jahre IG 19 neu herausgegeben wurde, mit einer Erläuterung von Weigeli. Der
vollständige Titel dieser Neuausgabe lautet:
Offenbahrung Jesu Christi: Das ist: Ein Beweiß durch den Titul ober das Creutz Jesu Christi und die drey
Alphabeth: als Hebreisch, Graegisch und Lateinisch, wie auch etliche wunderbahre Figuren. Welcher gestalt der
einige Gott auff unterschiedene Arth und weiß und endtlich ohne einige Figur warhafftig und vollkömlich in der Person
Jesu Christi sich geoffenbahret habe. Durch den Gottsäligen Paulum Lautensack Mahlern und Organisten weilandt in
Nürnberg. Ober welche umb völligers Verstandts willen die Auslegung M. V. Weigelis herzu gesetzt worden. Darinn
zu finden, wie der Mensch mit Gott Himmel, und Erden durch das Wort, welches am Endt der Welt fleisch worden, in
einem thon gehn und daß teufeis dissonans verhütet werde. Franckfurt am Mayn bey Lucas Jennis zu finden. Im
Jahr 1619.
Es handelt sich also um einen jener religiösen Versuche, in denen alphabetische, arithmetische und geometrische
Spielereien, mystische Halluzinationen und geklügelte Bibelauslegungen zusammen komponiert werden, um einen alten
oder neuen Glaubenssatz zu beweisen oder zu bekämpfen. Tatsächlich finden wir auch bei diesem Werk, das in
lateinischer Sprache verfaßt ist, den Text von geometrischen Zeichnungen und unerklärlichen Buchstabenkombinationen
durchsetzt. Eine solche Unternehmung konnte in Nürnberg, das im XVI. Jahrhundert seinem Protestantismus ebenso
philiströs treu war wie im XV. seinem Katholizismus und das noch immer von jedem sich wissenschaftlich gebenden
Werk einen Umsturz seiner beruhigten Gesichertheit fürchtete, nur Anstoß erregen. Es ist nicht ausgeschlossen, ja, es ist
sogar anzunehmen, daß es sich bei dem in den Ratsverlässen genannten »Bildbüchlein■• um dieses Werk handelt.
Lfm ungefähr dieselbe Zeit hatte Lautensack eine andere Affäre dieser Art durchzukämpfen. Eine Dame, die
Gundelfingerin genannt wird, hatte bei ihm ein religiöses Bild bestellt, das er auch verfertigt, zur rechten Zeit geliefert
und in ihrem Haus aufgestellt hat. Wir erfahren leider nichts Näheres darüber, was darauf dargestellt war. Nachdem
es aber ehrbaren Leuten verächtlich und unverständlich erschien (ich bediene mich soviel als möglich des Textes der
Genealogica), hat es die Gundelfingerin als Phantasey bezeichnet und wollte dem Künstler scheinbar nicht zahlen.
In einer schriftlichen Rechtfertigung aber behauptet Lautensack, eine Offenbarung erhalten zu haben, die ihn anwies,
das reine Gesicht Gottes zu offenbaren. Gott habe ihm sonderlich die Gnad und Gabe verliehen, das einzige Bildnis
Christi durch eine innerliche Erkenntnis zu offenbaren, dazu habe er ihm auch ein wahrhaftiges Zeichen von oben
gezeigt. Und er beruft sich sogar auf Melanchthon als Protektor seiner Arbeit:
sumptibus J. W. Kohlesii, Universit. Typographii. A. 1716.
Aus der Gegenschrift des Johannes Schwanhauser ersehen wir, daß sich Lautensack nach Nürnberg schon den
Ruf des religiösen Reformators mitbrachte. Hier angekommen, setzte er allsogleich seine Unternehmungen fort, ja
vielleicht hat er diese Stadt nur aufgesucht, weil er hier eine freiere Gesinnung erhoffte. Aber schon 1533 lehnte ihm
der Rat ab, sein »gemeide und concept drucken zu lassen». Man hatte also nicht nur kein Interesse für sein Gehaben,
sondern man schien es sogar mit einer gewissen Besorgnis zu verfolgen. Es handelte sich wahrscheinlich um Trak-
tate, die dem kirchlichen Dogma zuwiderliefen und mit Bildern illustriert waren. Acht Tage nach diesem ersten Erlaß
lehnte der Rat (am 18. Februar) abermals »seine fantasey« ab und will ihm um keinen Preis »mit zerung oder in
ander weg dartzu helfen«.
Er scheint aber eine harte Natur gewesen zu sein, von seiner Idee besessen, die er um jeden Preis durchsetzen
wollte. Denn am 24. April 1534, also ein Jahr später, schenkt ihm der Rat dennoch 10 Gulden umb seine flgum, die
man zu ains rats handen nemen soll«.
Dieses Zugeständnis scheint ihn zu weitergehenden Unternehmungen angeeifert zu haben. Denn schon im
nächsten Jahre findet es der Rat für nötig, sich auf das entschiedenste gegen ihn auszusprechen. In einem Verlaß vom
19. Februar 1535 heißt es: »N. Lautensack unnd sein gesellen zu beschicken, mit ime handien zu lassen, von seim
furnemen abzusteen, und anzuzeigen, wo ers nit thun würd, das Meine Herren ine alhie nit gedulden werden-.
Wahrscheinlich hatte Paul ein neuerliches Werk verfaßt, das in seiner antidogmatischen Tendenz um Beträchtliches
weiterging, so daß sein Gehaben als gefährlich erscheinen mußte. Die drohende Stellung des Rates hat ihn vielleicht
bewogen, von einer Unterstützung durch die Stadt abzusehen, jedenfalls finden die amtlichen Aufzeichnungen durch
volle vier Jahre keinen Anlaß, sich mit ihm zu beschäftigen. Was er auf offiziellem Wege nicht erreichen konnte, suchte
er nun auf privatem durchzusetzen, indem er sein »Bildbüchlein« wahrscheinlich auf eigene Kosten drucken ließ und
auf dem Wege des Handels unter die Leute brachte. Denn endlich muß sich der Rat auch mit dieser Art, religiöse
Aufklärung zu betreiben, beschäftigen und gebietet ihm am 9. Jänner 1539 »bey einer leipstraf, sein bildpüchlein
weiter under die leut nit außzupraiten, noch feil zu haben, oder, wo nit, werd man im der stat verweisen«.
Hier enden die amtlichen Aufzeichnungen über Paul Lautensacks seltsame Tätigkeit. Aus einer andern Quelle,
aus den in der Stadtbibliothek aufliegenden handschriftlichen Genealogica, erfahren wir Näheres über die Art seiner
Bestrebungen, Kämpfe und über die endliche Austreibung aus der Stadt, Rückkehr und weiteres Leben. Vor allem hat
er in diesen Jahren sein Hauptwerk, die »Offenbarung Jesu Christi», veröffentlicht, das in der Originalausgabe zwar
nicht mehr aufzutreiben ist, aber im Jahre IG 19 neu herausgegeben wurde, mit einer Erläuterung von Weigeli. Der
vollständige Titel dieser Neuausgabe lautet:
Offenbahrung Jesu Christi: Das ist: Ein Beweiß durch den Titul ober das Creutz Jesu Christi und die drey
Alphabeth: als Hebreisch, Graegisch und Lateinisch, wie auch etliche wunderbahre Figuren. Welcher gestalt der
einige Gott auff unterschiedene Arth und weiß und endtlich ohne einige Figur warhafftig und vollkömlich in der Person
Jesu Christi sich geoffenbahret habe. Durch den Gottsäligen Paulum Lautensack Mahlern und Organisten weilandt in
Nürnberg. Ober welche umb völligers Verstandts willen die Auslegung M. V. Weigelis herzu gesetzt worden. Darinn
zu finden, wie der Mensch mit Gott Himmel, und Erden durch das Wort, welches am Endt der Welt fleisch worden, in
einem thon gehn und daß teufeis dissonans verhütet werde. Franckfurt am Mayn bey Lucas Jennis zu finden. Im
Jahr 1619.
Es handelt sich also um einen jener religiösen Versuche, in denen alphabetische, arithmetische und geometrische
Spielereien, mystische Halluzinationen und geklügelte Bibelauslegungen zusammen komponiert werden, um einen alten
oder neuen Glaubenssatz zu beweisen oder zu bekämpfen. Tatsächlich finden wir auch bei diesem Werk, das in
lateinischer Sprache verfaßt ist, den Text von geometrischen Zeichnungen und unerklärlichen Buchstabenkombinationen
durchsetzt. Eine solche Unternehmung konnte in Nürnberg, das im XVI. Jahrhundert seinem Protestantismus ebenso
philiströs treu war wie im XV. seinem Katholizismus und das noch immer von jedem sich wissenschaftlich gebenden
Werk einen Umsturz seiner beruhigten Gesichertheit fürchtete, nur Anstoß erregen. Es ist nicht ausgeschlossen, ja, es ist
sogar anzunehmen, daß es sich bei dem in den Ratsverlässen genannten »Bildbüchlein■• um dieses Werk handelt.
Lfm ungefähr dieselbe Zeit hatte Lautensack eine andere Affäre dieser Art durchzukämpfen. Eine Dame, die
Gundelfingerin genannt wird, hatte bei ihm ein religiöses Bild bestellt, das er auch verfertigt, zur rechten Zeit geliefert
und in ihrem Haus aufgestellt hat. Wir erfahren leider nichts Näheres darüber, was darauf dargestellt war. Nachdem
es aber ehrbaren Leuten verächtlich und unverständlich erschien (ich bediene mich soviel als möglich des Textes der
Genealogica), hat es die Gundelfingerin als Phantasey bezeichnet und wollte dem Künstler scheinbar nicht zahlen.
In einer schriftlichen Rechtfertigung aber behauptet Lautensack, eine Offenbarung erhalten zu haben, die ihn anwies,
das reine Gesicht Gottes zu offenbaren. Gott habe ihm sonderlich die Gnad und Gabe verliehen, das einzige Bildnis
Christi durch eine innerliche Erkenntnis zu offenbaren, dazu habe er ihm auch ein wahrhaftiges Zeichen von oben
gezeigt. Und er beruft sich sogar auf Melanchthon als Protektor seiner Arbeit: