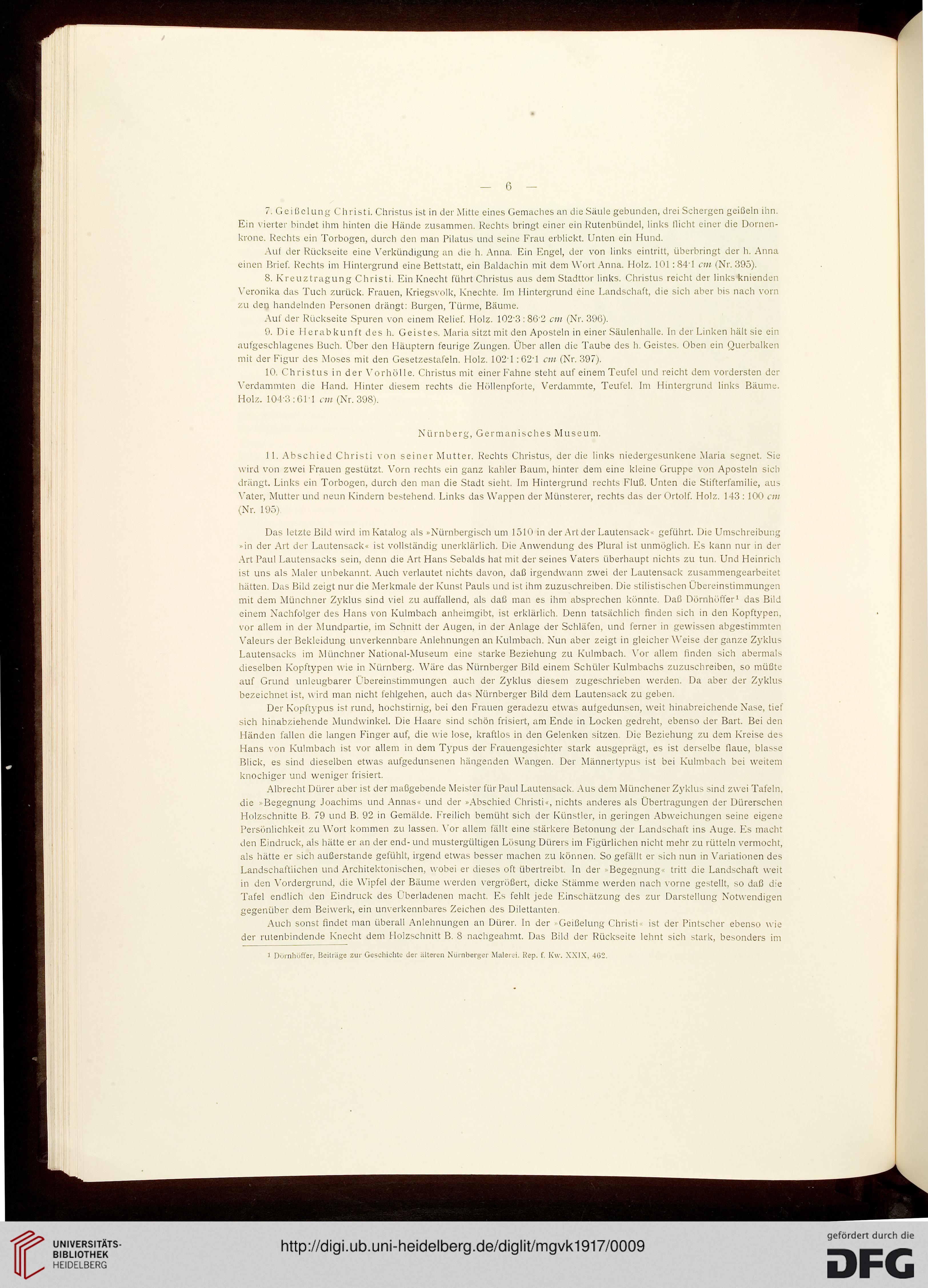MHH|HM |M
- 6 —
7. Geißelung Christi. Christus ist in der .Mitte eines Gemaches an die Säule gebunden, drei Schergen geißein ihn.
Ein vierter bindet ihm hinten die Hände zusammen. Rechts bringt einer ein Rutenbündel, links flicht einer die Dornen-
krone. Rechts ein Torbogen, durch den man Pilatus und seine Frau erblickt. Unten ein Hund.
Auf der Rückseite eine Verkündigung an die h. Anna. Ein Engel, der von links eintritt, überbringt der h. Anna
einen Brief. Rechts im Hintergrund eine Bettstatt, ein Baldachin mit dem Wort Anna. Holz. 101 :84'1 cm ("Nr. 395).
S. Kreuztragung Christi. Ein Knecht führt Christus aus dem Stadttor links. Christus reicht der links knienden
Veronika das Tuch zurück. Frauen, Kriegsvolk, Knechte. Im Hintergrund eine Landschaft, die sich aber bis nach vorn
zu den handelnden Personen drängt: Burgen, Türme, Bäume.
Aul der Ruckseite Spuren von einem Relief. Holz. 102'3: 8G'2 cm (Nr. 396).
9. Die Herabkunft des h. Geistes. Maria sitzt mit den Aposteln in einer Säulenhalle. In der Linken hält sie ein
aufgeschlagenes Buch. Über den Häuptern feurige Zungen. Über allen die Taube des h. Geistes. Oben ein Querbalken
mit der Figur des Moses mit den Gesetzestafeln. Holz. 102-1 : 62'1 cm (Nr. 397).
10. Christus in der Vorhölle. Christus mit einer Fahne steht auf einem Teufel und reicht dem vordersten der
Verdammten die Hand. Hinter diesem rechts die Höllenpforte, Verdammte, Teufel. Im Hintergrund links Bäume.
Holz. 104-3 :61-1 cm (Nr. 398).
Nürnberg, Germanisches Museum.
11. Abschied Christi von seiner Mutter. Rechts Christus, der die links niedergesunkene Maria segnet. Sie
wird von zwei Frauen gestützt. Vorn rechts ein ganz kahler Baum, hinter dem eine kleine Gruppe von Aposteln sich
drängt. Links ein Torbogen, durch den man die Stadt sieht. Im Hintergrund rechts Fluß. Unten die Stifterfamilie, aus
Vater, Mutter und neun Kindern bestehend. Links das Wappen der Münsterer, rechts das der Ortolf. Holz. 143 : 100 cm
(Nr. 195)
Das letzte Bild wird im Katalog als »Nürnbergisch um 1510 in der Art der Lautensack•< geführt. Die Umschreibung
»in der Art der Lautensack« ist vollständig unerklärlich. Die Anwendung des Plural ist unmöglich. Es kann nur in der
Art Paul Lautensacks sein, denn die Art Hans Sebalds hat mit der seines Vaters überhaupt nichts zu tun. Und Heinrich
ist uns als Maler unbekannt. Auch verlautet nichts davon, daß irgendwann zwei der Lautensack zusammengearbeitet
hätten. Das Bild zeigt nur die Merkmale der Kunst Pauls und ist ihm zuzuschreiben. Die stilistischen Übereinstimmungen
mit dem Münchner Zyklus sind viel zu auffallend, als daß man es ihm absprechen könnte. Daß Dörnhöffer1 das Bild
einem Nachfolger des Hans von Kulmbach anheimgibt, ist erklärlich. Denn tatsächlich finden sich in den Kopftypen,
vor allem in der Mundpartie, im Schnitt der Augen, in der Anlage der Schläfen, und ferner in gewissen abgestimmten
Valeurs der Bekleidung unverkennbare Anlehnungen an Kulmbach. Nun aber zeigt in gleicher Weise der ganze Zyklus
Lautensacks im Münchner National-Museum eine starke Beziehung zu Kulmbach. Vor allem finden sich abermals
dieselben Kopftypen wie in Nürnberg. Wäre das Nürnberger Bild einem Schüler Kulmbachs zuzuschreiben, so müßte
auf Grund unleugbarer Übereinstimmungen auch der Zyklus diesem zugeschrieben werden. Da aber der Zyklus
bezeichnet ist, wird man nicht fehlgehen, auch das Nürnberger Bild dem Lautensack zu geben.
Der Kopftypus ist rund, hochstirnig, bei den Frauen geradezu etwas aufgedunsen, weit hinabreichende Nase, tief
sich hinabziehende Mundwinkel. Die Haare sind schön frisiert, am Ende in Locken gedreht, ebenso der Bart. Bei den
Händen fallen die langen Finger auf, die wie lose, kraftlos in den Gelenken sitzen. Die Beziehung zu dem Kreise des
Hans von Kulmbach ist vor allem in dem Typus der Frauengesichter stark ausgeprägt, es ist derselbe flaue, blasse
Blick, es sind dieselben etwas aufgedunsenen hängenden Wangen. Der Männertypus ist bei Kulmbach bei weitem
knochiger und weniger frisiert.
Albrecht Dürer aber ist der maßgebende Meister für Paul Lautensack. Aus dem Münchener Zyklus sind zwei Tafeln,
die »Begegnung Joachims und Annas« und der »Abschied Christi«, nichts anderes als Übertragungen der Dürerschen
Holzschnitte B. 79 und B. 92 in Gemälde. Freilich bemüht sich der Künstler, in geringen Abweichungen seine eigene
Persönlichkeit zu Wort kommen zu lassen. Vor allem fällt eine stärkere Betonung der Landschaft ins Auge. Es macht
den Eindruck, als hätte er an der end- und mustergültigen Lösung Dürers im Figürlichen nicht mehr zu rütteln vermocht,
als hätte er sich außerstande gefühlt, irgend etwas besser machen zu können. So gefällt er sich nun in Variationen des
Landschaftlichen und Architektonischen, wobei er dieses oft übertreibt. In der »Begegnung- tritt die Landschaft weit
in Jen Vordergrund, die Wipfel der Bäume werden vergrößert, dicke Stämme werden nach vorne gestellt, so daß die
Tafel endlich den Eindruck des Überladenen macht. Es fehlt jede Einschätzung des zur Darstellung Notwendigen
gegenüber dem Beiwerk, ein unverkennbares Zeichen des Dilettanten.
Auch sonst findet man überall Anlehnungen an Dürer. In der Geißelung Christi ist der Pintscher ebenso wie
der rutenbindende Knecht dem Holzschnitt B. 8 nachgeahmt. Das Bild der Rückseite lehnt sich stark, besonders im
i Dörnhöffer, Beiträge zur Geschichte der alteren Nürnberger Malerei, Kep. f, K\v. XXIX, 462.
- 6 —
7. Geißelung Christi. Christus ist in der .Mitte eines Gemaches an die Säule gebunden, drei Schergen geißein ihn.
Ein vierter bindet ihm hinten die Hände zusammen. Rechts bringt einer ein Rutenbündel, links flicht einer die Dornen-
krone. Rechts ein Torbogen, durch den man Pilatus und seine Frau erblickt. Unten ein Hund.
Auf der Rückseite eine Verkündigung an die h. Anna. Ein Engel, der von links eintritt, überbringt der h. Anna
einen Brief. Rechts im Hintergrund eine Bettstatt, ein Baldachin mit dem Wort Anna. Holz. 101 :84'1 cm ("Nr. 395).
S. Kreuztragung Christi. Ein Knecht führt Christus aus dem Stadttor links. Christus reicht der links knienden
Veronika das Tuch zurück. Frauen, Kriegsvolk, Knechte. Im Hintergrund eine Landschaft, die sich aber bis nach vorn
zu den handelnden Personen drängt: Burgen, Türme, Bäume.
Aul der Ruckseite Spuren von einem Relief. Holz. 102'3: 8G'2 cm (Nr. 396).
9. Die Herabkunft des h. Geistes. Maria sitzt mit den Aposteln in einer Säulenhalle. In der Linken hält sie ein
aufgeschlagenes Buch. Über den Häuptern feurige Zungen. Über allen die Taube des h. Geistes. Oben ein Querbalken
mit der Figur des Moses mit den Gesetzestafeln. Holz. 102-1 : 62'1 cm (Nr. 397).
10. Christus in der Vorhölle. Christus mit einer Fahne steht auf einem Teufel und reicht dem vordersten der
Verdammten die Hand. Hinter diesem rechts die Höllenpforte, Verdammte, Teufel. Im Hintergrund links Bäume.
Holz. 104-3 :61-1 cm (Nr. 398).
Nürnberg, Germanisches Museum.
11. Abschied Christi von seiner Mutter. Rechts Christus, der die links niedergesunkene Maria segnet. Sie
wird von zwei Frauen gestützt. Vorn rechts ein ganz kahler Baum, hinter dem eine kleine Gruppe von Aposteln sich
drängt. Links ein Torbogen, durch den man die Stadt sieht. Im Hintergrund rechts Fluß. Unten die Stifterfamilie, aus
Vater, Mutter und neun Kindern bestehend. Links das Wappen der Münsterer, rechts das der Ortolf. Holz. 143 : 100 cm
(Nr. 195)
Das letzte Bild wird im Katalog als »Nürnbergisch um 1510 in der Art der Lautensack•< geführt. Die Umschreibung
»in der Art der Lautensack« ist vollständig unerklärlich. Die Anwendung des Plural ist unmöglich. Es kann nur in der
Art Paul Lautensacks sein, denn die Art Hans Sebalds hat mit der seines Vaters überhaupt nichts zu tun. Und Heinrich
ist uns als Maler unbekannt. Auch verlautet nichts davon, daß irgendwann zwei der Lautensack zusammengearbeitet
hätten. Das Bild zeigt nur die Merkmale der Kunst Pauls und ist ihm zuzuschreiben. Die stilistischen Übereinstimmungen
mit dem Münchner Zyklus sind viel zu auffallend, als daß man es ihm absprechen könnte. Daß Dörnhöffer1 das Bild
einem Nachfolger des Hans von Kulmbach anheimgibt, ist erklärlich. Denn tatsächlich finden sich in den Kopftypen,
vor allem in der Mundpartie, im Schnitt der Augen, in der Anlage der Schläfen, und ferner in gewissen abgestimmten
Valeurs der Bekleidung unverkennbare Anlehnungen an Kulmbach. Nun aber zeigt in gleicher Weise der ganze Zyklus
Lautensacks im Münchner National-Museum eine starke Beziehung zu Kulmbach. Vor allem finden sich abermals
dieselben Kopftypen wie in Nürnberg. Wäre das Nürnberger Bild einem Schüler Kulmbachs zuzuschreiben, so müßte
auf Grund unleugbarer Übereinstimmungen auch der Zyklus diesem zugeschrieben werden. Da aber der Zyklus
bezeichnet ist, wird man nicht fehlgehen, auch das Nürnberger Bild dem Lautensack zu geben.
Der Kopftypus ist rund, hochstirnig, bei den Frauen geradezu etwas aufgedunsen, weit hinabreichende Nase, tief
sich hinabziehende Mundwinkel. Die Haare sind schön frisiert, am Ende in Locken gedreht, ebenso der Bart. Bei den
Händen fallen die langen Finger auf, die wie lose, kraftlos in den Gelenken sitzen. Die Beziehung zu dem Kreise des
Hans von Kulmbach ist vor allem in dem Typus der Frauengesichter stark ausgeprägt, es ist derselbe flaue, blasse
Blick, es sind dieselben etwas aufgedunsenen hängenden Wangen. Der Männertypus ist bei Kulmbach bei weitem
knochiger und weniger frisiert.
Albrecht Dürer aber ist der maßgebende Meister für Paul Lautensack. Aus dem Münchener Zyklus sind zwei Tafeln,
die »Begegnung Joachims und Annas« und der »Abschied Christi«, nichts anderes als Übertragungen der Dürerschen
Holzschnitte B. 79 und B. 92 in Gemälde. Freilich bemüht sich der Künstler, in geringen Abweichungen seine eigene
Persönlichkeit zu Wort kommen zu lassen. Vor allem fällt eine stärkere Betonung der Landschaft ins Auge. Es macht
den Eindruck, als hätte er an der end- und mustergültigen Lösung Dürers im Figürlichen nicht mehr zu rütteln vermocht,
als hätte er sich außerstande gefühlt, irgend etwas besser machen zu können. So gefällt er sich nun in Variationen des
Landschaftlichen und Architektonischen, wobei er dieses oft übertreibt. In der »Begegnung- tritt die Landschaft weit
in Jen Vordergrund, die Wipfel der Bäume werden vergrößert, dicke Stämme werden nach vorne gestellt, so daß die
Tafel endlich den Eindruck des Überladenen macht. Es fehlt jede Einschätzung des zur Darstellung Notwendigen
gegenüber dem Beiwerk, ein unverkennbares Zeichen des Dilettanten.
Auch sonst findet man überall Anlehnungen an Dürer. In der Geißelung Christi ist der Pintscher ebenso wie
der rutenbindende Knecht dem Holzschnitt B. 8 nachgeahmt. Das Bild der Rückseite lehnt sich stark, besonders im
i Dörnhöffer, Beiträge zur Geschichte der alteren Nürnberger Malerei, Kep. f, K\v. XXIX, 462.