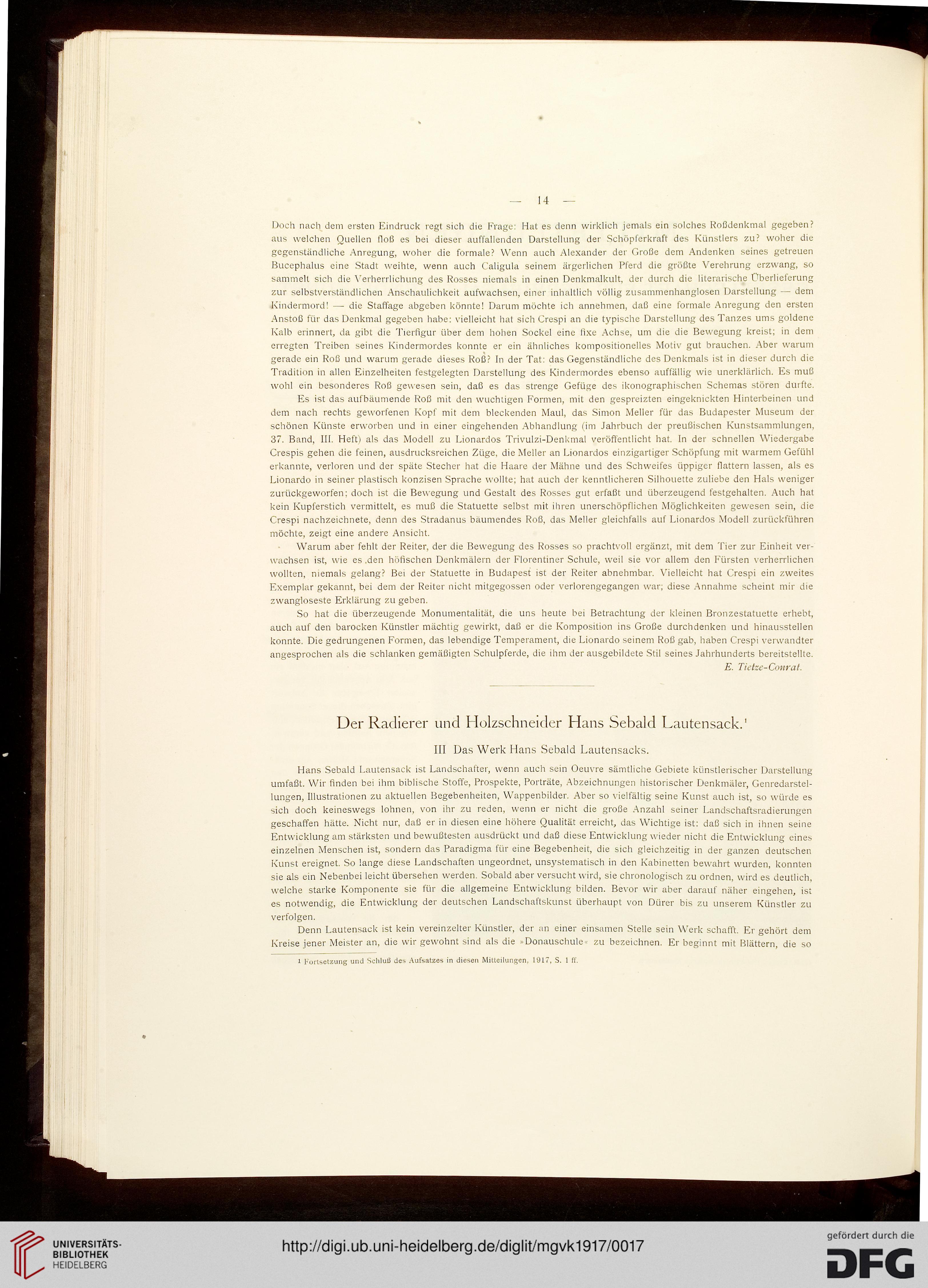— 14 —
Doch nach dem eisten Eindruck regt sich die Frage: Hat es denn wirklich jemals ein solches Roßdenkmal gegeben?
aus welchen Quellen floß es bei dieser auffallenden Darstellung der Schöpferkraft des Künstlers zu? woher die
gegenständliche Anregung, woher die formale? Wenn auch Alexander der Große dem Andenken seines getreuen
Bucephalus eine Stadt weihte, wenn auch Caligula seinem ärgerlichen Pferd die größte Verehrung erzwang, so
sammelt sich die Verherrlichung des Rosses niemals in einen Denkmalkult, der durch die literarische Überlieferung
zur selbstverständlichen Anschaulichkeit aufwachsen, einer inhaltlich völlig zusammenhanglosen Darstellung — dem
Kindermord! — die Staffage abgeben könnte! Darum möchte ich annehmen, daß eine formale Anregung den ersten
Anstoß für das Denkmal gegeben habe: vielleicht hat sich Crespi an die typische Darstellung des Tanzes ums goldene
Kalb erinnert, da gibt die Tierfigur über dem hohen Sockel eine fixe Achse, um die die Bewegung kreist; in dem
erregten Treiben seines Kindermordes konnte er ein ähnliches kompositionelles Motiv gut brauchen. Aber warum
gerade ein Roß und warum gerade dieses Roß? In der Tat: das Gegenständliche des Denkmals ist in dieser durch die
Tradition in allen Einzelheiten festgelegten Darstellung des Kindermordes ebenso auffällig wie unerklärlich. Es muß
wohl ein besonderes Roß gewesen sein, daß es das strenge Gefüge des ikonographischen Schemas stören durfte.
Es ist das aufbäumende Roß mit den wuchtigen Formen, mit den gespreizten eingeknickten Hinterbeinen und
dem nach rechts geworfenen Kopf mit dem bleckenden Maul, das Simon Meiler für das Budapester Museum der
schönen Künste erworben und in einer eingehenden Abhandlung (im Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen,
37. Band, III. Heft') als das Modell zu Lionardos Trivulzi-Denkmal veröffentlicht hat. In der schnellen Wiedergabe
Crespis gehen die feinen, ausdrucksreichen Züge, die Meiler an Lionardos einzigartiger Schöpfung mit warmem Gefühl
erkannte, verloren und der späte Stecher hat die Haare der Mähne und des Schweifes üppiger flattern lassen, als es
Lionardo in seiner plastisch konzisen Sprache wollte; hat auch der kenntlicheren Silhouette zuliebe den Hals weniger
zurückgeworfen: doch ist die Bewegung und Gestalt des Rosses gut erfaßt und überzeugend festgehalten. Auch hat
kein Kupferstich vermittelt, es muß die Statuette selbst mit ihren unerschöpflichen Möglichkeiten gewesen sein, die
Crespi nachzeichnete, denn des Stradanus bäumendes Roß, das Meiler gleichfalls auf Lionardos Modell zurückführen
möchte, zeigt eine andere Ansicht.
Warum aber fehlt der Reiter, der die Bewegung des Rosses so prachtvoll ergänzt, mit dem Tier zur Einheit ver-
wachsen ist, wie es .den höfischen Denkmälern der Florentiner Schule, weil sie vor allem den Fürsten verherrlichen
wollten, niemals gelang? Bei der Statuette in Budapest ist der Reiter abnehmbar. Vielleicht hat Crespi ein zweites
Exemplar gekannt, bei dem der Reiter nicht mitgegossen oder verlorengegangen war; diese Annahme scheint mir die
zwangloseste Erklärung zu geben.
So hat die überzeugende Monumentalität, die uns heute bei Betrachtung der kleinen Bronzestatuette erhebt,
auch auf den barocken Künstler mächtig gewirkt, daß er die Komposition ins Große durchdenken und hinausstellen
konnte. Die gedrungenen Formen, das lebendige Temperament, die Lionardo seinem Roß gab, haben Crespi verwandter
angesprochen als die schlanken gemäßigten Schulpferde, die ihm der ausgebildete Stil seines Jahrhunderts bereitstellte.
E. Tietze-Conrat.
Der Radierer und Holzschneider Hans Sebald Lautensack.
III Das Werk Hans Sebald Lautensacks.
Hans Sebald Lautensack ist Landschafter, wenn auch sein Oeuvre sämtliche Gebiete künstlerischer Darstellung
umfaßt. Wir finden bei ihm biblische Stoffe, Prospekte, Porträte, Abzeichnungen historischer Denkmäler, Genredarstel-
lungen, Illustrationen zu aktuellen Begebenheiten, Wappenbilder. Aber so vielfältig seine Kunst auch ist, so würde es
sich doch keineswegs lohnen, von ihr zu reden, wenn er nicht die große Anzahl seiner Landschaftsradierungen
geschaffen hätte. Nicht nur, daß er in diesen eine höhere Qualität erreicht, das Wichtige ist: daß sich in ihnen seine
Entwicklung am stärksten und bewußtesten ausdrückt und daß diese Entwicklung wieder nicht die Entwicklung eines
einzelnen Menschen ist, sondern das Paradigma für eine Begebenheit, die sich gleichzeitig in der ganzen deutschen
Kunst ereignet. So lange diese Landschaften ungeordnet, unsystematisch in den Kabinetten bewahrt wurden, konnten
sie als ein Nebenbei leicht übersehen werden. Sobald aber versucht wird, sie chronologisch zu ordnen, wird es deutlich,
welche starke Komponente sie für die allgemeine Entwicklung bilden. Bevor wir aber darauf näher eingehen, ist
es notwendig, die Entwicklung der deutschen Landschaftskunst überhaupt von Dürer bis zu unserem Künstler zu
verfolgen.
Denn Lautensack ist kein vereinzelter Künstler, der an einer einsamen Stelle sein Werk schafft. Er gehört dem
Kreise jener Meister an, die wir gewohnt sind als die »-Donauschule i zu bezeichnen. Er beginnt mit Blättern, die so
1 Forlsetzung und Schluß des Aufsatzes in diesen Mitteilungen, 1917, S. 1 ff.
Doch nach dem eisten Eindruck regt sich die Frage: Hat es denn wirklich jemals ein solches Roßdenkmal gegeben?
aus welchen Quellen floß es bei dieser auffallenden Darstellung der Schöpferkraft des Künstlers zu? woher die
gegenständliche Anregung, woher die formale? Wenn auch Alexander der Große dem Andenken seines getreuen
Bucephalus eine Stadt weihte, wenn auch Caligula seinem ärgerlichen Pferd die größte Verehrung erzwang, so
sammelt sich die Verherrlichung des Rosses niemals in einen Denkmalkult, der durch die literarische Überlieferung
zur selbstverständlichen Anschaulichkeit aufwachsen, einer inhaltlich völlig zusammenhanglosen Darstellung — dem
Kindermord! — die Staffage abgeben könnte! Darum möchte ich annehmen, daß eine formale Anregung den ersten
Anstoß für das Denkmal gegeben habe: vielleicht hat sich Crespi an die typische Darstellung des Tanzes ums goldene
Kalb erinnert, da gibt die Tierfigur über dem hohen Sockel eine fixe Achse, um die die Bewegung kreist; in dem
erregten Treiben seines Kindermordes konnte er ein ähnliches kompositionelles Motiv gut brauchen. Aber warum
gerade ein Roß und warum gerade dieses Roß? In der Tat: das Gegenständliche des Denkmals ist in dieser durch die
Tradition in allen Einzelheiten festgelegten Darstellung des Kindermordes ebenso auffällig wie unerklärlich. Es muß
wohl ein besonderes Roß gewesen sein, daß es das strenge Gefüge des ikonographischen Schemas stören durfte.
Es ist das aufbäumende Roß mit den wuchtigen Formen, mit den gespreizten eingeknickten Hinterbeinen und
dem nach rechts geworfenen Kopf mit dem bleckenden Maul, das Simon Meiler für das Budapester Museum der
schönen Künste erworben und in einer eingehenden Abhandlung (im Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen,
37. Band, III. Heft') als das Modell zu Lionardos Trivulzi-Denkmal veröffentlicht hat. In der schnellen Wiedergabe
Crespis gehen die feinen, ausdrucksreichen Züge, die Meiler an Lionardos einzigartiger Schöpfung mit warmem Gefühl
erkannte, verloren und der späte Stecher hat die Haare der Mähne und des Schweifes üppiger flattern lassen, als es
Lionardo in seiner plastisch konzisen Sprache wollte; hat auch der kenntlicheren Silhouette zuliebe den Hals weniger
zurückgeworfen: doch ist die Bewegung und Gestalt des Rosses gut erfaßt und überzeugend festgehalten. Auch hat
kein Kupferstich vermittelt, es muß die Statuette selbst mit ihren unerschöpflichen Möglichkeiten gewesen sein, die
Crespi nachzeichnete, denn des Stradanus bäumendes Roß, das Meiler gleichfalls auf Lionardos Modell zurückführen
möchte, zeigt eine andere Ansicht.
Warum aber fehlt der Reiter, der die Bewegung des Rosses so prachtvoll ergänzt, mit dem Tier zur Einheit ver-
wachsen ist, wie es .den höfischen Denkmälern der Florentiner Schule, weil sie vor allem den Fürsten verherrlichen
wollten, niemals gelang? Bei der Statuette in Budapest ist der Reiter abnehmbar. Vielleicht hat Crespi ein zweites
Exemplar gekannt, bei dem der Reiter nicht mitgegossen oder verlorengegangen war; diese Annahme scheint mir die
zwangloseste Erklärung zu geben.
So hat die überzeugende Monumentalität, die uns heute bei Betrachtung der kleinen Bronzestatuette erhebt,
auch auf den barocken Künstler mächtig gewirkt, daß er die Komposition ins Große durchdenken und hinausstellen
konnte. Die gedrungenen Formen, das lebendige Temperament, die Lionardo seinem Roß gab, haben Crespi verwandter
angesprochen als die schlanken gemäßigten Schulpferde, die ihm der ausgebildete Stil seines Jahrhunderts bereitstellte.
E. Tietze-Conrat.
Der Radierer und Holzschneider Hans Sebald Lautensack.
III Das Werk Hans Sebald Lautensacks.
Hans Sebald Lautensack ist Landschafter, wenn auch sein Oeuvre sämtliche Gebiete künstlerischer Darstellung
umfaßt. Wir finden bei ihm biblische Stoffe, Prospekte, Porträte, Abzeichnungen historischer Denkmäler, Genredarstel-
lungen, Illustrationen zu aktuellen Begebenheiten, Wappenbilder. Aber so vielfältig seine Kunst auch ist, so würde es
sich doch keineswegs lohnen, von ihr zu reden, wenn er nicht die große Anzahl seiner Landschaftsradierungen
geschaffen hätte. Nicht nur, daß er in diesen eine höhere Qualität erreicht, das Wichtige ist: daß sich in ihnen seine
Entwicklung am stärksten und bewußtesten ausdrückt und daß diese Entwicklung wieder nicht die Entwicklung eines
einzelnen Menschen ist, sondern das Paradigma für eine Begebenheit, die sich gleichzeitig in der ganzen deutschen
Kunst ereignet. So lange diese Landschaften ungeordnet, unsystematisch in den Kabinetten bewahrt wurden, konnten
sie als ein Nebenbei leicht übersehen werden. Sobald aber versucht wird, sie chronologisch zu ordnen, wird es deutlich,
welche starke Komponente sie für die allgemeine Entwicklung bilden. Bevor wir aber darauf näher eingehen, ist
es notwendig, die Entwicklung der deutschen Landschaftskunst überhaupt von Dürer bis zu unserem Künstler zu
verfolgen.
Denn Lautensack ist kein vereinzelter Künstler, der an einer einsamen Stelle sein Werk schafft. Er gehört dem
Kreise jener Meister an, die wir gewohnt sind als die »-Donauschule i zu bezeichnen. Er beginnt mit Blättern, die so
1 Forlsetzung und Schluß des Aufsatzes in diesen Mitteilungen, 1917, S. 1 ff.