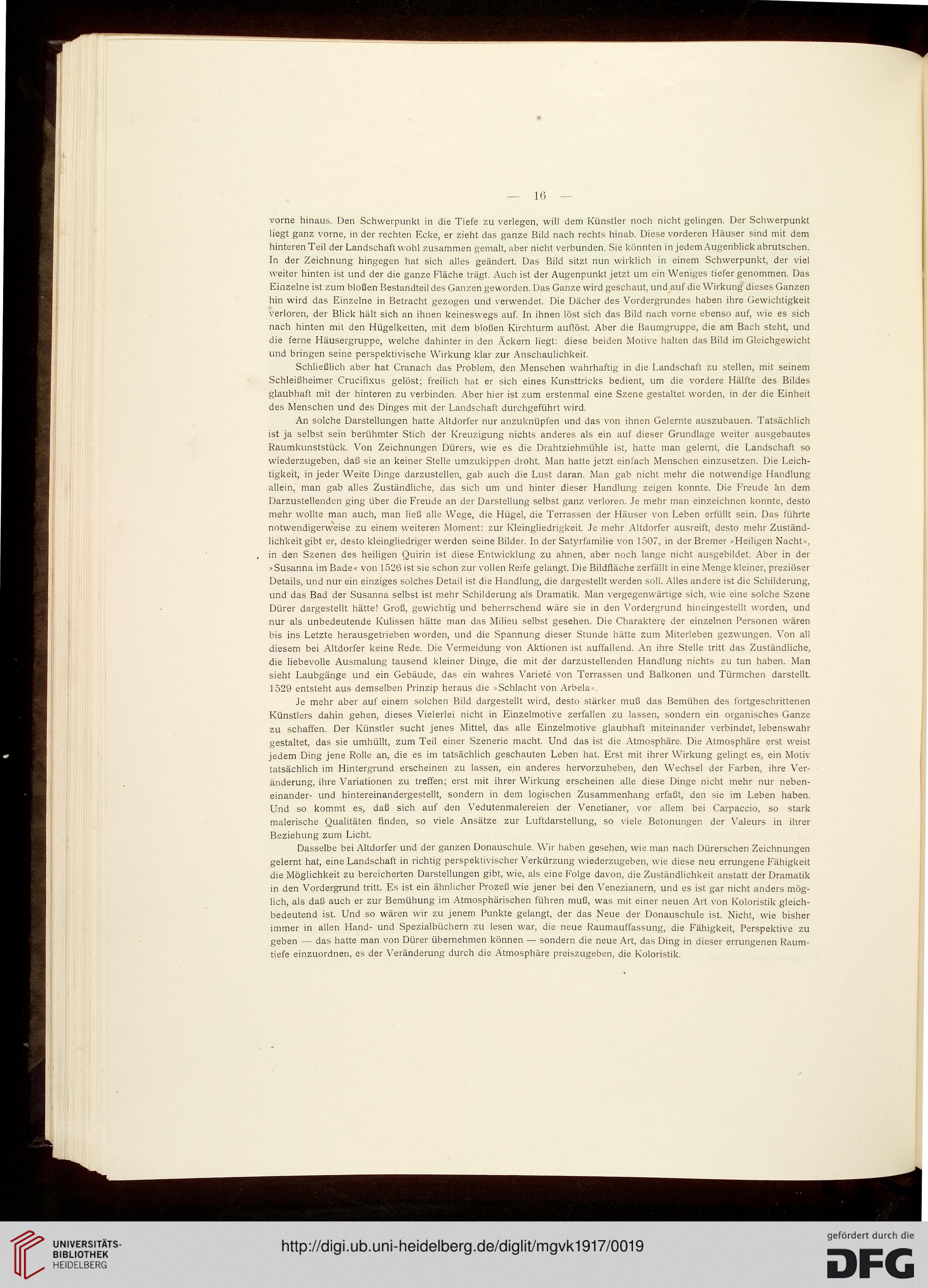16
vorne hinaus. Den Schwerpunkt in die Tiefe zu verlegen, will dem Künstler noch nicht gelingen. Der Schwerpunkt
liegt ganz vorne, in der rechten Ecke, er zieht das ganze Bild nach rechts hinab. Diese vorderen Häuser sind mit dem
hinteren Teil der Landschaft wohl zusammen gemalt, aber nicht verbunden. Sie könnten in jedem Augenblick abrutschen.
In der Zeichnung hingegen hat sich alles geändert. Das Bild sitzt nun wirklich in einem Schwerpunkt, der viel
weiter hinten ist und der die ganze Fläche trägt. Auch ist der Augenpunkt jetzt um ein Weniges tiefer genommen. Das
Einzelne ist zum bloßen Bestandteil des Ganzen geworden. Das Ganze wird geschaut, und auf die Wirkung dieses Ganzen
hin wird das Einzelne in Betracht gezogen und verwendet. Die Dächer des Vordergrundes haben ihre Gewichtigkeit
verloren, der Blick hält sich an ihnen keineswegs auf. In ihnen löst sich das Bild nach vorne ebenso auf, wie es sich
nach hinten mit den Hügelketten, mit dem bloßen Kirchturm auflöst. Aber die Baumgruppe, die am Bach steht, und
die ferne Häusergruppe, welche dahinter in den Ackern liegt: diese beiden Motive halten das Bild im Gleichgewicht
und bringen seine perspektivische Wirkung klar zur Anschaulichkeit.
Schließlich aber hat Cranach das Problem, den Menschen wahrhaftig in die Landschaft zu stellen, mit seinem
Schleißheimer Crucifixus gelöst; freilich hat er sich eines Kunsttricks bedient, um die vordere Hälfte des Bildes
glaubhaft mit der hinteren zu verbinden. Aber hier ist zum erstenmal eine Szene gestaltet worden, in der die Einheit
des Menschen und des Dinges mit der Landschaft durchgeführt wird.
An solche Darstellungen hatte Altdorfer nur anzuknüpfen und das von ihnen Gelernte auszubauen. Tatsächlich
ist ja selbst sein berühmter Stich der Kreuzigung nichts anderes als ein auf dieser Grundlage weiter ausgebautes
Raumkunststück. Von Zeichnungen Dürers, wie es die Drahtziehmühle ist, hatte man gelernt, die Landschaft so
wiederzugeben, daß sie an keiner Stelle umzukippen droht. Man hatte jetzt einfach Menschen einzusetzen. Die Leich-
tigkeit, in jeder Weite Dinge darzustellen, gab auch die Lust daran. Man gab nicht mehr die notwendige Handlung
allein, man gab alles Zuständliche, das sich um und hinter dieser Handlung zeigen konnte. Die Freude an dem
Darzustellenden ging über die Freude an der Darstellung selbst ganz verloren. Je mehr man einzeichnen konnte, desto
mehr wollte man auch, man ließ alle Wege, die Hügel, die Terrassen der Häuser von Leben erfüllt sein. Das führte
notwendigerweise zu einem weiteren Moment: zur Kleingliedrigkeit. Je mehr Altdorfer ausreift, desto mehr Zuständ-
igkeit gibt er, desto kleingliedriger werden seine Bilder. In der Satyrfamilie von 1507, in der Bremer »Heiligen Nacht«,
in den Szenen des heiligen Quirin ist diese Entwicklung zu ahnen, aber noch lange nicht ausgebildet. Aber in der
»Susanna im Bade« von 1526 ist sie schon zur vollen Reife gelangt. Die Bildfläche zerfällt in eine Menge kleiner, preziöser
Details, und nur ein einziges solches Detail ist die Handlung, die dargestellt werden soll. Alles andere ist die Schilderung,
und das Bad der Susanna selbst ist mehr Schilderung als Dramatik. Man vergegenwärtige sich, wie eine solche Szene
Dürer dargestellt hätte! Groß, gewichtig und beherrschend wäre sie in den Vordergrund hineingestellt worden, und
nur als unbedeutende Kulissen hätte man das Milieu selbst gesehen. Die Charaktere der einzelnen Personen wären
bis ins Letzte herausgetrieben worden, und die Spannung dieser Stunde hätte zum Miterleben gezwungen. Von all
diesem bei Altdorfer keine Rede. Die Vermeidung von Aktionen ist auffallend. An ihre Stelle tritt das Zuständliche,
die liebevolle Ausmalung tausend kleiner Dinge, die mit der darzustellenden Handlung nichts zu tun haben. Man
sieht Laubgänge und ein Gebäude, das ein wahres Variete von Terrassen und Baikonen und Türmchen darstellt.
1529 entsteht aus demselben Prinzip heraus die »Schlacht von Arbela-,
Je mehr aber auf einem solchen Bild dargestellt wird, desto stärker muß das Bemühen des fortgeschrittenen
Künstlers dahin gehen, dieses Vielerlei nicht in Einzelmotive zerfallen zu lassen, sondern ein organisches Ganze
zu schaffen. Der Künstler sucht jenes Mittel, das alle Einzelmotive glaubhaft miteinander verbindet, lebenswahr
gestaltet, das sie umhüllt, zum Teil einer Szenerie macht. Und das ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre erst weist
jedem Ding jene Rolle an, die es im tatsächlich geschauten Leben hat. Erst mit ihrer Wirkung gelingt es, ein Motiv
tatsächlich im Hintergrund erscheinen zu lassen, ein anderes hervorzuheben, den Wechsel der Farben, ihre Ver-
änderung, ihre Variationen zu treffen; erst mit ihrer Wirkung erscheinen alle diese Dinge nicht mehr nur neben-
einander- und hintereinandergestellt, sondern in dem logischen Zusammenhang erfaßt, den sie im Leben haben.
Und so kommt es, daß sich auf den Vedutenmalereien der Venetianer, vor allem bei Carpaccio, so stark
malerische Qualitäten finden, so viele Ansätze zur Luftdarstellung, so viele Betonungen der Valeurs in ihrer
Beziehung zum Licht.
Dasselbe bei Altdorfer und der ganzen Donauschule. Wir haben gesehen, wie man nach Dürerschen Zeichnungen
gelernt hat, eine Landschaft in richtig perspektivischer Verkürzung wiederzugeben, wie diese neu errungene Fähigkeit
die Möglichkeit zu bereicherten Darstellungen gibt, wie, als eine Folge davon, die Zuständigkeit anstatt der Dramatik
in den Vordergrund tritt. Es ist ein ähnlicher Prozeß wie jener bei den Venezianern, und es ist gar nicht anders mög-
lich, als daß auch er zur Bemühung im Atmosphärischen führen muß, was mit einer neuen Art von Koloristik gleich-
bedeutend ist. Und so wären wir zu jenem Punkte gelangt, der das Neue der Donauschule ist. Nicht, wie bisher
immer in allen Hand- und Spezialbüchern zu lesen war, die neue Raumauffassung, die Fähigkeit, Perspektive zu
geben — das hatte man von Dürer übernehmen können — sondern die neue Art, das Ding in dieser errungenen Raum-
tiefe einzuordnen, es der Veränderung durch die Atmosphäre preiszugeben, die Koloristik.
vorne hinaus. Den Schwerpunkt in die Tiefe zu verlegen, will dem Künstler noch nicht gelingen. Der Schwerpunkt
liegt ganz vorne, in der rechten Ecke, er zieht das ganze Bild nach rechts hinab. Diese vorderen Häuser sind mit dem
hinteren Teil der Landschaft wohl zusammen gemalt, aber nicht verbunden. Sie könnten in jedem Augenblick abrutschen.
In der Zeichnung hingegen hat sich alles geändert. Das Bild sitzt nun wirklich in einem Schwerpunkt, der viel
weiter hinten ist und der die ganze Fläche trägt. Auch ist der Augenpunkt jetzt um ein Weniges tiefer genommen. Das
Einzelne ist zum bloßen Bestandteil des Ganzen geworden. Das Ganze wird geschaut, und auf die Wirkung dieses Ganzen
hin wird das Einzelne in Betracht gezogen und verwendet. Die Dächer des Vordergrundes haben ihre Gewichtigkeit
verloren, der Blick hält sich an ihnen keineswegs auf. In ihnen löst sich das Bild nach vorne ebenso auf, wie es sich
nach hinten mit den Hügelketten, mit dem bloßen Kirchturm auflöst. Aber die Baumgruppe, die am Bach steht, und
die ferne Häusergruppe, welche dahinter in den Ackern liegt: diese beiden Motive halten das Bild im Gleichgewicht
und bringen seine perspektivische Wirkung klar zur Anschaulichkeit.
Schließlich aber hat Cranach das Problem, den Menschen wahrhaftig in die Landschaft zu stellen, mit seinem
Schleißheimer Crucifixus gelöst; freilich hat er sich eines Kunsttricks bedient, um die vordere Hälfte des Bildes
glaubhaft mit der hinteren zu verbinden. Aber hier ist zum erstenmal eine Szene gestaltet worden, in der die Einheit
des Menschen und des Dinges mit der Landschaft durchgeführt wird.
An solche Darstellungen hatte Altdorfer nur anzuknüpfen und das von ihnen Gelernte auszubauen. Tatsächlich
ist ja selbst sein berühmter Stich der Kreuzigung nichts anderes als ein auf dieser Grundlage weiter ausgebautes
Raumkunststück. Von Zeichnungen Dürers, wie es die Drahtziehmühle ist, hatte man gelernt, die Landschaft so
wiederzugeben, daß sie an keiner Stelle umzukippen droht. Man hatte jetzt einfach Menschen einzusetzen. Die Leich-
tigkeit, in jeder Weite Dinge darzustellen, gab auch die Lust daran. Man gab nicht mehr die notwendige Handlung
allein, man gab alles Zuständliche, das sich um und hinter dieser Handlung zeigen konnte. Die Freude an dem
Darzustellenden ging über die Freude an der Darstellung selbst ganz verloren. Je mehr man einzeichnen konnte, desto
mehr wollte man auch, man ließ alle Wege, die Hügel, die Terrassen der Häuser von Leben erfüllt sein. Das führte
notwendigerweise zu einem weiteren Moment: zur Kleingliedrigkeit. Je mehr Altdorfer ausreift, desto mehr Zuständ-
igkeit gibt er, desto kleingliedriger werden seine Bilder. In der Satyrfamilie von 1507, in der Bremer »Heiligen Nacht«,
in den Szenen des heiligen Quirin ist diese Entwicklung zu ahnen, aber noch lange nicht ausgebildet. Aber in der
»Susanna im Bade« von 1526 ist sie schon zur vollen Reife gelangt. Die Bildfläche zerfällt in eine Menge kleiner, preziöser
Details, und nur ein einziges solches Detail ist die Handlung, die dargestellt werden soll. Alles andere ist die Schilderung,
und das Bad der Susanna selbst ist mehr Schilderung als Dramatik. Man vergegenwärtige sich, wie eine solche Szene
Dürer dargestellt hätte! Groß, gewichtig und beherrschend wäre sie in den Vordergrund hineingestellt worden, und
nur als unbedeutende Kulissen hätte man das Milieu selbst gesehen. Die Charaktere der einzelnen Personen wären
bis ins Letzte herausgetrieben worden, und die Spannung dieser Stunde hätte zum Miterleben gezwungen. Von all
diesem bei Altdorfer keine Rede. Die Vermeidung von Aktionen ist auffallend. An ihre Stelle tritt das Zuständliche,
die liebevolle Ausmalung tausend kleiner Dinge, die mit der darzustellenden Handlung nichts zu tun haben. Man
sieht Laubgänge und ein Gebäude, das ein wahres Variete von Terrassen und Baikonen und Türmchen darstellt.
1529 entsteht aus demselben Prinzip heraus die »Schlacht von Arbela-,
Je mehr aber auf einem solchen Bild dargestellt wird, desto stärker muß das Bemühen des fortgeschrittenen
Künstlers dahin gehen, dieses Vielerlei nicht in Einzelmotive zerfallen zu lassen, sondern ein organisches Ganze
zu schaffen. Der Künstler sucht jenes Mittel, das alle Einzelmotive glaubhaft miteinander verbindet, lebenswahr
gestaltet, das sie umhüllt, zum Teil einer Szenerie macht. Und das ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre erst weist
jedem Ding jene Rolle an, die es im tatsächlich geschauten Leben hat. Erst mit ihrer Wirkung gelingt es, ein Motiv
tatsächlich im Hintergrund erscheinen zu lassen, ein anderes hervorzuheben, den Wechsel der Farben, ihre Ver-
änderung, ihre Variationen zu treffen; erst mit ihrer Wirkung erscheinen alle diese Dinge nicht mehr nur neben-
einander- und hintereinandergestellt, sondern in dem logischen Zusammenhang erfaßt, den sie im Leben haben.
Und so kommt es, daß sich auf den Vedutenmalereien der Venetianer, vor allem bei Carpaccio, so stark
malerische Qualitäten finden, so viele Ansätze zur Luftdarstellung, so viele Betonungen der Valeurs in ihrer
Beziehung zum Licht.
Dasselbe bei Altdorfer und der ganzen Donauschule. Wir haben gesehen, wie man nach Dürerschen Zeichnungen
gelernt hat, eine Landschaft in richtig perspektivischer Verkürzung wiederzugeben, wie diese neu errungene Fähigkeit
die Möglichkeit zu bereicherten Darstellungen gibt, wie, als eine Folge davon, die Zuständigkeit anstatt der Dramatik
in den Vordergrund tritt. Es ist ein ähnlicher Prozeß wie jener bei den Venezianern, und es ist gar nicht anders mög-
lich, als daß auch er zur Bemühung im Atmosphärischen führen muß, was mit einer neuen Art von Koloristik gleich-
bedeutend ist. Und so wären wir zu jenem Punkte gelangt, der das Neue der Donauschule ist. Nicht, wie bisher
immer in allen Hand- und Spezialbüchern zu lesen war, die neue Raumauffassung, die Fähigkeit, Perspektive zu
geben — das hatte man von Dürer übernehmen können — sondern die neue Art, das Ding in dieser errungenen Raum-
tiefe einzuordnen, es der Veränderung durch die Atmosphäre preiszugeben, die Koloristik.