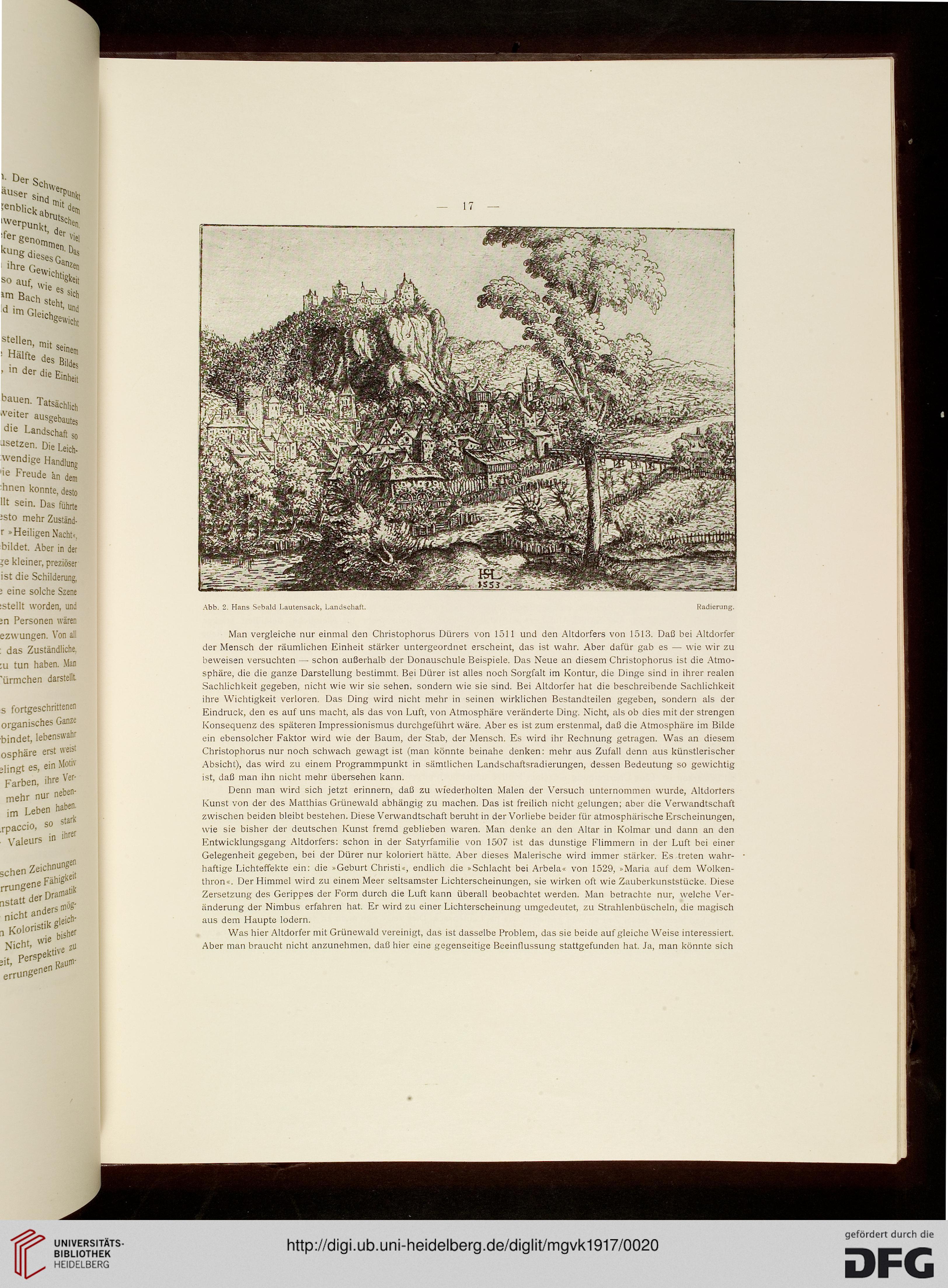mBSbL
■■■■■■^H
,De'-sch
auser <;•
tSchen
in-Das
mit
17
;;verpunkt,
kunS dieses
so auf, £***
Stellen- mit sein»
• m der die Einhe!t
bauen. Tatsächlich
^e,ter ausgebaut
dle Landschaft so
usetzen. Die Leich-
wendige Handlung
lle Freude an den,
hnen konnte, desto
Ht sein. Das führte
:sto mehr Zustand-
t »HeiligenNacht..
bildet. Aber in der
,re kleiner, preziöser
ist die Schilderung,
: eine solche Szene
:stellt worden, und
:n Personen wären
ezwungen. Von all
: das Zuständliche,
:u tun haben. Man
'ürmchen darstellt
s fortgeschrittenen
organisches Ganze
bindet, lebenswahr
osphäre erst «'eist
dingt es, ein Motiv
Farben, ihre Ver-
mehr nur neben-
im Leben haben.
rpaccio, so stark
■ Valeurs in **
* Per5Pe R unr-
Abb. 2. Hans Sebald Lautensack, Landschaft. Radierung.
Man vergleiche nur einmal den Christophorus Dürers von 1511 und den Altdorfers von 1513. Daß bei Altdorfer
der Mensch der räumlichen Einheit stärker untergeordnet erscheint, das ist wahr. Aber dafür gab es — wie wir zu
beweisen versuchten — schon außerhalb der Donauschule Beispiele. Das Neue an diesem Christophorus ist die Atmo-
sphäre, die die ganze Darstellung bestimmt. Bei Dürer ist alles noch Sorgfalt im Kontur, die Dinge sind in ihrer realen
Sachlichkeit gegeben, nicht wie wir sie sehen, sondern wie sie sind. Bei Altdorfer hat die beschreibende Sachlichkeit
ihre Wichtigkeit verloren. Das Ding wird nicht mehr in seinen wirklichen Bestandteilen gegeben, sondern als der
Eindruck, den es auf uns macht, als das von Luft, von Atmosphäre veränderte Ding. Nicht, als ob dies mit der strengen
Konsequenz des späteren Impressionismus durchgeführt wäre. Aber es ist zum erstenmal, daß die Atmosphäre im Bilde
ein ebensolcher Faktor wird wie der Baum, der Stab, der Mensch. Es wird ihr Rechnung getragen. Was an diesem
Christophorus nur noch schwach gewagt ist (man könnte beinahe denken: mehr aus Zufall denn aus künstlerischer
Absicht), das wird zu einem Programmpunkt in sämtlichen Landschaftsradierungen, dessen Bedeutung so gewichtig
ist, daß man ihn nicht mehr übersehen kann.
Denn man wird sich jetzt erinnern, daß zu wiederholten Malen der Versuch unternommen wurde, Altdorfers
Kunst von der des Matthias Grünewald abhängig zu machen. Das ist freilich nicht gelungen; aber die Verwandtschaft
zwischen beiden bleibt bestehen. Diese Verwandtschaft beruht in der Vorliebe beider für atmosphärische Erscheinungen,
wie sie bisher der deutschen Kunst fremd geblieben waren. Man denke an den Altar in Kolmar und dann an den
Entwicklungsgang Altdorfers: schon in der Satyrfamilie von 1507 ist das dunstige Flimmern in der Luft bei einer
Gelegenheit gegeben, bei der Dürer nur koloriert hätte. Aber dieses Malerische wird immer stärker. Es treten wahr-
haftige Lichteffekte ein: die »Geburt Christi«, endlich die »Schlacht bei Arbela« von 1529, »Maria auf dem Wolken-
thron«. Der Himmel wird zu einem Meer seltsamster Lichterscheinungen, sie wirken oft wie Zauberkunststücke. Diese
Zersetzung des Gerippes der Form durch die Luft kann überall beobachtet werden. Man betrachte nur, welche Ver-
änderung der Nimbus erfahren hat. Er wird zu einer Lichterscheinung umgedeutet, zu Strahlenbüscheln, die magisch
aus dem Haupte lodern.
Was hier Altdorfer mit Grünewald vereinigt, das ist dasselbe Problem, das sie beide auf gleiche Weise interessiert.
Aber man braucht nicht anzunehmen, daß hier eine gegenseitige Beeinflussung stattgefunden hat. Ja, man könnte sich