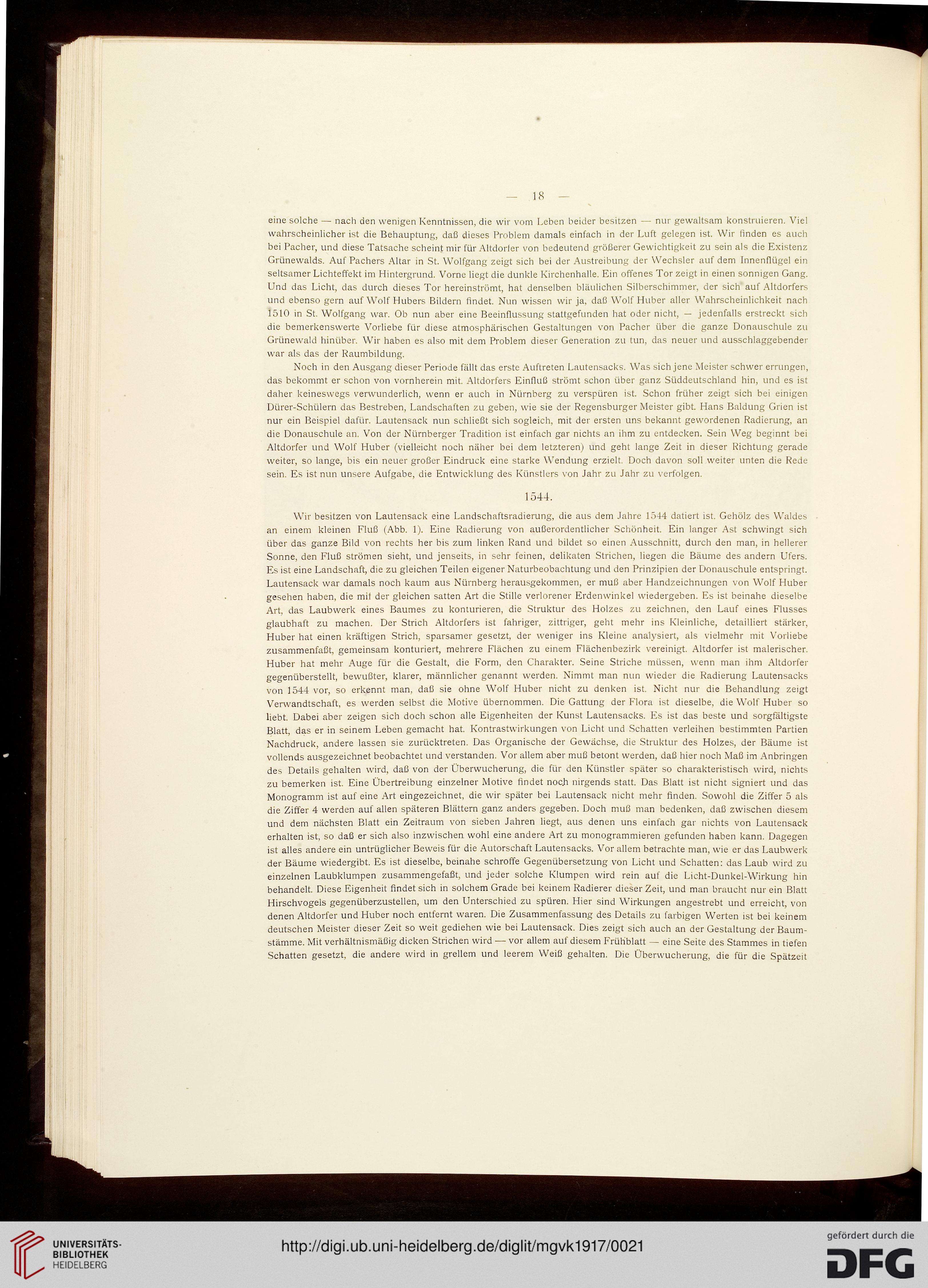— 18 —
eine solche — nach den wenigen Kenntnissen, die wir vom Leben heider besitzen — nur gewaltsam konstruieren. Viel
wahrscheinlicher ist die Behauptung, daß dieses Problem damals einfach in der Luft gelegen ist. Wir finden es auch
bei Pacher, und diese Tatsache scheint mir für Altdorfer von bedeutend größerer Gewichtigkeit zu sein als die Existenz
Grünewalds. Auf Pachers Altar in St. Wolfgang zeigt sich bei der Austreibung der Wechsler auf dem Innenflügel ein
seltsamer Lichteffekt im Hintergrund. Vorne liegt die dunkle Kirchenhalle. Ein offenes Tor zeigt in einen sonnigen Gang.
Lind das Licht, das durch dieses Tor hereinströmt, hat denselben bläulichen Silberschimmer, der sich auf Altdorfers
und ebenso gern auf Wolf Hubers Bildern findet. Nun wissen wir ja, daß Wolf Huber aller Wahrscheinlichkeit nach
1510 in St. Wolfgang war. Ob nun aber eine Beeinflussung stattgefunden hat oder nicht, — jedenfalls erstreckt sich
die bemerkenswerte Vorliebe für diese atmosphärischen Gestaltungen von Pacher über die ganze Donauschule zu
Grunewald hinüber. Wir haben es also mit dem Problem dieser Generation zu tun, das neuer und ausschlaggebender
war als das der Raumbildung.
Noch in den Ausgang dieser Periode fällt das erste Auftreten Lautensacks. Was sich jene Meister schwer errungen,
das bekommt er schon von vornherein mit. Altdorfers Einfluß strömt schon über ganz Süddeutschland hin, und es ist
daher keineswegs verwunderlich, wenn er auch in Nürnberg zu verspüren ist. Schon früher zeigt sich bei einigen
Dürer-Schülern das Bestreben, Landschaften zu geben, wie sie der Regensburger Meister gibt. Hans Baidung Grien ist
nur ein Beispiel dafür. Lautensack nun schließt sich sogleich, mit der ersten uns bekannt gewordenen Radierung, an
die Donauschule an. Von der Nürnberger Tradition ist einfach gar nichts an ihm zu entdecken. Sein Weg beginnt bei
Altdorfer und Wolf Huber (vielleicht noch näher bei dem letzteren) und geht lange Zeit in dieser Richtung gerade
weiter, so lange, bis ein neuer großer Eindruck eine starke Wendung erzielt. Doch davon soll weiter unten die Rede
sein. Es ist nun unsere Aufgabe, die Entwicklung des Künstlers von Jahr zu Jahr zu verfolgen.
1544.
Wir besitzen von Lautensack eine Landschaftsradierung, die aus dem Jahre 1544 datiert ist. Gehölz des Waldes
an einem kleinen Fluß (Abb. 1). Eine Radierung von außerordentlicher Schönheit. Ein langer Ast schwingt sich
über das ganze Bild von rechts her bis zum linken Rand und bildet so einen Ausschnitt, durch den man, in hellerer
Sonne, den Fluß strömen sieht, und jenseits, in sehr feinen, delikaten Strichen, liegen die Bäume des andern Ufers.
Es ist eine Landschaft, die zu gleichen Teilen eigener Naturbeobachtung und den Prinzipien der Donauschule entspringt.
Lautensack war damals noch kaum aus Nürnberg herausgekommen, er muß aber Handzeichnungen von Wolf Huber
gesehen haben, die mit der gleichen satten Art die Stille verlorener Erdenwinkel wiedergeben. Es ist beinahe dieselbe
Art, das Laubwerk eines Baumes zu konturieren, die Struktur des Holzes zu zeichnen, den Lauf eines Flusses
glaubhaft zu machen. Der Strich Altdorfers ist fahriger, zittriger, geht mehr ins Kleinliche, detailliert stärker,
Huber hat einen kräftigen Strich, sparsamer gesetzt, der weniger ins Kleine analysiert, als vielmehr mit Vorliebe
zusammenfaßt, gemeinsam konturiert, mehrere Flachen zu einem Flächenbezirk vereinigt. Altdorfer ist malerischer.
Huber hat mehr Auge für die Gestalt, die Form, den Charakter. Seine Striche müssen, wenn man ihm Altdorfer
gegenüberstellt, bewußter, klarer, männlicher genannt werden. Nimmt man nun wieder die Radierung Lautensacks
von 1544 vor, so erkennt man, daß sie ohne Wolf Huber nicht zu denken ist. Nicht nur die Behandlung zeigt
Verwandtschaft, es werden selbst die Motive übernommen. Die Gattung der Flora ist dieselbe, die Wolf Huber so
liebt. Dabei aber zeigen sich doch schon alle Eigenheiten der Kunst Lautensacks. Es ist das beste und sorgfältigste
Blatt das er in seinem Leben gemacht hat. Kontrastwirkungen von Licht und Schatten verleihen bestimmten Partien
Nachdruck, andere lassen sie zurücktreten. Das Organische der Gewächse, die Struktur des Holzes, der Bäume ist
vollends ausgezeichnet beobachtet und verstanden. Vor allem aber muß betont werden, daß hier noch Maß im Anbringen
des Details gehalten wird, daß von der Überwucherung, die für den Künstler später so charakteristisch wird, nichts
zu bemerken ist. Eine Übertreibung einzelner Motive findet noch nirgends statt. Das Blatt ist nicht signiert und das
Monogramm ist auf eine Art eingezeichnet, die wir später bei Lautensack nicht mehr finden. Sowohl die Ziffer 5 als
die Ziffer 4 werden auf allen späteren Blättern ganz anders gegeben. Doch muß man bedenken, daß zwischen diesem
und dem nächsten Blatt ein Zeitraum von sieben Jahren liegt, aus denen uns einfach gar nichts von Lautensack
erhalten ist, so daß er sich also inzwischen wohl eine andere Art zu monogrammieren gefunden haben kann. Dagegen
ist alles andere ein untrüglicher Beweis für die Autorschaft Lautensacks. Vor allem betrachte man, wie er das Laubwerk
der Bäume wiedergibt. Es ist dieselbe, beinahe schroffe Gegenübersetzung von Licht und Schatten: das Laub wird zu
einzelnen Laubklumpen zusammengefaßt, und jeder solche Klumpen wird rein auf die Licht-Dunkel-Wirkung hin
behandelt. Diese Eigenheit findet sich in solchem Grade bei keinem Radierer dieser Zeit, und man braucht nur ein Blatt
Hirschvogels gegenüberzustellen, um den Unterschied zu spüren. Hier sind Wirkungen angestrebt und erreicht, von
denen Altdorfer und Huber noch entfernt waren. Die Zusammenfassung des Details zu farbigen Werten ist bei keinem
deutschen Meister dieser Zeit so weit gediehen wie bei Lautensack. Dies zeigt sich auch an der Gestaltung der Baum-
stämme. Mit verhältnismäßig dicken Strichen wird — vor allem auf diesem Frühblatt — eine Seite des Stammes in tiefen
Schatten gesetzt, die andere wird in grellem und leerem Weiß gehalten. Die Überwucherung, die für die Spätzeit
eine solche — nach den wenigen Kenntnissen, die wir vom Leben heider besitzen — nur gewaltsam konstruieren. Viel
wahrscheinlicher ist die Behauptung, daß dieses Problem damals einfach in der Luft gelegen ist. Wir finden es auch
bei Pacher, und diese Tatsache scheint mir für Altdorfer von bedeutend größerer Gewichtigkeit zu sein als die Existenz
Grünewalds. Auf Pachers Altar in St. Wolfgang zeigt sich bei der Austreibung der Wechsler auf dem Innenflügel ein
seltsamer Lichteffekt im Hintergrund. Vorne liegt die dunkle Kirchenhalle. Ein offenes Tor zeigt in einen sonnigen Gang.
Lind das Licht, das durch dieses Tor hereinströmt, hat denselben bläulichen Silberschimmer, der sich auf Altdorfers
und ebenso gern auf Wolf Hubers Bildern findet. Nun wissen wir ja, daß Wolf Huber aller Wahrscheinlichkeit nach
1510 in St. Wolfgang war. Ob nun aber eine Beeinflussung stattgefunden hat oder nicht, — jedenfalls erstreckt sich
die bemerkenswerte Vorliebe für diese atmosphärischen Gestaltungen von Pacher über die ganze Donauschule zu
Grunewald hinüber. Wir haben es also mit dem Problem dieser Generation zu tun, das neuer und ausschlaggebender
war als das der Raumbildung.
Noch in den Ausgang dieser Periode fällt das erste Auftreten Lautensacks. Was sich jene Meister schwer errungen,
das bekommt er schon von vornherein mit. Altdorfers Einfluß strömt schon über ganz Süddeutschland hin, und es ist
daher keineswegs verwunderlich, wenn er auch in Nürnberg zu verspüren ist. Schon früher zeigt sich bei einigen
Dürer-Schülern das Bestreben, Landschaften zu geben, wie sie der Regensburger Meister gibt. Hans Baidung Grien ist
nur ein Beispiel dafür. Lautensack nun schließt sich sogleich, mit der ersten uns bekannt gewordenen Radierung, an
die Donauschule an. Von der Nürnberger Tradition ist einfach gar nichts an ihm zu entdecken. Sein Weg beginnt bei
Altdorfer und Wolf Huber (vielleicht noch näher bei dem letzteren) und geht lange Zeit in dieser Richtung gerade
weiter, so lange, bis ein neuer großer Eindruck eine starke Wendung erzielt. Doch davon soll weiter unten die Rede
sein. Es ist nun unsere Aufgabe, die Entwicklung des Künstlers von Jahr zu Jahr zu verfolgen.
1544.
Wir besitzen von Lautensack eine Landschaftsradierung, die aus dem Jahre 1544 datiert ist. Gehölz des Waldes
an einem kleinen Fluß (Abb. 1). Eine Radierung von außerordentlicher Schönheit. Ein langer Ast schwingt sich
über das ganze Bild von rechts her bis zum linken Rand und bildet so einen Ausschnitt, durch den man, in hellerer
Sonne, den Fluß strömen sieht, und jenseits, in sehr feinen, delikaten Strichen, liegen die Bäume des andern Ufers.
Es ist eine Landschaft, die zu gleichen Teilen eigener Naturbeobachtung und den Prinzipien der Donauschule entspringt.
Lautensack war damals noch kaum aus Nürnberg herausgekommen, er muß aber Handzeichnungen von Wolf Huber
gesehen haben, die mit der gleichen satten Art die Stille verlorener Erdenwinkel wiedergeben. Es ist beinahe dieselbe
Art, das Laubwerk eines Baumes zu konturieren, die Struktur des Holzes zu zeichnen, den Lauf eines Flusses
glaubhaft zu machen. Der Strich Altdorfers ist fahriger, zittriger, geht mehr ins Kleinliche, detailliert stärker,
Huber hat einen kräftigen Strich, sparsamer gesetzt, der weniger ins Kleine analysiert, als vielmehr mit Vorliebe
zusammenfaßt, gemeinsam konturiert, mehrere Flachen zu einem Flächenbezirk vereinigt. Altdorfer ist malerischer.
Huber hat mehr Auge für die Gestalt, die Form, den Charakter. Seine Striche müssen, wenn man ihm Altdorfer
gegenüberstellt, bewußter, klarer, männlicher genannt werden. Nimmt man nun wieder die Radierung Lautensacks
von 1544 vor, so erkennt man, daß sie ohne Wolf Huber nicht zu denken ist. Nicht nur die Behandlung zeigt
Verwandtschaft, es werden selbst die Motive übernommen. Die Gattung der Flora ist dieselbe, die Wolf Huber so
liebt. Dabei aber zeigen sich doch schon alle Eigenheiten der Kunst Lautensacks. Es ist das beste und sorgfältigste
Blatt das er in seinem Leben gemacht hat. Kontrastwirkungen von Licht und Schatten verleihen bestimmten Partien
Nachdruck, andere lassen sie zurücktreten. Das Organische der Gewächse, die Struktur des Holzes, der Bäume ist
vollends ausgezeichnet beobachtet und verstanden. Vor allem aber muß betont werden, daß hier noch Maß im Anbringen
des Details gehalten wird, daß von der Überwucherung, die für den Künstler später so charakteristisch wird, nichts
zu bemerken ist. Eine Übertreibung einzelner Motive findet noch nirgends statt. Das Blatt ist nicht signiert und das
Monogramm ist auf eine Art eingezeichnet, die wir später bei Lautensack nicht mehr finden. Sowohl die Ziffer 5 als
die Ziffer 4 werden auf allen späteren Blättern ganz anders gegeben. Doch muß man bedenken, daß zwischen diesem
und dem nächsten Blatt ein Zeitraum von sieben Jahren liegt, aus denen uns einfach gar nichts von Lautensack
erhalten ist, so daß er sich also inzwischen wohl eine andere Art zu monogrammieren gefunden haben kann. Dagegen
ist alles andere ein untrüglicher Beweis für die Autorschaft Lautensacks. Vor allem betrachte man, wie er das Laubwerk
der Bäume wiedergibt. Es ist dieselbe, beinahe schroffe Gegenübersetzung von Licht und Schatten: das Laub wird zu
einzelnen Laubklumpen zusammengefaßt, und jeder solche Klumpen wird rein auf die Licht-Dunkel-Wirkung hin
behandelt. Diese Eigenheit findet sich in solchem Grade bei keinem Radierer dieser Zeit, und man braucht nur ein Blatt
Hirschvogels gegenüberzustellen, um den Unterschied zu spüren. Hier sind Wirkungen angestrebt und erreicht, von
denen Altdorfer und Huber noch entfernt waren. Die Zusammenfassung des Details zu farbigen Werten ist bei keinem
deutschen Meister dieser Zeit so weit gediehen wie bei Lautensack. Dies zeigt sich auch an der Gestaltung der Baum-
stämme. Mit verhältnismäßig dicken Strichen wird — vor allem auf diesem Frühblatt — eine Seite des Stammes in tiefen
Schatten gesetzt, die andere wird in grellem und leerem Weiß gehalten. Die Überwucherung, die für die Spätzeit