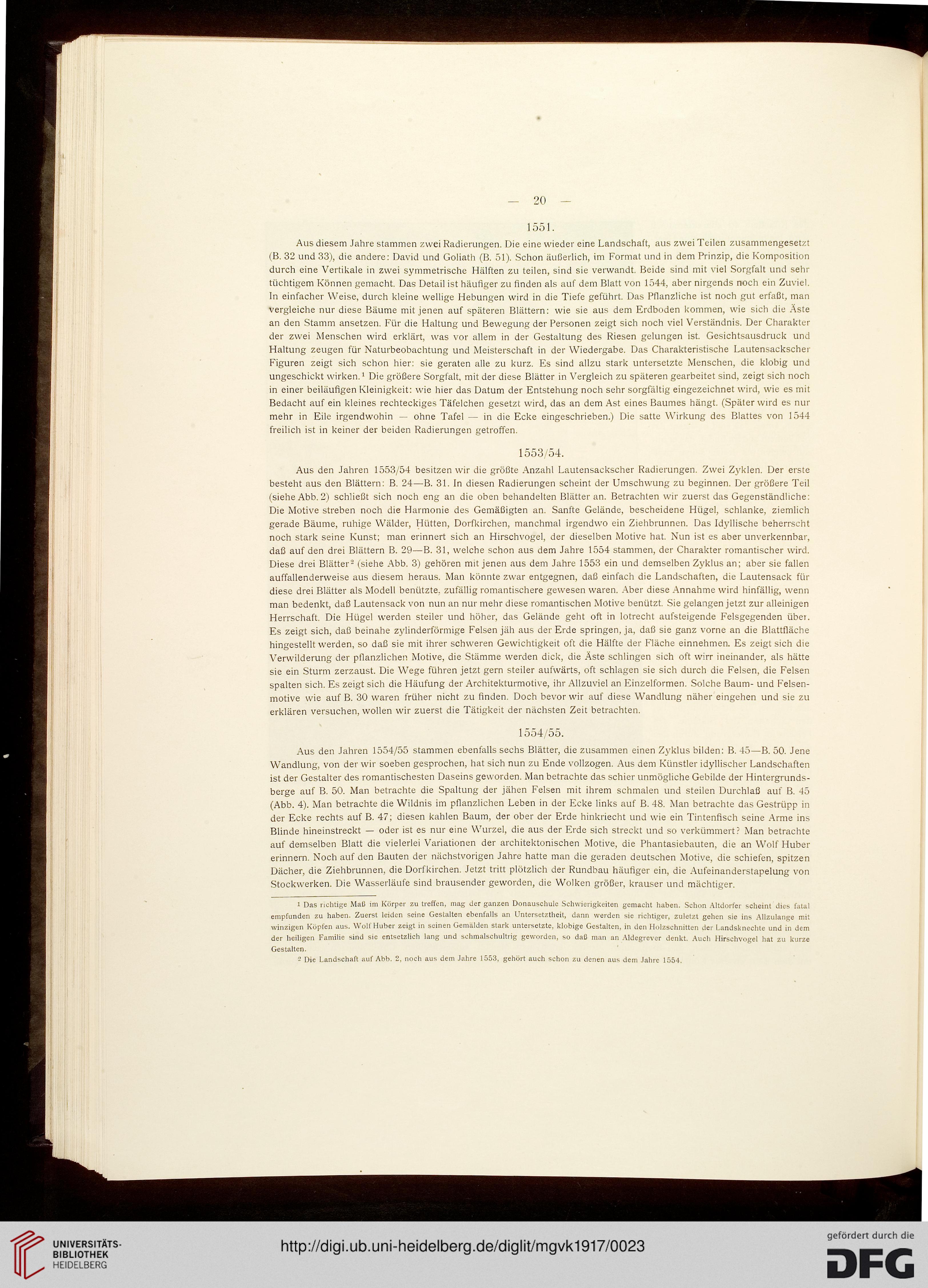20
1551.
Aus diesem Jahre stammen zwei Radierungen. Die eine wieder eine Landschaft, aus zwei Teilen zusammengesetzt
(B. 32 und 33), die andere: David und Goliath (B. 51). Schon äußerlich, im Format und in dem Prinzip, die Komposition
durch eine Vertikale in zwei symmetrische Hälften zu teilen, sind sie verwandt. Beide sind mit viel Sorgfalt und sehr
tüchtigem Können gemacht. Das Detail ist häufiger zu finden als auf dem Blatt von 1544, aber nirgends noch ein Zuviel.
In einfacher Weise, durch kleine wellige Hebungen wird in die Tiefe geführt. Das Pflanzliche ist noch gut erfaßt, man
vergleiche nur diese Bäume mit jenen auf späteren Blättern: wie sie aus dem Erdboden kommen, wie sich die Aste
an den Stamm ansetzen. Für die Haltung und Bewegung der Personen zeigt sich noch viel Verständnis. Der Charakter
der zwei Menschen wird erklärt, was vor allem in der Gestaltung des Riesen gelungen ist. Gesichtsausdruck und
Haltung zeugen für Naturbeobachtung und Meisterschaft in der Wiedergabe. Das Charakteristische Lautensackscher
Figuren zeigt sich schon hier: sie geraten alle zu kurz. Es sind allzu stark untersetzte Menschen, die klobig und
ungeschickt wirken.1 Die größere Sorgfalt, mit der diese Blätter in Vergleich zu späteren gearbeitet sind, zeigt sich noch
in einer beiläufigen Kleinigkeit: wie hier das Datum der Entstehung noch sehr sorgfältig eingezeichnet wird, wie es mit
Bedacht auf ein kleines rechteckiges Täfelchen gesetzt wird, das an dem Ast eines Baumes hängt. (Später wird es nur
mehr in Eile irgendwohin — ohne Tafel — in die Ecke eingeschrieben.) Die satte Wirkung des Blattes von 1544
freilich ist in keiner der beiden Radierungen getroffen.
1553/54.
Aus den Jahren 1553/54 besitzen wir die größte Anzahl Lautensackscher Radierungen. Zwei Zyklen. Der erste
besteht aus den Blättern: B. 24—B. 31. In diesen Radierungen scheint der Umschwung zu beginnen. Der größere Teil
(siehe Abb. 2) schließt sich noch eng an die oben behandelten Blätter an. Betrachten wir zuerst das Gegenständliche:
Die Motive streben noch die Harmonie des Gemäßigten an. Sanfte Gelände, bescheidene Hügel, schlanke, ziemlich
gerade Bäume, ruhige Wälder, Hütten, Dorfkirchen, manchmal irgendwo ein Ziehbrunnen. Das Idyllische beherrscht
noch stark seine Kunst; man erinnert sich an Hirschvogel, der dieselben Motive hat. Nun ist es aber unverkennbar,
daß auf den drei Blättern B. 29—B. 31, welche schon aus dem Jahre 1554 stammen, der Charakter romantischer wird.
Diese drei Blätter2 (siehe Abb. 3) gehören mit jenen aus dem Jahre 1553 ein und demselben Zyklus an; aber sie fallen
auffallenderweise aus diesem heraus. Man könnte zwar entgegnen, daß einfach die Landschaften, die Lautensack für
diese drei Blätter als Modell benützte, zufällig romantischere gewesen waren. Aber diese Annahme wird hinfällig, wenn
man bedenkt, daß Lautensack von nun an nur mehr diese romantischen Motive benützt. Sie gelangen jetzt zur alleinigen
Herrschaft. Die Hügel werden steiler und höher, das Gelände geht oft in lotrecht aufsteigende Felsgegenden über.
Es zeigt sich, daß beinahe zylinderförmige Felsen jäh aus der Erde springen, ja, daß sie ganz vorne an die Blattfläche
hingestellt werden, so daß sie mit ihrer schweren Gewichtigkeit oft die Hälfte der Fläche einnehmen. Es zeigt sich die
Verwilderung der pflanzlichen Motive, die Stämme werden dick, die Äste schlingen sich oft wirr ineinander, als hätte
sie ein Sturm zerzaust. Die Wege führen jetzt gern steiler aufwärts, oft schlagen sie sich durch die Felsen, die Felsen
spalten sich. Es zeigt sich die Häufung der Architekturmotive, ihr Allzuviel an Einzelformen. Solche Baum- und Felsen-
motive wie auf B. 30 waren früher nicht zu finden. Doch bevor wir auf diese Wandlung näher eingehen und sie zu
erklären versuchen, wollen wir zuerst die Tätigkeit der nächsten Zeit betrachten.
1554/55.
Aus den Jahren 1554/55 stammen ebenfalls sechs Blätter, die zusammen einen Zyklus bilden: B. 45—B. 50. Jene
Wandlung, von der wir soeben gesprochen, hat sich nun zu Ende vollzogen. Aus dem Künstler idyllischer Landschaften
ist der Gestalter des romantischesten Daseins geworden. Man betrachte das schier unmögliche Gebilde der Hintergrunds-
berge auf B. 50. Man betrachte die Spaltung der jähen Felsen mit ihrem schmalen und steilen Durchlaß auf B. 45
(Abb. 4). Man betrachte die Wildnis im pflanzlichen Leben in der Ecke links auf B. 48. Man betrachte das Gestrüpp in
der Ecke rechts auf B. 47; diesen kahlen Baum, der ober der Erde hinkriecht und wie ein Tintenfisch seine Arme ins
Blinde hineinstreckt — oder ist es nur eine Wurzel, die aus der Erde sich streckt und so verkümmert? Man betrachte
auf demselben Blatt die vielerlei Variationen der architektonischen Motive, die Phantasiebauten, die an Wolf Huber
erinnern. Noch auf den Bauten der nächstvorigen Jahre hatte man die geraden deutschen Motive, die schiefen, spitzen
Dächer, die Ziehbrunnen, die Dorfkirchen. Jetzt tritt plötzlich der Rundbau häufiger ein, die Aufeinanderstapelung von
Stockwerken. Die Wasserläufe sind brausender geworden, die Wolken größer, krauser und mächtiger.
i Das richtige Maß im Körper zu treffen, mag der ganzen Donauschule Schwierigkeiten gemacht haben. Schon Altdorfer scheint dies fatal
empfunden zu haben. Zuerst leiden seine Gestalten ebenfalls an Untersetztheit, dann werden sie richtiger, zuletzt gehen sie ins Allzulange mit
winzigen Köpfen aus. Wolf Huber zeigt in seinen Gemälden stark untersetzte, klobige Gestalten, in den Holzschnitten der Landsknechte und in dem
der heiligen Familie sind sie entsetzlich lang und schmalschultrig geworden, so daß man an Aldegrever denkt. Auch Hirschvogel hat zu kurze
Gestalten.
- Die Landschaft auf Abb. 2, noch aus dem Jahre 1553, gehört auch schon zu denen aus dem Jahre 1554.
1551.
Aus diesem Jahre stammen zwei Radierungen. Die eine wieder eine Landschaft, aus zwei Teilen zusammengesetzt
(B. 32 und 33), die andere: David und Goliath (B. 51). Schon äußerlich, im Format und in dem Prinzip, die Komposition
durch eine Vertikale in zwei symmetrische Hälften zu teilen, sind sie verwandt. Beide sind mit viel Sorgfalt und sehr
tüchtigem Können gemacht. Das Detail ist häufiger zu finden als auf dem Blatt von 1544, aber nirgends noch ein Zuviel.
In einfacher Weise, durch kleine wellige Hebungen wird in die Tiefe geführt. Das Pflanzliche ist noch gut erfaßt, man
vergleiche nur diese Bäume mit jenen auf späteren Blättern: wie sie aus dem Erdboden kommen, wie sich die Aste
an den Stamm ansetzen. Für die Haltung und Bewegung der Personen zeigt sich noch viel Verständnis. Der Charakter
der zwei Menschen wird erklärt, was vor allem in der Gestaltung des Riesen gelungen ist. Gesichtsausdruck und
Haltung zeugen für Naturbeobachtung und Meisterschaft in der Wiedergabe. Das Charakteristische Lautensackscher
Figuren zeigt sich schon hier: sie geraten alle zu kurz. Es sind allzu stark untersetzte Menschen, die klobig und
ungeschickt wirken.1 Die größere Sorgfalt, mit der diese Blätter in Vergleich zu späteren gearbeitet sind, zeigt sich noch
in einer beiläufigen Kleinigkeit: wie hier das Datum der Entstehung noch sehr sorgfältig eingezeichnet wird, wie es mit
Bedacht auf ein kleines rechteckiges Täfelchen gesetzt wird, das an dem Ast eines Baumes hängt. (Später wird es nur
mehr in Eile irgendwohin — ohne Tafel — in die Ecke eingeschrieben.) Die satte Wirkung des Blattes von 1544
freilich ist in keiner der beiden Radierungen getroffen.
1553/54.
Aus den Jahren 1553/54 besitzen wir die größte Anzahl Lautensackscher Radierungen. Zwei Zyklen. Der erste
besteht aus den Blättern: B. 24—B. 31. In diesen Radierungen scheint der Umschwung zu beginnen. Der größere Teil
(siehe Abb. 2) schließt sich noch eng an die oben behandelten Blätter an. Betrachten wir zuerst das Gegenständliche:
Die Motive streben noch die Harmonie des Gemäßigten an. Sanfte Gelände, bescheidene Hügel, schlanke, ziemlich
gerade Bäume, ruhige Wälder, Hütten, Dorfkirchen, manchmal irgendwo ein Ziehbrunnen. Das Idyllische beherrscht
noch stark seine Kunst; man erinnert sich an Hirschvogel, der dieselben Motive hat. Nun ist es aber unverkennbar,
daß auf den drei Blättern B. 29—B. 31, welche schon aus dem Jahre 1554 stammen, der Charakter romantischer wird.
Diese drei Blätter2 (siehe Abb. 3) gehören mit jenen aus dem Jahre 1553 ein und demselben Zyklus an; aber sie fallen
auffallenderweise aus diesem heraus. Man könnte zwar entgegnen, daß einfach die Landschaften, die Lautensack für
diese drei Blätter als Modell benützte, zufällig romantischere gewesen waren. Aber diese Annahme wird hinfällig, wenn
man bedenkt, daß Lautensack von nun an nur mehr diese romantischen Motive benützt. Sie gelangen jetzt zur alleinigen
Herrschaft. Die Hügel werden steiler und höher, das Gelände geht oft in lotrecht aufsteigende Felsgegenden über.
Es zeigt sich, daß beinahe zylinderförmige Felsen jäh aus der Erde springen, ja, daß sie ganz vorne an die Blattfläche
hingestellt werden, so daß sie mit ihrer schweren Gewichtigkeit oft die Hälfte der Fläche einnehmen. Es zeigt sich die
Verwilderung der pflanzlichen Motive, die Stämme werden dick, die Äste schlingen sich oft wirr ineinander, als hätte
sie ein Sturm zerzaust. Die Wege führen jetzt gern steiler aufwärts, oft schlagen sie sich durch die Felsen, die Felsen
spalten sich. Es zeigt sich die Häufung der Architekturmotive, ihr Allzuviel an Einzelformen. Solche Baum- und Felsen-
motive wie auf B. 30 waren früher nicht zu finden. Doch bevor wir auf diese Wandlung näher eingehen und sie zu
erklären versuchen, wollen wir zuerst die Tätigkeit der nächsten Zeit betrachten.
1554/55.
Aus den Jahren 1554/55 stammen ebenfalls sechs Blätter, die zusammen einen Zyklus bilden: B. 45—B. 50. Jene
Wandlung, von der wir soeben gesprochen, hat sich nun zu Ende vollzogen. Aus dem Künstler idyllischer Landschaften
ist der Gestalter des romantischesten Daseins geworden. Man betrachte das schier unmögliche Gebilde der Hintergrunds-
berge auf B. 50. Man betrachte die Spaltung der jähen Felsen mit ihrem schmalen und steilen Durchlaß auf B. 45
(Abb. 4). Man betrachte die Wildnis im pflanzlichen Leben in der Ecke links auf B. 48. Man betrachte das Gestrüpp in
der Ecke rechts auf B. 47; diesen kahlen Baum, der ober der Erde hinkriecht und wie ein Tintenfisch seine Arme ins
Blinde hineinstreckt — oder ist es nur eine Wurzel, die aus der Erde sich streckt und so verkümmert? Man betrachte
auf demselben Blatt die vielerlei Variationen der architektonischen Motive, die Phantasiebauten, die an Wolf Huber
erinnern. Noch auf den Bauten der nächstvorigen Jahre hatte man die geraden deutschen Motive, die schiefen, spitzen
Dächer, die Ziehbrunnen, die Dorfkirchen. Jetzt tritt plötzlich der Rundbau häufiger ein, die Aufeinanderstapelung von
Stockwerken. Die Wasserläufe sind brausender geworden, die Wolken größer, krauser und mächtiger.
i Das richtige Maß im Körper zu treffen, mag der ganzen Donauschule Schwierigkeiten gemacht haben. Schon Altdorfer scheint dies fatal
empfunden zu haben. Zuerst leiden seine Gestalten ebenfalls an Untersetztheit, dann werden sie richtiger, zuletzt gehen sie ins Allzulange mit
winzigen Köpfen aus. Wolf Huber zeigt in seinen Gemälden stark untersetzte, klobige Gestalten, in den Holzschnitten der Landsknechte und in dem
der heiligen Familie sind sie entsetzlich lang und schmalschultrig geworden, so daß man an Aldegrever denkt. Auch Hirschvogel hat zu kurze
Gestalten.
- Die Landschaft auf Abb. 2, noch aus dem Jahre 1553, gehört auch schon zu denen aus dem Jahre 1554.