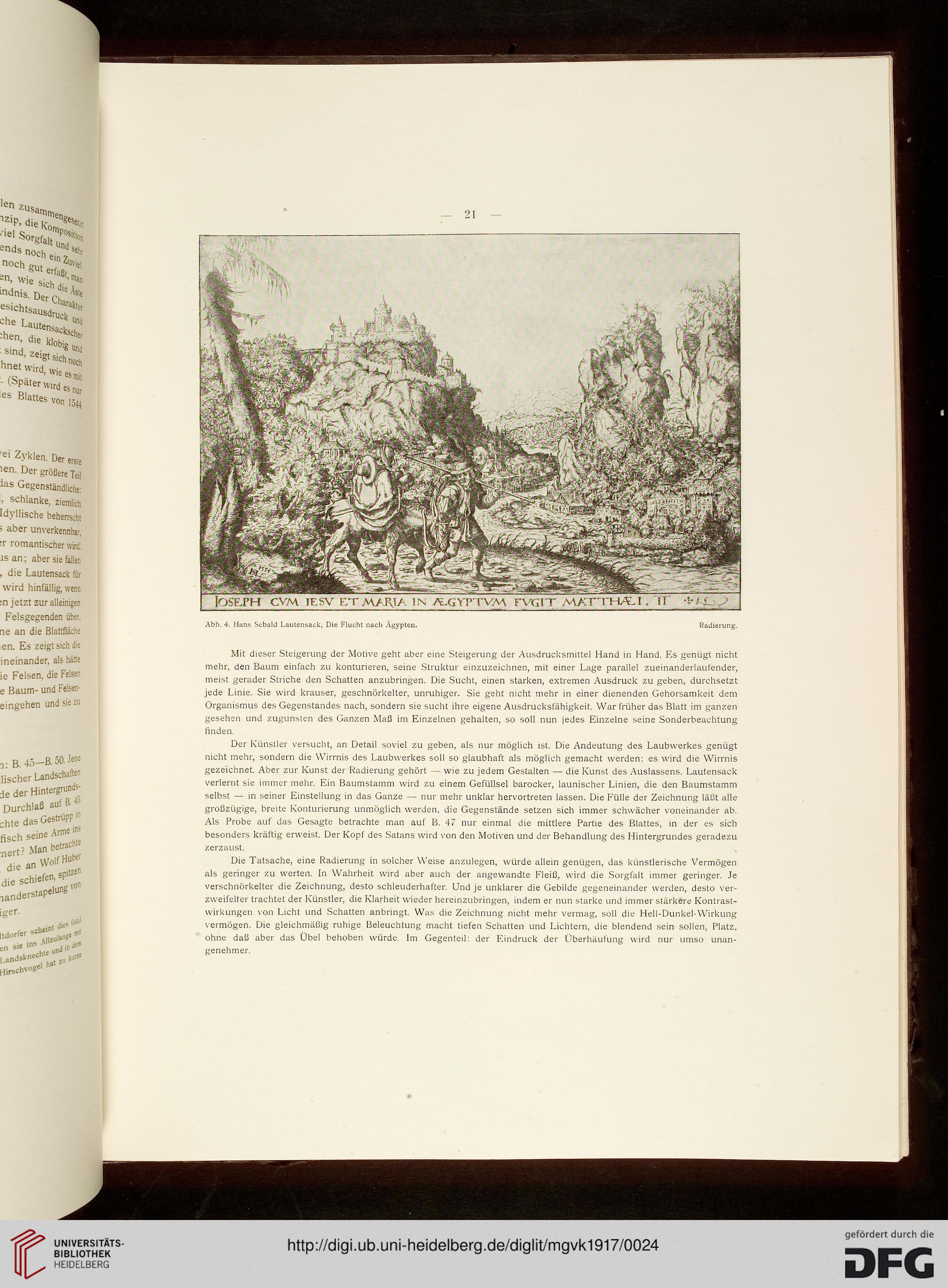■■HB
len 2u^m
"ei Sor8SmP°Siti»«
eVvies,ch« an
^Jnis.De leAste
che Uu^s sr
Ar:-
'ei Z.vWen. Der erste
ien. Der größere Teil
Jas Gegenständliche:
, schlanke, ziemlich
Idyllische beherrscht
> aber unverkennbar,
'r romantischer wird
is an; aber sie fallen
, die Lautensack für
wird hinfällig, wenn
:n jetzt zur alleinigen
Felsgegenden übet,
ne an die BLattfläche
en. Es zeigt sich die
ineinander, als hätte
ie Felsen, die Felser
e Baum- und Felsen-
eingehen und sie zu
r B. 45-B.50.Jene
lischer Landschaften
je der Hintergrund-
Durchlaß aufB.«
:h«e das Gestrüpp'»
fisch seine Arme.
iger.
.andskn^., ^ ,
21
IOSE,PH CVM 1F.SV KTA\/J\1A IN /^GYPTVAA FVCilT MATTHAI . H
Un"S" ; bat ^
kort'
Abb, 4. Hans Sobald Lautensack, Die Flucht nach Ägypten. Radierung.
Mit dieser Steigerung der Motive geht aber eine Steigerung der Ausdrucksmittel Hand in Hand. Es genügt nicht
mehr, den Baum einfach zu konturieren, seine Struktur einzuzeichnen, mit einer Lage parallel zueinanderlaufender,
meist gerader Striche den Schatten anzubringen. Die Sucht, einen starken, extremen Ausdruck zu geben, durchsetzt
jede Linie. Sie wird krauser, geschnörkelter, unruhiger. Sie geht nicht mehr in einer dienenden Gehorsamkeit dem
Organismus des Gegenstandes nach, sondern sie sucht ihre eigene Ausdrucksfähigkeit. War früher das Blatt im ganzen
gesehen und zugunsten des Ganzen Maß im Einzelnen gehalten, so soll nun jedes Einzelne seine Sonderbeachtung
finden.
Der Künstler versucht, an Detail soviel zu geben, als nur möglich ist. Die Andeutung des Laubwerkes genügt
nicht mehr, sondern die Wirrnis des Laubwerkes soll so glaubhaft als möglich gemacht werden: es wird die Wirrnis
gezeichnet. Aber zur Kunst der Radierung gehört — wie zu jedem Gestalten — die Kunst des Auslassens. Lautensack
verlernt sie immer mehr. Ein Baumstamm wird zu einem Gefüllsel barocker, launischer Linien, die den Baumstamm
selbst — in seiner Einstellung in das Ganze — nur mehr unklar hervortreten lassen. Die Fülle der Zeichnung läßt alle
großzügige, breite Konturierung unmöglich werden, die Gegenstände setzen sich immer schwächer voneinander ab.
Als Probe auf das Gesagte betrachte man auf ß. 47 nur einmal die mittlere Partie des Blattes, in der es sich
besonders kräftig erweist. Der Kopf des Satans wird von den Motiven und der Behandlung des Hintergrundes geradezu
zerzaust.
Die Tatsache, eine Radierung in solcher Weise anzulegen, würde allein genügen, das künstlerische Vermögen
als geringer zu werten. In Wahrheit wird aber auch der angewandte Fleiß, wird die Sorgfalt immer geringer. Je
verschnörkelter die Zeichnung, desto schleuderhafter. Und je unklarer die Gebilde gegeneinander werden, desto ver-
zweifelter trachtet der Künstler, die Klarheit wieder hereinzubringen, indem er nun starke und immer stärkere Kontrast-
wirkungen von Licht und Schatten anbringt. Was die Zeichnung nicht mehr vermag, soll die Hell-Dunkel-Wirkung
vermögen. Die gleichmäßig ruhige Beleuchtung macht tiefen Schatten und Lichtern, die blendend sein sollen, Platz,
ohne daß aber das Übel behoben würde. Im Gegenteil: der Eindruck der Überhäufung wird nur umso unan-
genehmer.
len 2u^m
"ei Sor8SmP°Siti»«
eVvies,ch« an
^Jnis.De leAste
che Uu^s sr
Ar:-
'ei Z.vWen. Der erste
ien. Der größere Teil
Jas Gegenständliche:
, schlanke, ziemlich
Idyllische beherrscht
> aber unverkennbar,
'r romantischer wird
is an; aber sie fallen
, die Lautensack für
wird hinfällig, wenn
:n jetzt zur alleinigen
Felsgegenden übet,
ne an die BLattfläche
en. Es zeigt sich die
ineinander, als hätte
ie Felsen, die Felser
e Baum- und Felsen-
eingehen und sie zu
r B. 45-B.50.Jene
lischer Landschaften
je der Hintergrund-
Durchlaß aufB.«
:h«e das Gestrüpp'»
fisch seine Arme.
iger.
.andskn^., ^ ,
21
IOSE,PH CVM 1F.SV KTA\/J\1A IN /^GYPTVAA FVCilT MATTHAI . H
Un"S" ; bat ^
kort'
Abb, 4. Hans Sobald Lautensack, Die Flucht nach Ägypten. Radierung.
Mit dieser Steigerung der Motive geht aber eine Steigerung der Ausdrucksmittel Hand in Hand. Es genügt nicht
mehr, den Baum einfach zu konturieren, seine Struktur einzuzeichnen, mit einer Lage parallel zueinanderlaufender,
meist gerader Striche den Schatten anzubringen. Die Sucht, einen starken, extremen Ausdruck zu geben, durchsetzt
jede Linie. Sie wird krauser, geschnörkelter, unruhiger. Sie geht nicht mehr in einer dienenden Gehorsamkeit dem
Organismus des Gegenstandes nach, sondern sie sucht ihre eigene Ausdrucksfähigkeit. War früher das Blatt im ganzen
gesehen und zugunsten des Ganzen Maß im Einzelnen gehalten, so soll nun jedes Einzelne seine Sonderbeachtung
finden.
Der Künstler versucht, an Detail soviel zu geben, als nur möglich ist. Die Andeutung des Laubwerkes genügt
nicht mehr, sondern die Wirrnis des Laubwerkes soll so glaubhaft als möglich gemacht werden: es wird die Wirrnis
gezeichnet. Aber zur Kunst der Radierung gehört — wie zu jedem Gestalten — die Kunst des Auslassens. Lautensack
verlernt sie immer mehr. Ein Baumstamm wird zu einem Gefüllsel barocker, launischer Linien, die den Baumstamm
selbst — in seiner Einstellung in das Ganze — nur mehr unklar hervortreten lassen. Die Fülle der Zeichnung läßt alle
großzügige, breite Konturierung unmöglich werden, die Gegenstände setzen sich immer schwächer voneinander ab.
Als Probe auf das Gesagte betrachte man auf ß. 47 nur einmal die mittlere Partie des Blattes, in der es sich
besonders kräftig erweist. Der Kopf des Satans wird von den Motiven und der Behandlung des Hintergrundes geradezu
zerzaust.
Die Tatsache, eine Radierung in solcher Weise anzulegen, würde allein genügen, das künstlerische Vermögen
als geringer zu werten. In Wahrheit wird aber auch der angewandte Fleiß, wird die Sorgfalt immer geringer. Je
verschnörkelter die Zeichnung, desto schleuderhafter. Und je unklarer die Gebilde gegeneinander werden, desto ver-
zweifelter trachtet der Künstler, die Klarheit wieder hereinzubringen, indem er nun starke und immer stärkere Kontrast-
wirkungen von Licht und Schatten anbringt. Was die Zeichnung nicht mehr vermag, soll die Hell-Dunkel-Wirkung
vermögen. Die gleichmäßig ruhige Beleuchtung macht tiefen Schatten und Lichtern, die blendend sein sollen, Platz,
ohne daß aber das Übel behoben würde. Im Gegenteil: der Eindruck der Überhäufung wird nur umso unan-
genehmer.