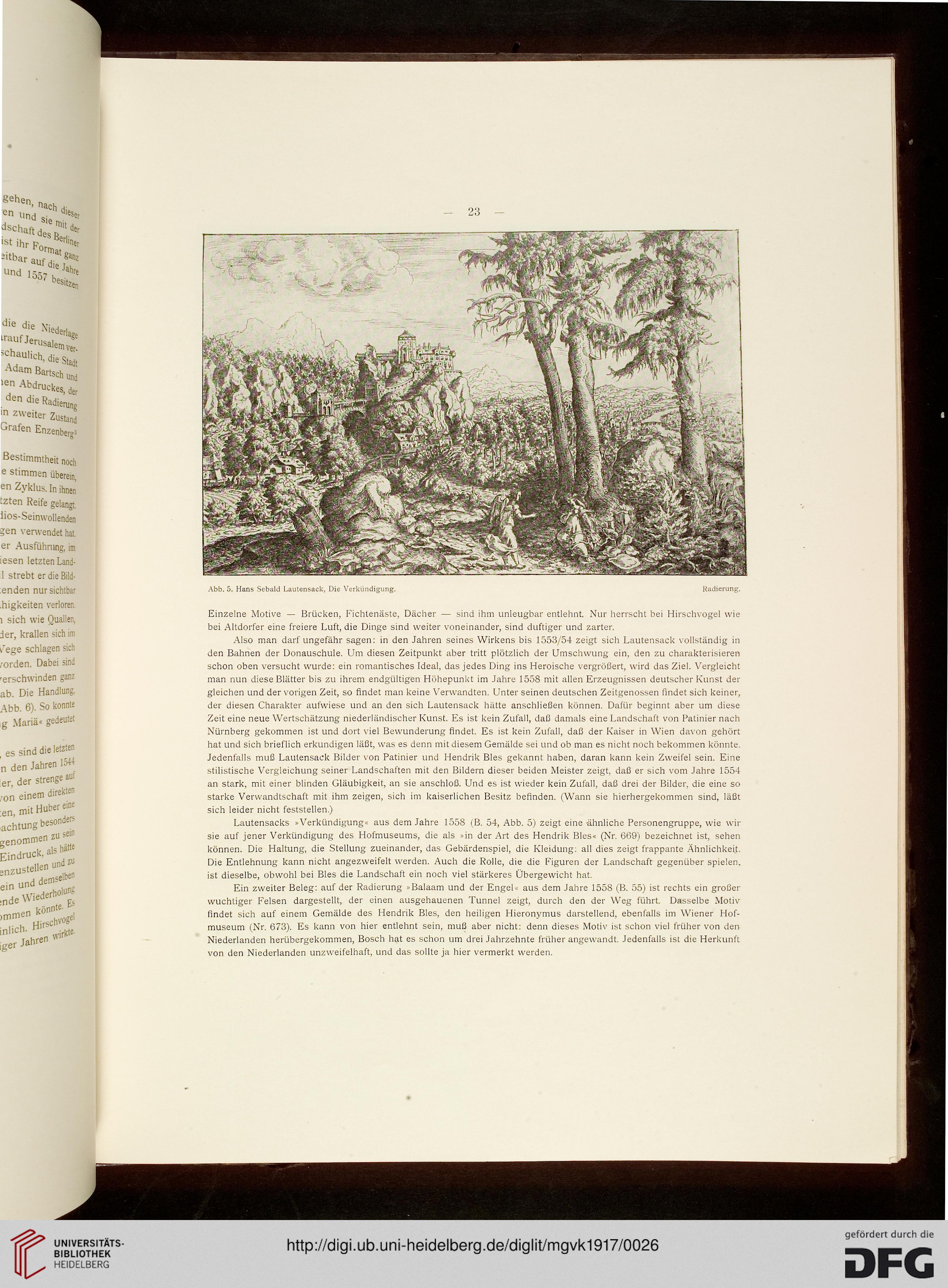11 g
Sehen „
Und sie
dSChaftdesBe
'St,h'-Fo„"
-■tbar„.r '^
23
rliner
Und 155
aUfd-iahre
oo?
b«
•teer
die dip v .
t;u,ich'dies.adt
AdamBa«schund
,eHnAbd'^kes,der
dendieRadieruns
'n ^iter Zustand
Grafen Enzenberg*
Bestimmtheit noch
e stimmen überein,
en Zyklus. In ihnen'
tzten Reife gelangt.
iios-Seimvollenden
gen verwendet hat
er Ausführung, im
iesen letzten Land-
1 strebt er die Bild-
enden nur sichtbar
.higkeiten verloren
l sich wie Quallen,
der, krallen sich im
i'ege schlagen sich
worden. Dabei sind
'erschwinden ganz
ab. Die Handlung,
Abb. 6). So konnte
g Maria« gedeutet
es sind die letzten
n den Jahren 1544
er der strenge auf
■on einem direkten
en, mit Huber eme
achtung besonder
genommen*»*»
^zustellen""
iger Jahren *>
Abb. 5. Hans Sebald Lautensack, Die Verkündigung. Radierung.
Einzelne Motive — Brücken, Fichtenäste, Dächer — sind ihm unleugbar entlehnt. Nur herrscht bei Hirschvogel wie
bei Altdorfer eine freiere Luft, die Dinge sind weiter voneinander, sind duftiger und zarter.
Also man darf ungefähr sagen: in den Jahren seines Wirkens bis 1553/54 zeigt sich Lautensack vollständig in
den Bahnen der üonauschule. Um diesen Zeitpunkt aber tritt plötzlich der Umschwung ein, den zu charakterisieren
schon oben versucht wurde: ein romantisches Ideal, das jedes Ding ins Heroische vergrößert, wird das Ziel. Vergleicht
man nun diese Blätter bis zu ihrem endgültigen Höhepunkt im Jahre 1558 mit allen Erzeugnissen deutscher Kunst der
gleichen und der vorigen Zeit, so findet man keine Verwandten. Unter seinen deutschen Zeitgenossen findet sich keiner,
der diesen Charakter aufwiese und an den sich Lautensack hätte anschließen können. Dafür beginnt aber um diese
Zeit eine neue Wertschätzung niederländischer Kunst. Es ist kein Zufall, daß damals eine Landschaft von Patinier nach
Nürnberg gekommen ist und dort viel Bewunderung findet. Es ist kein Zufall, daß der Kaiser in Wien davon gehört
hat und sich brieflich erkundigen läßt, was es denn mit diesem Gemälde sei und ob man es nicht noch bekommen könnte.
Jedenfalls muß Lautensack Bilder von Patinier und Hendrik Bles gekannt haben, daran kann kein Zweifel sein. Eine
stilistische Vergieichung seiner Landschaften mit den Bildern dieser beiden Meister zeigt, daß er sich vom Jahre 1554
an stark, mit einer blinden Gläubigkeit, an sie anschloß. Und es ist wieder kein Zufall, daß drei der Bilder, die eine so
starke Verwandtschaft mit ihm zeigen, sich im kaiserlichen Besitz befinden. (Wann sie hierhergekommen sind, läßt
sich leider nicht feststellen.)
Lautensacks »Verkündigung« aus dem Jahre 1558 (B. 54, Abb. 5) zeigt eine ähnliche Personengruppe, wie wir
sie auf jener Verkündigung des Hofmuseums, die als »in der Art des Hendrik Bles« (Nr. 669) bezeichnet ist, sehen
können. Die Haltung, die Stellung zueinander, das Gebärdenspiel, die Kleidung: all dies zeigt frappante Ähnlichkeit.
Die Entlehnung kann nicht angezweifelt werden. Auch die Rolle, die die Figuren der Landschaft gegenüber spielen,
ist dieselbe, obwohl bei Bles die Landschaft ein noch viel stärkeres Übergewicht hat.
Ein zweiter Beleg: auf der Radierung »Balaam und der Engel« aus dem Jahre 1558 (B. 55) ist rechts ein großer
wuchtiger Felsen dargestellt, der einen ausgehauenen Tunnel zeigt, durch den der Weg führt. Dasselbe Motiv
findet sich auf einem Gemälde des Hendrik Bles, den heiligen Hieronymus darstellend, ebenfalls im Wiener Hof-
museum (Nr. 673). Es kann von hier entlehnt sein, muß aber nicht: denn dieses Motiv ist schon viel früher von den
Niederlanden herübergekommen, Bosch hat es schon um drei Jahrzehnte früher angewandt. Jedenfalls ist die Herkunft
von den Niederlanden unzweifelhaft, und das sollte ja hier vermerkt werden.
Sehen „
Und sie
dSChaftdesBe
'St,h'-Fo„"
-■tbar„.r '^
23
rliner
Und 155
aUfd-iahre
oo?
b«
•teer
die dip v .
t;u,ich'dies.adt
AdamBa«schund
,eHnAbd'^kes,der
dendieRadieruns
'n ^iter Zustand
Grafen Enzenberg*
Bestimmtheit noch
e stimmen überein,
en Zyklus. In ihnen'
tzten Reife gelangt.
iios-Seimvollenden
gen verwendet hat
er Ausführung, im
iesen letzten Land-
1 strebt er die Bild-
enden nur sichtbar
.higkeiten verloren
l sich wie Quallen,
der, krallen sich im
i'ege schlagen sich
worden. Dabei sind
'erschwinden ganz
ab. Die Handlung,
Abb. 6). So konnte
g Maria« gedeutet
es sind die letzten
n den Jahren 1544
er der strenge auf
■on einem direkten
en, mit Huber eme
achtung besonder
genommen*»*»
^zustellen""
iger Jahren *>
Abb. 5. Hans Sebald Lautensack, Die Verkündigung. Radierung.
Einzelne Motive — Brücken, Fichtenäste, Dächer — sind ihm unleugbar entlehnt. Nur herrscht bei Hirschvogel wie
bei Altdorfer eine freiere Luft, die Dinge sind weiter voneinander, sind duftiger und zarter.
Also man darf ungefähr sagen: in den Jahren seines Wirkens bis 1553/54 zeigt sich Lautensack vollständig in
den Bahnen der üonauschule. Um diesen Zeitpunkt aber tritt plötzlich der Umschwung ein, den zu charakterisieren
schon oben versucht wurde: ein romantisches Ideal, das jedes Ding ins Heroische vergrößert, wird das Ziel. Vergleicht
man nun diese Blätter bis zu ihrem endgültigen Höhepunkt im Jahre 1558 mit allen Erzeugnissen deutscher Kunst der
gleichen und der vorigen Zeit, so findet man keine Verwandten. Unter seinen deutschen Zeitgenossen findet sich keiner,
der diesen Charakter aufwiese und an den sich Lautensack hätte anschließen können. Dafür beginnt aber um diese
Zeit eine neue Wertschätzung niederländischer Kunst. Es ist kein Zufall, daß damals eine Landschaft von Patinier nach
Nürnberg gekommen ist und dort viel Bewunderung findet. Es ist kein Zufall, daß der Kaiser in Wien davon gehört
hat und sich brieflich erkundigen läßt, was es denn mit diesem Gemälde sei und ob man es nicht noch bekommen könnte.
Jedenfalls muß Lautensack Bilder von Patinier und Hendrik Bles gekannt haben, daran kann kein Zweifel sein. Eine
stilistische Vergieichung seiner Landschaften mit den Bildern dieser beiden Meister zeigt, daß er sich vom Jahre 1554
an stark, mit einer blinden Gläubigkeit, an sie anschloß. Und es ist wieder kein Zufall, daß drei der Bilder, die eine so
starke Verwandtschaft mit ihm zeigen, sich im kaiserlichen Besitz befinden. (Wann sie hierhergekommen sind, läßt
sich leider nicht feststellen.)
Lautensacks »Verkündigung« aus dem Jahre 1558 (B. 54, Abb. 5) zeigt eine ähnliche Personengruppe, wie wir
sie auf jener Verkündigung des Hofmuseums, die als »in der Art des Hendrik Bles« (Nr. 669) bezeichnet ist, sehen
können. Die Haltung, die Stellung zueinander, das Gebärdenspiel, die Kleidung: all dies zeigt frappante Ähnlichkeit.
Die Entlehnung kann nicht angezweifelt werden. Auch die Rolle, die die Figuren der Landschaft gegenüber spielen,
ist dieselbe, obwohl bei Bles die Landschaft ein noch viel stärkeres Übergewicht hat.
Ein zweiter Beleg: auf der Radierung »Balaam und der Engel« aus dem Jahre 1558 (B. 55) ist rechts ein großer
wuchtiger Felsen dargestellt, der einen ausgehauenen Tunnel zeigt, durch den der Weg führt. Dasselbe Motiv
findet sich auf einem Gemälde des Hendrik Bles, den heiligen Hieronymus darstellend, ebenfalls im Wiener Hof-
museum (Nr. 673). Es kann von hier entlehnt sein, muß aber nicht: denn dieses Motiv ist schon viel früher von den
Niederlanden herübergekommen, Bosch hat es schon um drei Jahrzehnte früher angewandt. Jedenfalls ist die Herkunft
von den Niederlanden unzweifelhaft, und das sollte ja hier vermerkt werden.