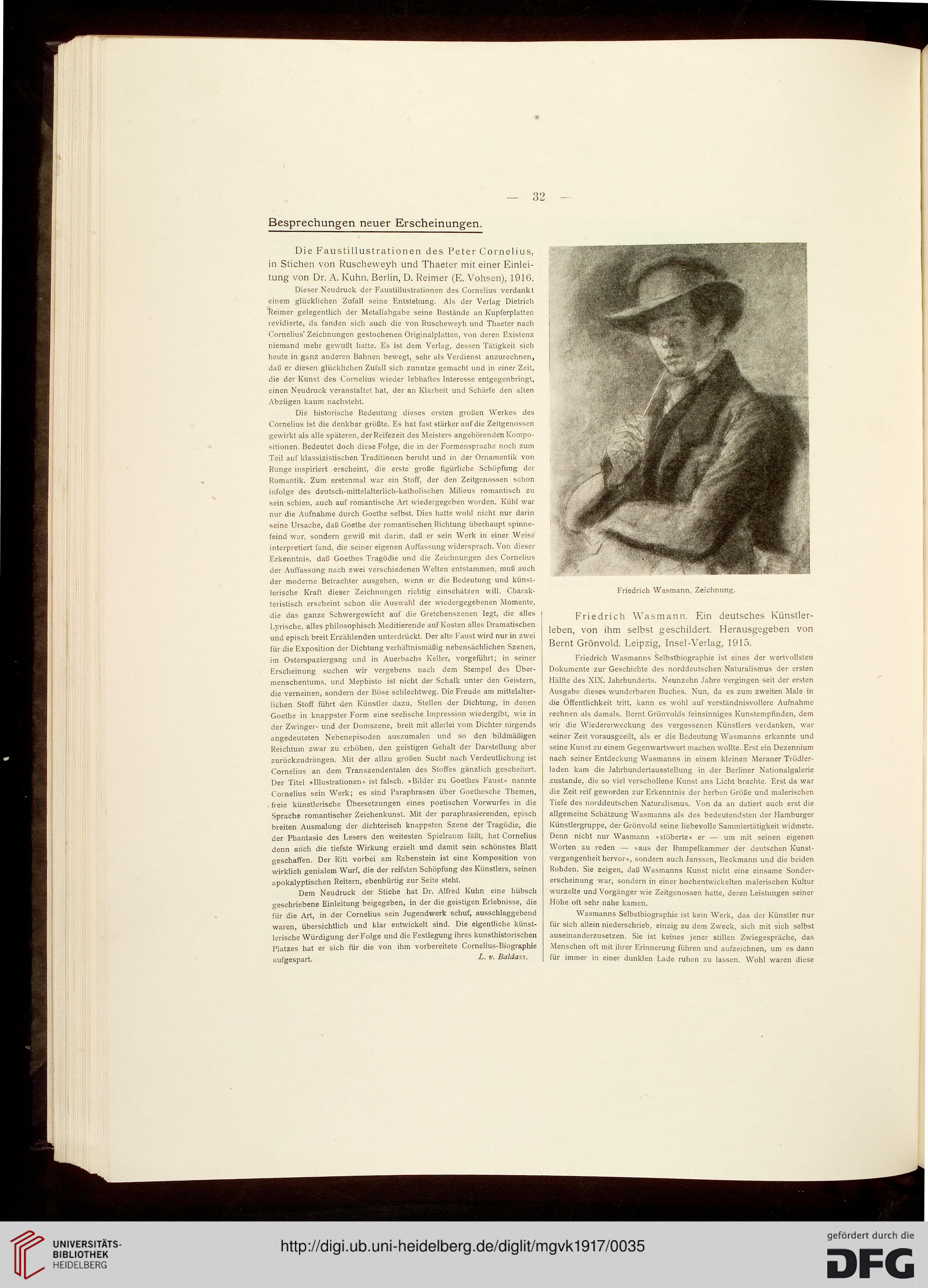32 --
Besprechungen neuer Erscheinungen.
DieFaustillustrationen des Peter Cornelius,
in Stichen von Ruscheweyh und Thaeter mit einer Einlei-
tung von Dr. A. Kahn. Berlin, D. Reimer (E. Vohsen), 1916.
Dieser Neudruck der Faustillustrationen des Cornelius verdankt
einem glücklichen Zufall seine Entstehung. Als der Verlag Dietrich
Reimer gelegentlich der Metallabgabe seine Bestände an Kupferplatten
revidierte, da fanden sich auch die von Ruscheweyh und Thaeter nach
Cornelius' Zeichnungen gestochenen Originalplatten, von deren Existenz
niemand mehr gewußt hatte. Es ist dem Verlag, dessen Tätigkeit sich
heute in ganz anderen Bahnen bewegt, sehr als Verdienst anzurechnen,
daß er diesen glücklichen Zufall sich zunutze gemacht und in einer Zeit,
die der Kunst des Cornelius wieder lebhaftes Interesse entgegenbringt,
einen Neudruck veranstaltet hat, der an Klarheit und Schärfe den alten
Abzügen kaum nachsteht.
Die historische Bedeutung dieses ersten großen Werkes des
Cornelius ist die denkbar größte. Es hat fast stärker auf die Zeitgenossen
gewirkt als alle späteren, der Reifezeit des Meisters angehörenden Kompo-
sitionen. Bedeutet doch diese Folge, die in der Formensprache noch zum
Teil auf klassizistischen Traditionen beruht und in der Ornamentik von
Kunge inspiriert erscheint, die erste große figürliche Schöpfung der
Romantik. Zum erstenmal war ein Stoff, der den Zeitgenossen schon
infolge des deutsch-mittelalterlich-katholischen Milieus romantisch zu
sein schien, auch auf romantische Art wiedergegeben worden. Kühl war
nur die Aufnahme durch Goethe selbst. Dies hatte wohl nicht nur darin
seine Ursache, daß Goethe der romantischen Richtung überhaupt spinne-
feind war, sondern gewiß mit darin, daß er sein Werk in einer Weise
interpretiert fand, die seiner eigenen Auffassung widersprach. Von dieser
Erkenntnis, daß Goethes Tragödie und die Zeichnungen des Cornelius
der Auffassung nach zwei verschiedenen Welten entstammen, muß auch
der moderne Betrachter ausgehen, wenn er die Bedeutung und künst-
lerische Kraft dieser Zeichnungen richtig einschätzen will. Charak-
teristisch erscheint schon die Auswahl der wiedergegebenen Momente,
die das ganze Schwergewicht auf die Gretchenszenen legt, die alles
Lyrische, alles philosophisch Meditierende auf Kosten alles Dramatischen
und episch breit Erzählenden unterdrückt. Der alte Faust wird nur in zwei
für die Exposition der Dichtung verhältnismäßig nebensächlichen Szenen,
im Osterspaziergang und in Auerbachs Keller, vorgeführt; in seiner
Erscheinung suchen wir vergebens nach dem Stempel des Über-
menschentums, und Mephisto ist nicht der Schalk unter den Geistern,
die verneinen, sondern der Böse schlechtweg. Die Freude am mittelalter-
lichen Stoff führt den Künstler dazu, Stellen der Dichtung, in denen
Goethe in knappster Form eine seelische Impression wiedergibt, wie in
der Zwinger- und der Domszene, breit mit allerlei vom Dichter nirgends
angedeuteten Nebenepisoden auszumalen und so den bildmäßigen
Reichtum zwar zu erhöhen, den geistigen Gehalt der Darstellung aber
zurückzudrängen. Mit der allzu großen Sucht nach Verdeutlichung ist
Cornelius an dem Transzendentalen des Stoffes gänzlich gescheitert.
Der Titel »Illustrationen* ist falsch. ►Bilder zu Goethes Faust« nannte
Cornelius sein Werk; es sind Paraphrasen über Goethesche Themen,
. freie künstlerische Übersetzungen eines poetischen Vorwurfes in die
Sprache romantischer Zeichenkunst. Mit der paraphrasierenden, episch
breiten Ausmalung der dichterisch knappsten Szene der Tragödie, die
der Phantasie des Lesers den weitesten Spielraum läßt, hat Cornelius
denn auch die tiefste Wirkung erzielt und damit sein schönstes Blatt
o-eschaffen. Der Ritt vorbei am Rabenstein ist eine Komposition von
wirklich genialem Wurf, die der reifsten Schöpfung des Künstlers, seinen
apokalyptischen Reitern, ebenbürtig zur Seite steht.
Dem Neudruck der Stiche hat Dr. Alfred Kuhn eine hübsch
geschriebene Einleitung beigegeben, in der die geistigen Erlebnisse, die
für die Art, in der Cornelius sein Jugendwerk schuf, ausschlaggebend
waren, übersichtlich und klar entwickelt sind. Die eigentliche künst-
lerische Würdigung der Folge und die Festlegung ihres kunsthistorischen
Platzes hat er sich für die von ihm vorbereitete Cornelius-Biographie
gespart.
L. v. Baldass.
Friedrich Wasmann, Zeichnung.
Friedrich Wasmann. Ein deutsches Künstler-
leben, von ihm selbst geschildert. Herausgegeben von
Bernt Grönvold. Leipzig, Insel-Verlag, 1915.
Friedrich Wasmanns Selbstbiographie ist eines der wertvollsten
Dokumente zur Geschichte des norddeutschen Naturalismus der ersten
Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Neunzehn Jahre vergingen seit der ersten
Ausgabe dieses wunderbaren Buches. Nun, da es zum zweiten Male in
die Öffentlichkeit tritt, kann es wohl auf verständnisvollere Aufnahme
rechnen als damals. Bernt Grönvolds feinsinniges Kunstempfinden, dem
wir die Wiedererweckung des vergessenen Künstlers verdanken, war
seiner Zeit vorausgeeilt, als er die Bedeutung Wasmanns erkannte und
seine Kunst zu einem Gegenwartswert machen wollte. Erst ein Dezennium
nach seiner Entdeckung Wasmanns in einem kleinen Meraner Trödler-
laden kam die Jahrhundertaussteüung in der Berliner Nationalgalerie
zustande, die so viel verschollene Kunst ans Licht brachte. Erst da war
die Zeit reif geworden zur Erkenntnis der herben Größe und malerischen
Tiefe des norddeutschen Naturalismus. Von da an datiert auch erst die
allgemeine Schätzung Wasmanns als des bedeutendsten der Hamburger
Künstlergruppe, der Grönvold seine liebevolle Sammlertätigkeit widmete.
Denn nicht nur Wasmann >stöberte« er — um mit seinen eigenen
Worten zu reden — »aus der Rumpelkammer der deutschen Kunst-
vergangenheit hervor«, sondern auch Janssen, Beckmann und die beiden
Rohden. Sie zeigen, daß Wasmanns Kunst nicht eine einsame Sonder-
erscheinung war, sondern in einer hochentwickelten malerischen Kultur
wurzelte und Vorgänger wie Zeitgenossen hatte, deren Leistungen seiner
Höhe oft sehr nahe kamen.
Wasmanns Selbstbiographie ist kein Werk, das der Künstler nur
für sich allein niederschrieb, einzig zu dem Zweck, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen. Sie ist keines jener stillen Zwiegespräche, das
Menschen oft mit ihrer Erinnerung führen und aufzeichnen, um es dann
für immer in einer dunklen Lade ruhen zu lassen. Wohl waren diese
Besprechungen neuer Erscheinungen.
DieFaustillustrationen des Peter Cornelius,
in Stichen von Ruscheweyh und Thaeter mit einer Einlei-
tung von Dr. A. Kahn. Berlin, D. Reimer (E. Vohsen), 1916.
Dieser Neudruck der Faustillustrationen des Cornelius verdankt
einem glücklichen Zufall seine Entstehung. Als der Verlag Dietrich
Reimer gelegentlich der Metallabgabe seine Bestände an Kupferplatten
revidierte, da fanden sich auch die von Ruscheweyh und Thaeter nach
Cornelius' Zeichnungen gestochenen Originalplatten, von deren Existenz
niemand mehr gewußt hatte. Es ist dem Verlag, dessen Tätigkeit sich
heute in ganz anderen Bahnen bewegt, sehr als Verdienst anzurechnen,
daß er diesen glücklichen Zufall sich zunutze gemacht und in einer Zeit,
die der Kunst des Cornelius wieder lebhaftes Interesse entgegenbringt,
einen Neudruck veranstaltet hat, der an Klarheit und Schärfe den alten
Abzügen kaum nachsteht.
Die historische Bedeutung dieses ersten großen Werkes des
Cornelius ist die denkbar größte. Es hat fast stärker auf die Zeitgenossen
gewirkt als alle späteren, der Reifezeit des Meisters angehörenden Kompo-
sitionen. Bedeutet doch diese Folge, die in der Formensprache noch zum
Teil auf klassizistischen Traditionen beruht und in der Ornamentik von
Kunge inspiriert erscheint, die erste große figürliche Schöpfung der
Romantik. Zum erstenmal war ein Stoff, der den Zeitgenossen schon
infolge des deutsch-mittelalterlich-katholischen Milieus romantisch zu
sein schien, auch auf romantische Art wiedergegeben worden. Kühl war
nur die Aufnahme durch Goethe selbst. Dies hatte wohl nicht nur darin
seine Ursache, daß Goethe der romantischen Richtung überhaupt spinne-
feind war, sondern gewiß mit darin, daß er sein Werk in einer Weise
interpretiert fand, die seiner eigenen Auffassung widersprach. Von dieser
Erkenntnis, daß Goethes Tragödie und die Zeichnungen des Cornelius
der Auffassung nach zwei verschiedenen Welten entstammen, muß auch
der moderne Betrachter ausgehen, wenn er die Bedeutung und künst-
lerische Kraft dieser Zeichnungen richtig einschätzen will. Charak-
teristisch erscheint schon die Auswahl der wiedergegebenen Momente,
die das ganze Schwergewicht auf die Gretchenszenen legt, die alles
Lyrische, alles philosophisch Meditierende auf Kosten alles Dramatischen
und episch breit Erzählenden unterdrückt. Der alte Faust wird nur in zwei
für die Exposition der Dichtung verhältnismäßig nebensächlichen Szenen,
im Osterspaziergang und in Auerbachs Keller, vorgeführt; in seiner
Erscheinung suchen wir vergebens nach dem Stempel des Über-
menschentums, und Mephisto ist nicht der Schalk unter den Geistern,
die verneinen, sondern der Böse schlechtweg. Die Freude am mittelalter-
lichen Stoff führt den Künstler dazu, Stellen der Dichtung, in denen
Goethe in knappster Form eine seelische Impression wiedergibt, wie in
der Zwinger- und der Domszene, breit mit allerlei vom Dichter nirgends
angedeuteten Nebenepisoden auszumalen und so den bildmäßigen
Reichtum zwar zu erhöhen, den geistigen Gehalt der Darstellung aber
zurückzudrängen. Mit der allzu großen Sucht nach Verdeutlichung ist
Cornelius an dem Transzendentalen des Stoffes gänzlich gescheitert.
Der Titel »Illustrationen* ist falsch. ►Bilder zu Goethes Faust« nannte
Cornelius sein Werk; es sind Paraphrasen über Goethesche Themen,
. freie künstlerische Übersetzungen eines poetischen Vorwurfes in die
Sprache romantischer Zeichenkunst. Mit der paraphrasierenden, episch
breiten Ausmalung der dichterisch knappsten Szene der Tragödie, die
der Phantasie des Lesers den weitesten Spielraum läßt, hat Cornelius
denn auch die tiefste Wirkung erzielt und damit sein schönstes Blatt
o-eschaffen. Der Ritt vorbei am Rabenstein ist eine Komposition von
wirklich genialem Wurf, die der reifsten Schöpfung des Künstlers, seinen
apokalyptischen Reitern, ebenbürtig zur Seite steht.
Dem Neudruck der Stiche hat Dr. Alfred Kuhn eine hübsch
geschriebene Einleitung beigegeben, in der die geistigen Erlebnisse, die
für die Art, in der Cornelius sein Jugendwerk schuf, ausschlaggebend
waren, übersichtlich und klar entwickelt sind. Die eigentliche künst-
lerische Würdigung der Folge und die Festlegung ihres kunsthistorischen
Platzes hat er sich für die von ihm vorbereitete Cornelius-Biographie
gespart.
L. v. Baldass.
Friedrich Wasmann, Zeichnung.
Friedrich Wasmann. Ein deutsches Künstler-
leben, von ihm selbst geschildert. Herausgegeben von
Bernt Grönvold. Leipzig, Insel-Verlag, 1915.
Friedrich Wasmanns Selbstbiographie ist eines der wertvollsten
Dokumente zur Geschichte des norddeutschen Naturalismus der ersten
Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Neunzehn Jahre vergingen seit der ersten
Ausgabe dieses wunderbaren Buches. Nun, da es zum zweiten Male in
die Öffentlichkeit tritt, kann es wohl auf verständnisvollere Aufnahme
rechnen als damals. Bernt Grönvolds feinsinniges Kunstempfinden, dem
wir die Wiedererweckung des vergessenen Künstlers verdanken, war
seiner Zeit vorausgeeilt, als er die Bedeutung Wasmanns erkannte und
seine Kunst zu einem Gegenwartswert machen wollte. Erst ein Dezennium
nach seiner Entdeckung Wasmanns in einem kleinen Meraner Trödler-
laden kam die Jahrhundertaussteüung in der Berliner Nationalgalerie
zustande, die so viel verschollene Kunst ans Licht brachte. Erst da war
die Zeit reif geworden zur Erkenntnis der herben Größe und malerischen
Tiefe des norddeutschen Naturalismus. Von da an datiert auch erst die
allgemeine Schätzung Wasmanns als des bedeutendsten der Hamburger
Künstlergruppe, der Grönvold seine liebevolle Sammlertätigkeit widmete.
Denn nicht nur Wasmann >stöberte« er — um mit seinen eigenen
Worten zu reden — »aus der Rumpelkammer der deutschen Kunst-
vergangenheit hervor«, sondern auch Janssen, Beckmann und die beiden
Rohden. Sie zeigen, daß Wasmanns Kunst nicht eine einsame Sonder-
erscheinung war, sondern in einer hochentwickelten malerischen Kultur
wurzelte und Vorgänger wie Zeitgenossen hatte, deren Leistungen seiner
Höhe oft sehr nahe kamen.
Wasmanns Selbstbiographie ist kein Werk, das der Künstler nur
für sich allein niederschrieb, einzig zu dem Zweck, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen. Sie ist keines jener stillen Zwiegespräche, das
Menschen oft mit ihrer Erinnerung führen und aufzeichnen, um es dann
für immer in einer dunklen Lade ruhen zu lassen. Wohl waren diese