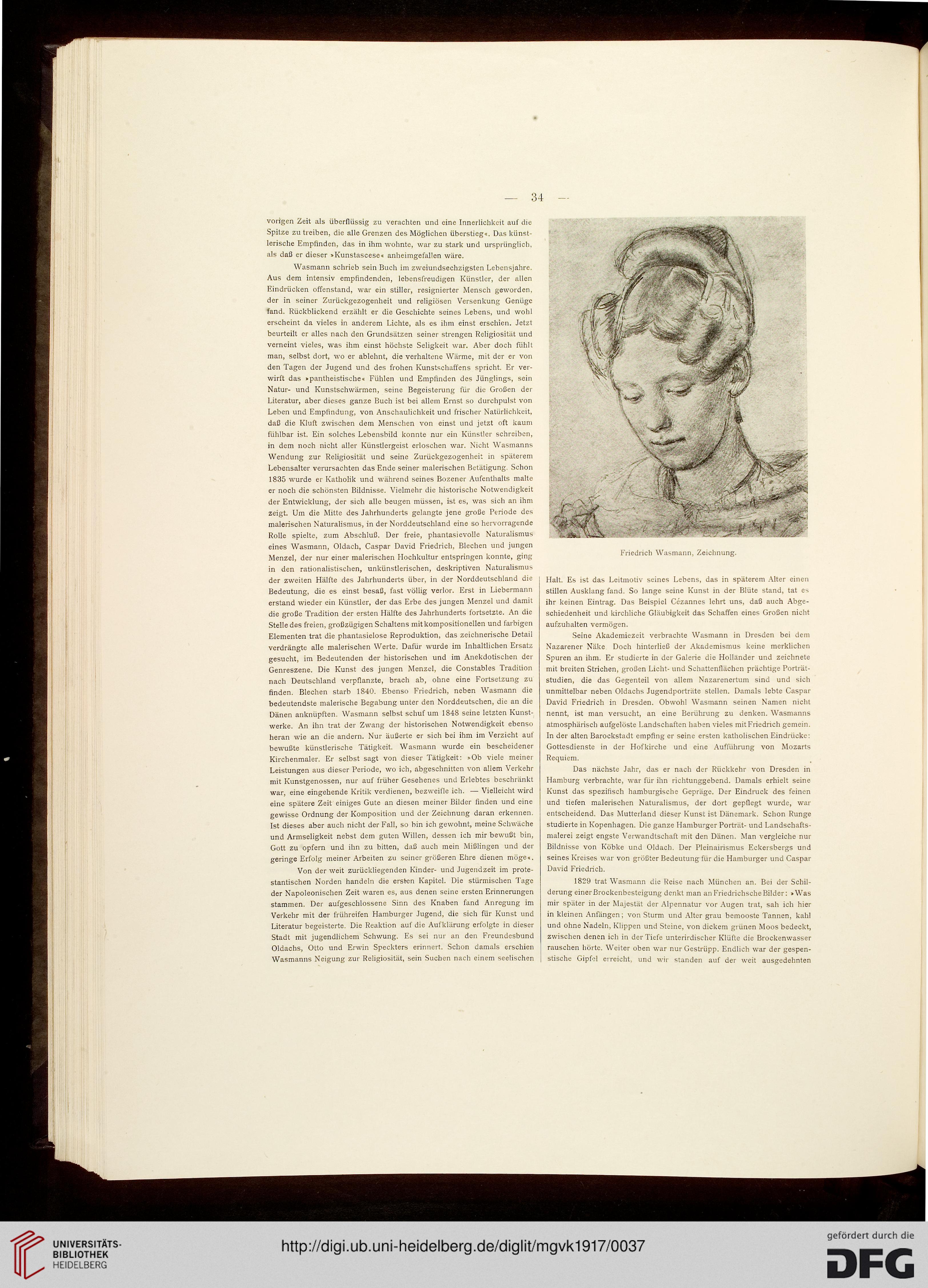34
vorigen Zeit als überflüssig zu verachten und eine Innerlichkeit auf die
Spitze zu treiben, die alle Grenzen des Möglichen überstieg«. Das künst-
lerische Empfinden, das in ihm wohnte, war zu stark und ursprünglich,
als daß er dieser »Kunstascese« anheimgefallen wäre.
Wasmann schrieb sein Buch im zweiundsechzigsten Lehensjahre.
Aus dem intensiv empfindenden, lebensfreudigen Künstler, der allen
Eindrücken offenstand, war ein stiller, resignierter Mensch geworden,
der in seiner Zurückgezogenheit und religiösen Versenkung Genüge
fand. Rückblickend erzählt er die Geschichte seines Lebens, und wohl
erscheint da vieles in anderem Lichte, als es ihm einst erschien. Jetzt
beurteilt er alles nach den Grundsätzen seiner strengen Religiosität und
verneint vieles, was ihm einst höchste Seligkeit war. Aber doch fühlt
man, selbst dort, wo er ablehnt, die verhaltene Warme, mit der er von
den Tagen der Jugend und des frohen Kunstschaffens spricht. Er ver-
wirft das >pantheistische« Fühlen und Empfinden des Jünglings, sein
Natur- und Kunstschwärmen, seine Begeisterung für die Großen der
Literatur, aber dieses ganze Buch ist bei allem Ernst so durchpulst von
Leben und Empfindung, von Anschaulichkeit und frischer Natürlichkeit,
daß die Kluft zwischen dem Menschen von einst und jetzt oft kaum
fühlbar ist. Ein solches Lebensbild konnte nur ein Künstler schreiben,
in dem noch nicht aller Künstlergeist erloschen war. Nicht Wasmanns
Wendung zur Religiosität und seine Zurückgezogenheit in späterem
Lebensalter verursachten das Ende seiner malerischen Betätigung, Schon
1835 wurde er Katholik und während seines Bozener Aufenthalts malte
er noch die schönsten Bildnisse. Vielmehr die historische Notwendigkeit
der Entwicklung, der sich alle beugen müssen, ist es, was sich an ihm
zeigt. Um die Mitte des Jahrhunderts gelangte jene große Periode des
malerischen Naturalismus, in der Norddeutschland eine so hervorragende
Rolle spielte, zum Abschluß. Der freie, phantasievolle Naturalismus
eines Wasmann, Oldach, Caspar David Friedrich, Blechen und jungen
Menzel, der nur einer malerischen Hochkultur entspringen konnte, ging
in den rationalistischen, unkünstlerischen, deskriptiven Naturalismus
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts über, in der Norddeutschland die
Bedeutung, die es einst besaß, fast völlig verlor. Erst in Liebermann
erstand wieder ein Künstler, der das Erbe des jungen Menzel und damit
die große Tradition der ersten Hälfte des Jahrhunderts fortsetzte. An die
Stelle des freien, großzügigen Schaltens mitkompositionellen und farbigen
Elementen trat die phantasielose Reproduktion, das zeichnerische Detail
verdrängte alle malerischen Werte. Dafür wurde im Inhaltlichen Ersatz
gesucht, im Bedeutenden der historischen und im Anekdotischen der
Genreszene. Die Kunst des jungen Menzel, die Constables Tradition
nach Deutschland verpflanzte, brach ab, ohne eine Fortsetzung zu
finden. Blechen starb 1840. Ebenso Friedrich, neben Wasmann die
bedeutendste malerische Begabung unter den Norddeutschen, die an die
Dänen anknüpften. Wasmann selbst schuf um 1848 seine letzten Kunst-
werke. An ihn trat der Zwang der historischen Notwendigkeit ebenso
heran wie an die andern. Nur äußerte er sich bei ihm im Verzicht auf
bewußte künstlerische Tätigkeit. Wasmann wurde ein bescheidener
Kirchenmaler. Er selbst sagt von dieser Tätigkeit: »Ob viele meiner
Leistungen aus dieser Periode, wo ich, abgeschnitten von allem Verkehr
mit Kunstgenossen, nur auf früher Gesehenes und Erlebtes beschränkt
war, eine eingehende Kritik verdienen, bezweifle ich. — Vielleicht wird
eine spätere Zeit einiges Gute an diesen meiner Bilder finden und eine
gewisse Ordnung der Komposition und der Zeichnung daran erkennen.
Ist dieses aber auch nicht der Fall, so bin ich gewohnt, meine Schwäche
und Armseligkeit nebst dem guten Willen, dessen ich mir bewußt bin,
Gott zu opfern und ihn zu bitten, daß auch mein Mißlingen und der
geringe Erfolg meiner Arbeiten zu seiner größeren Ehre dienen möge«.
Von der weit zurückliegenden Kinder- und Jugendzeit im prote-
stantischen Norden handeln die ersten Kapitel. Die stürmischen Tage
der Napoleonischen Zeit waren es, aus denen seine ersten Erinnerungen
stammen. Der aufgeschlossene Sinn des Knaben fand Anregung im
Verkehr mit der frühreifen Hamburger Jugend, die sich für Kunst und
Literatur begeisterte. Die Reaktion auf die Aufklärung erfolgte in dieser
Stadt mit jugendlichem Schwung. Es sei nur an den Freundesbund
Oldachs, Otto und Erwin Speckters erinnert. Schon damals erschien
Wasmanns Neigung zur Religiosität, sein Suchen nach einem seelischen
. iäfc... VWZ!*
Halt. Es ist das Leitmotiv seines Lebens, das in späterem Alter einen
stillen Ausklang fand. So lange seine Kunst in der Blüte stand, tat es
ihr keinen Eintrag. Das Beispiel Cezannes lehrt uns, daß auch Abge-
schiedenheit und kirchliche Gläubigkeit das Schaffen eines Großen nicht
aufzuhalten vermögen.
Seine Akademiezeit verbrachte Wasmann in Dresden bei dem
Nazarener Näke Doch hinterließ der Akademismus keine merklichen
Spuren an ihm. Er studierte in der Galerie die Hollander und zeichnete
mit breiten Strichen, großen Licht- und Schattenflächen prächtige Porträt-
studien, die das Gegenteil von allem Nazarenertum sind und sich
unmittelbar neben Oldachs Jugendportrate stellen. Damals lebte Caspar
David Friedrich in Dresden. Obwohl Wasmann seinen Namen nicht
nennt, ist man versucht, an eine Berührung zu denken. Wasmanns
atmosphärisch aufgelöste Landschaften haben vieles mit Friedrich gemein.
In der alten Barockstadt empfing er seine ersten katholischen Eindrücke:
Gottesdienste in der Hofkirche und eine Aufführung von Mozarts
Requiem.
Das nächste Jahr, das er nach der Rückkehr von Dresden in
Hamburg verbrachte, war für ihn richtunggebend. Damals erhielt seine
Kunst das spezifisch hamburgische Gepräge. Der Eindruck des feinen
und tiefen malerischen Naturalismus, der dort gepflegt wurde, war
entscheidend. Das Mutterland dieser Kunst ist Dänemark. Schon Runge
studierte in Kopenhagen. Die ganze Hamburger Porträt- und Landschafts-
malerei zeigt engste Verwandtschaft mit den Dänen. Man vergleiche nur
Bildnisse von Köbke und Oldach. Der Pleinairismus Eckersbergs und
seines Kreises war von größter Bedeutung für die Hamburger und Caspar
David Friedrich.
1829 trat Wasmann die Reise nach München an. Bei der Schil-
derang einer Brockenbesteigung denkt man an Friedrichsche Bilder: >Was
mir später in der Majestät der Alpennatur vor Augen trat, sah ich hier
in kleinen Anfängen; von Sturm und Alter grau bemooste Tannen, kahl
und ohne Nadeln, Klippen und Steine, von dickem grünen Moos bedeckt,
zwischen denen ich in der Tiefe unterirdischer Klüfte die Brockenwasser
rauschen hörte. Weiter oben war nur Gestrüpp. Endlich war der gespen-
stische Gipfel ei reicht, und wir standen auf der weit ausgedehnten
vorigen Zeit als überflüssig zu verachten und eine Innerlichkeit auf die
Spitze zu treiben, die alle Grenzen des Möglichen überstieg«. Das künst-
lerische Empfinden, das in ihm wohnte, war zu stark und ursprünglich,
als daß er dieser »Kunstascese« anheimgefallen wäre.
Wasmann schrieb sein Buch im zweiundsechzigsten Lehensjahre.
Aus dem intensiv empfindenden, lebensfreudigen Künstler, der allen
Eindrücken offenstand, war ein stiller, resignierter Mensch geworden,
der in seiner Zurückgezogenheit und religiösen Versenkung Genüge
fand. Rückblickend erzählt er die Geschichte seines Lebens, und wohl
erscheint da vieles in anderem Lichte, als es ihm einst erschien. Jetzt
beurteilt er alles nach den Grundsätzen seiner strengen Religiosität und
verneint vieles, was ihm einst höchste Seligkeit war. Aber doch fühlt
man, selbst dort, wo er ablehnt, die verhaltene Warme, mit der er von
den Tagen der Jugend und des frohen Kunstschaffens spricht. Er ver-
wirft das >pantheistische« Fühlen und Empfinden des Jünglings, sein
Natur- und Kunstschwärmen, seine Begeisterung für die Großen der
Literatur, aber dieses ganze Buch ist bei allem Ernst so durchpulst von
Leben und Empfindung, von Anschaulichkeit und frischer Natürlichkeit,
daß die Kluft zwischen dem Menschen von einst und jetzt oft kaum
fühlbar ist. Ein solches Lebensbild konnte nur ein Künstler schreiben,
in dem noch nicht aller Künstlergeist erloschen war. Nicht Wasmanns
Wendung zur Religiosität und seine Zurückgezogenheit in späterem
Lebensalter verursachten das Ende seiner malerischen Betätigung, Schon
1835 wurde er Katholik und während seines Bozener Aufenthalts malte
er noch die schönsten Bildnisse. Vielmehr die historische Notwendigkeit
der Entwicklung, der sich alle beugen müssen, ist es, was sich an ihm
zeigt. Um die Mitte des Jahrhunderts gelangte jene große Periode des
malerischen Naturalismus, in der Norddeutschland eine so hervorragende
Rolle spielte, zum Abschluß. Der freie, phantasievolle Naturalismus
eines Wasmann, Oldach, Caspar David Friedrich, Blechen und jungen
Menzel, der nur einer malerischen Hochkultur entspringen konnte, ging
in den rationalistischen, unkünstlerischen, deskriptiven Naturalismus
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts über, in der Norddeutschland die
Bedeutung, die es einst besaß, fast völlig verlor. Erst in Liebermann
erstand wieder ein Künstler, der das Erbe des jungen Menzel und damit
die große Tradition der ersten Hälfte des Jahrhunderts fortsetzte. An die
Stelle des freien, großzügigen Schaltens mitkompositionellen und farbigen
Elementen trat die phantasielose Reproduktion, das zeichnerische Detail
verdrängte alle malerischen Werte. Dafür wurde im Inhaltlichen Ersatz
gesucht, im Bedeutenden der historischen und im Anekdotischen der
Genreszene. Die Kunst des jungen Menzel, die Constables Tradition
nach Deutschland verpflanzte, brach ab, ohne eine Fortsetzung zu
finden. Blechen starb 1840. Ebenso Friedrich, neben Wasmann die
bedeutendste malerische Begabung unter den Norddeutschen, die an die
Dänen anknüpften. Wasmann selbst schuf um 1848 seine letzten Kunst-
werke. An ihn trat der Zwang der historischen Notwendigkeit ebenso
heran wie an die andern. Nur äußerte er sich bei ihm im Verzicht auf
bewußte künstlerische Tätigkeit. Wasmann wurde ein bescheidener
Kirchenmaler. Er selbst sagt von dieser Tätigkeit: »Ob viele meiner
Leistungen aus dieser Periode, wo ich, abgeschnitten von allem Verkehr
mit Kunstgenossen, nur auf früher Gesehenes und Erlebtes beschränkt
war, eine eingehende Kritik verdienen, bezweifle ich. — Vielleicht wird
eine spätere Zeit einiges Gute an diesen meiner Bilder finden und eine
gewisse Ordnung der Komposition und der Zeichnung daran erkennen.
Ist dieses aber auch nicht der Fall, so bin ich gewohnt, meine Schwäche
und Armseligkeit nebst dem guten Willen, dessen ich mir bewußt bin,
Gott zu opfern und ihn zu bitten, daß auch mein Mißlingen und der
geringe Erfolg meiner Arbeiten zu seiner größeren Ehre dienen möge«.
Von der weit zurückliegenden Kinder- und Jugendzeit im prote-
stantischen Norden handeln die ersten Kapitel. Die stürmischen Tage
der Napoleonischen Zeit waren es, aus denen seine ersten Erinnerungen
stammen. Der aufgeschlossene Sinn des Knaben fand Anregung im
Verkehr mit der frühreifen Hamburger Jugend, die sich für Kunst und
Literatur begeisterte. Die Reaktion auf die Aufklärung erfolgte in dieser
Stadt mit jugendlichem Schwung. Es sei nur an den Freundesbund
Oldachs, Otto und Erwin Speckters erinnert. Schon damals erschien
Wasmanns Neigung zur Religiosität, sein Suchen nach einem seelischen
. iäfc... VWZ!*
Halt. Es ist das Leitmotiv seines Lebens, das in späterem Alter einen
stillen Ausklang fand. So lange seine Kunst in der Blüte stand, tat es
ihr keinen Eintrag. Das Beispiel Cezannes lehrt uns, daß auch Abge-
schiedenheit und kirchliche Gläubigkeit das Schaffen eines Großen nicht
aufzuhalten vermögen.
Seine Akademiezeit verbrachte Wasmann in Dresden bei dem
Nazarener Näke Doch hinterließ der Akademismus keine merklichen
Spuren an ihm. Er studierte in der Galerie die Hollander und zeichnete
mit breiten Strichen, großen Licht- und Schattenflächen prächtige Porträt-
studien, die das Gegenteil von allem Nazarenertum sind und sich
unmittelbar neben Oldachs Jugendportrate stellen. Damals lebte Caspar
David Friedrich in Dresden. Obwohl Wasmann seinen Namen nicht
nennt, ist man versucht, an eine Berührung zu denken. Wasmanns
atmosphärisch aufgelöste Landschaften haben vieles mit Friedrich gemein.
In der alten Barockstadt empfing er seine ersten katholischen Eindrücke:
Gottesdienste in der Hofkirche und eine Aufführung von Mozarts
Requiem.
Das nächste Jahr, das er nach der Rückkehr von Dresden in
Hamburg verbrachte, war für ihn richtunggebend. Damals erhielt seine
Kunst das spezifisch hamburgische Gepräge. Der Eindruck des feinen
und tiefen malerischen Naturalismus, der dort gepflegt wurde, war
entscheidend. Das Mutterland dieser Kunst ist Dänemark. Schon Runge
studierte in Kopenhagen. Die ganze Hamburger Porträt- und Landschafts-
malerei zeigt engste Verwandtschaft mit den Dänen. Man vergleiche nur
Bildnisse von Köbke und Oldach. Der Pleinairismus Eckersbergs und
seines Kreises war von größter Bedeutung für die Hamburger und Caspar
David Friedrich.
1829 trat Wasmann die Reise nach München an. Bei der Schil-
derang einer Brockenbesteigung denkt man an Friedrichsche Bilder: >Was
mir später in der Majestät der Alpennatur vor Augen trat, sah ich hier
in kleinen Anfängen; von Sturm und Alter grau bemooste Tannen, kahl
und ohne Nadeln, Klippen und Steine, von dickem grünen Moos bedeckt,
zwischen denen ich in der Tiefe unterirdischer Klüfte die Brockenwasser
rauschen hörte. Weiter oben war nur Gestrüpp. Endlich war der gespen-
stische Gipfel ei reicht, und wir standen auf der weit ausgedehnten