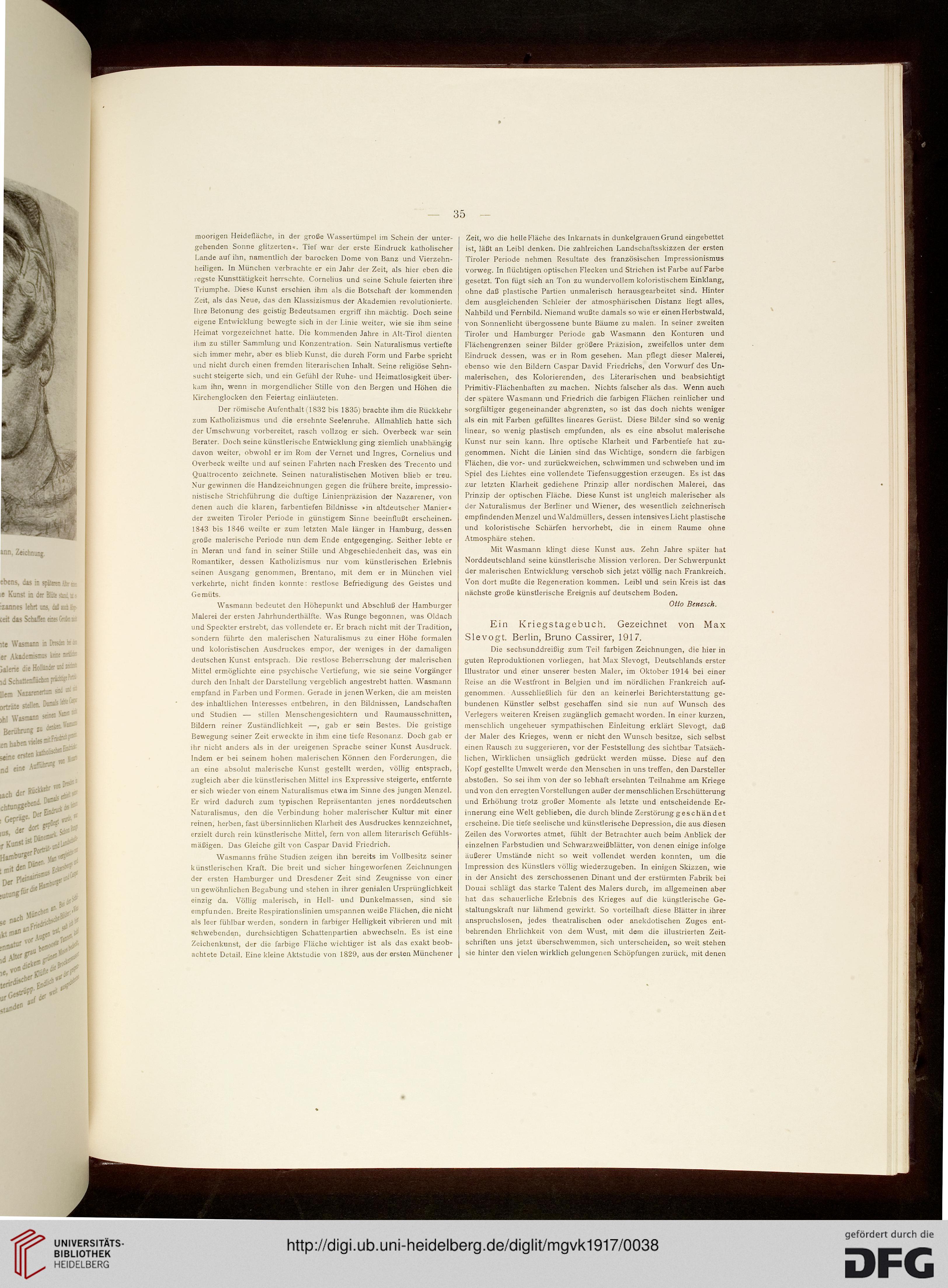. nuag.
ebens, dis in ipiten
:zannes lehrt uns. dj
ceit das Schiffen am
ite Wtsminn in Drs
er Ak»C;~
Jtlerie c I
Uem Hl»
orträte stellr
>hl Wismm W
Benibrur:
mhib!'
Mb.««
nde,neA«f«W
4„ dort P?"
:rKU" o^
HUnburg«F0
.utu"5lu
seO«'11
Min«11'
35
moorigen Heidefläche, in der große Wassertümpel im Schein der unter-
gehenden Sonne glitzerten«. Tief war der erste Eindruck katholischer
Lande auf ihn, namentlich der barocken Dome von Banz und Vierzehn-
heiligen. In München verbrachte er ein Jahr der Zeit, als hier eben die
icgste Kunsttätigkeit herrschte. Cornelius und seine Schule feierten ihre
Triumphe. Diese Kunst erschien ihm als die Botschaft der kommenden
Zeit, als das Neue, das den Klassizismus der Akademien revolutionierte.
Ihre Betonung des geistig Bedeutsamen ergriff ihn machtig, Doch seine
eigene Entwicklung bewegte sich in der Linie weiter, wie sie ihm seine
Heimat vorgezeichnet hatte. Die kommenden Jahre in Alt-Tirol dienten
ihm zu stiller Sammlung und Konzentration. Sein Naturalismus vertiefte
sich immer mehr, aber es blieb Kunst, die durch Form und Farbe spricht
und nicht durch einen fremden literarischen Inhalt. Seine religiöse Sehn-
sucht steigerte sich, und ein Gefühl der Ruhe- und Heimatlosigkeit über-
kam ihn, wenn in morgendlicher Stille von den Bergen und Hohen die
Kirchenglocken den Feiertag einläuteten.
Der römische Aufenthalt(1832 bis 1835) brachte ihm die Ruckkehr
zum Katholizismus und die ersehnte Seelenruhe. Allmählich hatte sich
der Umschwung vorbereitet, rasch vollzog er sich. Overbeck war sein
Berater. Doch seine künstlerische Entwicklung ging ziemlich unabhängig
davon weiter, obwohl er im Rom der Vernet und Ingres, Cornelius und
Overbeck weilte und auf seinen Fahrten nach Fresken des Trecento und
Quattrocento zeichnete. Seinen naturalistischen Motiven blieb er treu.
Nur gewinnen die Handzeichnungen gegen die frühere breite, impressio-
nistische Stnchführung die duftige Linienpräzision der Nazarener, von
denen auch die klaren, farbentiefen Bildnisse »in altdeutscher Manier*
der zweiten Tiroler Periode in günstigem Sinne beeinflußt erscheinen.
1S43 bis 1S46 weilte er zum letzten Male länger in Hamburg, dessen
große malerische Periode nun dem Ende entgegenging. Seither lebte er
in Meran und fand in seiner Stille und Abgeschiedenheit das, was ein
Romantiker, dessen Katholizismus nur vom künstlerischen Erlebnis
seinen Ausgang genommen, Brentano, mit dem er in München viel
verkehrte, nicht finden konnte: restlose Befriedigung des Geistes und
Gemüts.
Wasmann bedeutet den Höhepunkt und Abschluß der Hamburger
Malerei der ersten Jahrhunderthälfte. Was Runge begonnen, was Oldach
und Speckter erstrebt, das vollendete er. Er brach nicht mit der Tradition,
sondern führte den malerischen Naturalismus zu einer Höhe formalen
und koloristischen Ausdruckes empor, der weniges in der damaligen
deutschen Kunst entsprach. Die restlose Beherrschung der malerischen
Mittel ermöglichte eine psychische Vertiefung, wie sie seine Vorgänger
durch den Inhalt der Darstellung vergeblich angestrebt hatten. Wasmann
empfand in Farben und Formen. Gerade in jenen Werken, die am meisten
des- inhaltlichen Interesses entbehren, in den Bildnissen, Landschaften
und Studien — stillen Menschengesichtern und Raumausschnitten,
Büdern reiner Zustandlichkeit —, gab er sein Bestes. Die geistige
Bewegung seiner Zeit erweckte in ihm eine tiefe Resonanz. Doch gab er
ihr nicht anders als in der ureigenen Sprache seiner Kunst Ausdruck.
Indem er bei seinem hohen malerischen Können den Forderungen, die
an eine absolut malerische Kunst gestellt werden, völlig entsprach,
zugleich aber die künstlerischen Mittel ins Expressive steigerte, entfernte
er sich wieder von einem Naturalismus etwa im Sinne des jungen Menzel.
Er wird dadurch zum typischen Repräsentanten jenes norddeutschen
Naturalismus, den die Verbindung hoher malerischer Kultur mit einer
reinen, herben, fast übersinnlichen Klarheit des Ausdruckes kennzeichnet,
erzielt durch rein künstlerische Mittel, fern von allem literarisch Gefühls-
mäßigen. Das Gleiche gilt von Caspar David Friedrich.
Wasmanns frühe Studien zeigen ihn bereits im Vollbesitz seiner
künstlerischen Kraft. Die breit und sicher hingeworfenen Zeichnungen
der ersten Hamburger und Dresdener Zeit sind Zeugnisse von einer
ungewöhnlichen Begabung und stehen in ihrer genialen Ursprünglichkeit
einzig da. Völlig malerisch, in Hell- und Dunkelmassen, sind sie
empfunden. Breite Respirationslinien umspannen weiße Flächen, die nicht
als leer fühlbar werden, sondern in farbiger Helligkeit vibrieren und mit
schwebenden, durchsichtigen Schattenpartien abwechseln. Es ist eine
Zeichenkunst, der die farbige Fläche wichtiger ist als das exakt beob-
achtete Detail. Eine kleine Aktstudie von 1829, aus der ersten Münchener
Zeit, wo die helle Fläche des Inkarnats in dunkelgrauen Grund eingebettet
ist, läßt an Leibl denken. Die zahlreichen Landschaftsskizzen der ersten
Tiroler Periode nehmen Resultate des französischen Impressionismus
vorweg. In flüchtigen optischen Flecken und Strichen ist Farbe auf Farbe
gesetzt. Ton fügt sich an Ton zu wundervollem koloristischem Einklang,
ohne daß plastische Partien unmalerisch herausgearbeitet sind. Hinter
dem ausgleichenden Schleier der atmosphärischen Distanz liegt alles,
Nahbild und Fernbild. Niemand wußte damals so wie er einen Herbstwald,
von Sonnenlicht übergossene bunte Bäume zu malen. In seiner zweiten
Tiroler und Hamburger Periode gab Wasmann den Konturen und
Flächengrenzen seiner Bilder größere Präzision, zweifellos unter dem
Eindruck dessen, was er in Rom gesehen. Man pflegt dieser Malerei,
ebenso wie den Bildern Caspar David Friedrichs, den Vorwurf des Un-
malerischen, des Kolorierenden, des Literarischen und beabsichtigt
Primitiv-FIächenhaften zu machen. Nichts falscher als das. Wenn auch
der spätere Wasmann und Friedrich die farbigen Flächen reinlicher und
sorgfältiger gegeneinander abgrenzten, so ist das doch nichts weniger
als ein mit Farben gefülltes lineares Gerüst. Diese Bilder sind so wenig
linear, so wenig plastisch empfunden, als es eine absolut malerische
Kunst nur sein kann. Ihre optische Klarheit und Farbentiefe hat zu-
genommen. Nicht die Linien sind das Wichtige, sondern die farbigen
Flächen, die vor- und zurückweichen, schwimmen und schweben und im
Spiel des Lichtes eine vollendete Tiefensuggestion erzeugen. Es ist das
zur letzten Klarheit gediehene Prinzip aller nordischen Malerei, das
Prinzip der optischen Fläche. Diese Kunst ist ungleich malerischer als
der Naturalismus der Berliner und Wiener, des wesentlich zeichnerisch
empfindenden Menzel und Waldmülleis, dessen intensives Licht plastische
und koloristische Schärfen hervorhebt, die in einem Räume ohne
Atmosphäre stehen.
Mit Wasmann klingt diese Kunst aus. Zehn Jahre später hat
Norddeutschland seine künstlerische Mission verloren. Der Schwerpunkt
der malerischen Entwicklung verschob sich jetzt völlig nach Frankreich.
Von dort mußte die Regeneration kommen. Leibl und sein Kreis ist das
nächste große künstlerische Ereignis auf deutschem Boden.
Otto Benesch.
Ein Kriegstagebuch. Gezeichnet von Max
Slevogt. Berlin, Bruno Cassirer, 1917.
Die sechsunddreißig zum Teil farbigen Zeichnungen, die hier in
guten Reproduktionen vorliegen, hat Max Slevogt, Deutschlands erster
Illustrator und einer unserer besten Maler, im Oktober 1914 bei einer
Reise an die Westfront in Belgien und im nördlichen Frankreich auf-
genommen. Ausschließlich für den an keinerlei Berichterstattung ge-
bundenen Künstler selbst geschaffen sind sie nun auf Wunsch des
Verlegers weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden. In einer kurzen,
menschlich ungeheuer sympathischen Einleitung erklärt Slevogt, daß
der Maler des Krieges, wenn er nicht den Wunsch besitze, sich selbst
einen Rausch zu suggerieren, vor der Feststellung des sichtbar Tatsäch-
lichen, Wirklichen unsäglich gedrückt werden müsse. Diese auf den
Kopf gestellte Umwelt werde den Menschen in uns treffen, den Darsteller
abstoßen. So sei ihm von der so lebhaft ersehnten Teilnahme am Kriege
und von den erregten Vorstellungen außer der menschlichen Erschütterung
und Erhöhung trotz großer Momente als letzte und entscheidende Er-
innerung eine Welt geblieben, die durch blinde Zerstörung geschändet
erscheine. Die tiefe seelische und künstlerische Depression, die aus diesen
Zeilen des Vorwortes atmet, fühlt der Betrachter auch beim Anblick der
einzelnen Farbstudien und Schwarzweißblätter, von denen einige infolge
äußerer Umstände nicht so weit vollendet werden konnten, um die
Impression des Kunstlers völlig wiederzugeben. In einigen Skizzen, wie
in der Ansicht des zerschossenen Dinant und der erstürmten Fabrik bei
Douai schlägt das starke Talent des Malers durch, im allgemeinen aber
hat das schauerliche Erlebnis des Krieges auf die künstlerische Ge-
staltungskraft nur lähmend gewirkt. So vorteilhaft diese Blätter in ihrer
anspruchslosen, jedes theatralischen oder anekdotischen Zuges ent-
behrenden Ehrlichkeit von dem Wust, mit dem die illustrierten Zeit-
schriften uns jetzt überschwemmen, sich unterscheiden, so weit stehen
sie hinter den vielen wirklich gelungenen Schöpfungen zurück, mit denen
ur&
„*-*